|
|
|
Umschlagtext
Der zweite Vergleich der Länder der Bundesrepublik Deutschland differenziert die Ergebnisse von PISA 2003 für die einzelnen Länder. Das OECD-"Programme for International Student Assessment" untersucht, wie gut fünfzehnjährige Schülerinnen und Schüler auf Anforderungen der Wissensgesellschaft und auf lebenslanges Lernen vorbereitet sind. Die Ergebnisse zu den Schlüsselbereichen Lesekompetenz, mathematische und naturwissenschaftliche Grundbildung sowie Problemlösen lassen Rückschlüsse über Stärken und Schwächen der Bildungssysteme zu. Dieser Band ordnet die Befunde über die Kompetenzen der Schülerinnen und Schüler aus den Ländern international ein und gibt die Möglichkeit, die Ergebnisse innerhalb der Bundesrepublik Deutschland zu vergleichen. Da PISA in Abständen von drei Jahren durchgeführt wird, erhalten die Länder wichtige Informationen über Veränderungen der Qualität ihrer Bildungsergebnisse. Es werden familiäre wie schulische Entwicklungsbedingungen beschrieben und die Chancen junger Menschen analysiert, ihre Potentiale auszuschöpfen und ihre Kompetenzen zu entwickeln. Der Bericht stellt dar, wie sich die Situation in den Ländern seit der ersten PISA-Erhebung im Jahr 2000 verändert hat.
Das PISA-Konsortium Deutschland: Das PISA-Konsortium Deutschland: Prof. Dr. Manfred Prenzel, Leibniz-Institut für die Pädagogik der Naturwissenschaften, Kiel (Sprecher) Prof. Dr. Jürgen Baumert, Max-Planck-Institut für Bildungsforschung, Berlin Prof. Dr. Werner Blum, Universität Kassel Prof. Dr. Dr. Rainer Lehmann, Humboldt-Universität zu Berlin Prof. Dr. Detlev Leutner, Universität Duisburg-Essen Prof. Dr. Michael Neubrand, Carl von Ossietzky Universität Oldenburg Prof. Dr. Reinhard Pekrun, Ludwig-Maximilians-Universität München Prof. Dr. Jürgen Rost, Leibniz-Institut für die Pädagogik der Naturwissenschaften, Kiel Prof. Dr. Ulrich Schiefele, Universität Bielefeld Rezension
Nun liegt es also in gedruckter Form vor: Das Ergebnis des zweiten Vergleichs der Länder im Rahmen des OECD „Programme for International Student Assessment“ - kurz PISA genannt. Doch dieses Mal sind sie angesichts der Bilanz nicht so sehr erschrocken: Die Lehrer, die Eltern und natürlich die Politiker, die wieder einmal wissen, warum es ist, wie es ist. Doch eines wird schon deutlich: Die Kompetenzen der Schülerinnen und Schüler haben sich gegenüber 2000 verbessert. Das veranlasst die Präsidentin der Ständigen Konferenz der Kultusminister der Länder (Prof. Dr. Johanna Wanka) im Vorwort zu der mutigen und richtungsweisenden Aussage: "Offensichtlich hat sich ein Mentalitätswandel vollzogen, der Früchte trägt und zu Verbesserungen geführt hat." Was aber steht drin im offiziellen PISA-Buch? Es informiert,
- wie die Leistungen der fünfzehnjährigen Jugendlichen im nationalen und internationalen Vergleich einzuordnen sind; - wie sich die Leistungen der Länder von PISA 2000 zu 2003 verändert haben; - inwieweit Unterschiede in der mathematischen Kompetenz mit Unterschieden in der sozialen Herkunft in den einzelnen Ländern gekoppelt sind. Ein besonderes Augenmerk sollte der Leser auf die familiären und schulischen Entwicklungsbedingungen richten. Denn solange Schulqualität sich nicht an diesen Kriterien orientiert, hält die Entwicklung sich nur in Grenzen. Arthur Thömmes, lehrerbibliothek.de Inhaltsverzeichnis
Vorwort 11
1 Einführung in den Ländervergleich PISA 2003 13 Manfred Prenzel, Barbara Drechsel und Claus H. Carstensen 1.1 Das Anliegen der PISA-Erweiterung 2003 13 1.2 Theoretischer Rahmen: Literacy, Kompetenzen, Hintergrundvariablen 16 1.3 Die nationalen Erweiterungen von PISA 20 1.4 Die Anlage der Untersuchung für den Ländervergleich 22 1.4.1 Unterschiedliche Bildungsbeteiligung in den Schularten 22 1.4.2 Die Stichprobenziehung für den Ländervergleich 24 1.4.3 Repräsentativität der Stichproben 27 1.4.4 Effekte von Üben und Testmotivation 29 1.4.5 Durchführung der Erhebung 32 1.4.6 Auswertung und Skalierung 33 1.4.7 Berichterstattung und Darstellung 35 1.5 Von PISA 2000 nach PISA 2003: Belastbare Aussagen über Veränderungen 39 1.6 PISA — Ein kooperatives Unternehmen 41 1.7 Was ist neu beim Ländervergleich PISA 2003?44 1.8 Ergebnisse des Ländervergleichs im Überblick 46 Literatur 49 2 Mathematische Kompetenz im Ländervergleich 51 Michael Neubrand, Werner Blum, Timo Ehmke, Alexander Jordan, Martin Senkbeil, Frauke Ulfig und Claus H. Carstensen 2.1 Mathematical Literacy in PISA 2003 51 2.1.1 Das Konzept Mathematical Literacy 51 2.1.2 Konzeption des internationalen PISA-Mathematiktests 52 2.1.3 Kompetenzstufen 53 2.1.4 Aufgabenbeispiele 55 2.2 Befunde zur mathematischen Kompetenz 58 2.2.1 Mathematische Kompetenz in den Ländern der Bundesrepublik und den OECD-Staaten 59 2.2.2 Kompetenzstufen in Mathematik 62 2.2.3 Ergebnisse in den Inhaltsbereichen im nationalen und internationalen Vergleich 63 2.2.4 Mathematische Kompetenz von Schülerinnen und Schülern mit Migrationshintergrund 71 2.3 Veränderungen in Teilbereichen der mathematischen Kompetenz 73 2.3.1 Inhaltsbereich „Veränderung und Beziehungen" 74 2.3.2 inlialrsbereich „Raum und Form" 75 2.4 Vergleich der mathematischen Kompetenzen in den Gymnasien 76 2.5 Profile der Inhaltsbereiche in den Ländern 80 2.6 Zusammenfassung und Diskussion 82 Literatur 83 3 Die Lesekompetenz im Ländervergleich 85 Barbara Drechsel und Ulrich Schiefele 3.1 Wie wird die Lesekompetenz in PISA erfasst? 86 3.2 Wie schneiden die Länder im internationalen Vergleich ab? 86 3.3 Wie ist die Lesekompetenz in den Ländern auf die Kompetenzstufen verteilt? 90 3.4 Hat sich die Lesekompetenz in den Ländern zwischen PISA 2000 und PISA 2003 verändert? 93 3.5 Ergebnisse für Teilpopulationen 94 3.5.1 Wie unterscheidet sich die Lesekompetenz von Schülerinnen und Schülern mit und ohne Migrationshintergrund in den Ländern? 94 3.5.2 Wie unterscheiden sich Leseleistungen an den Gymnasien der Länder? 97 3.6 Zusammenfassung und Diskussion 99 Literatur 101 4 Naturwissenschaftliche Grundbildung im Ländervergleich 103 Jürgen Rost, Martin Senkbeil, Oliver Walter, Claus H. Carstensen und Manfred Prenzel 4.1 Konzeption des internationalen Naturwissenschaftstests 103 4.2 Die Länder Deutschlands im internationalen Vergleich 105 4.3 Veränderungen in der naturwissenschaftlichen Grundbildung zwischen PISA 2000 und PISA 2003 110 4.4 Vergleich der naturwissenschaftlichen Kompetenz für ausgewählte Subpopulationen 113 4.4.1 Naturwissenschaftliche Grundbildung von Schülerinnen und Schülern mit Migrationshintergrund1 13 4.4.2 Vergleich der Länder hinsichtlich der naturwissenschaftlichen Kompetenz im Gymnasium 117 4.4.3 Geschlechterdifferenzen in der naturwissenschaftlichen Kompetenz 120 4.5 Zusammenfassung und Diskussion 121 Literatur 123 5 Die Problemlösekompetenz in den Ländern der Bundesrepublik Deutschland 125 Detlev Leutner, Eckhard Klieme, Katja Meyer und Joachim Wirth 5.1 Problemlösen als fächerübergreifende Kompetenz 125 5.2 Die Länder der Bundesrepublik im inter- und intranationalen Vergleich 126 5.3 Vergleich der Problemlösekompetenz für ausgewählte Subpopuladonen 131 5.3.1 Problemlösekompetenz von Schülerinnen und Schülern mit und ohne Migrationshintergrund 131 5.3.2 Problemlösekompetenz von Schülerinnen und Schülern an Gymnasien 135 5.3.3 Geschlechterdifferenzen in der Problemlösekompetenz 138 5.4 Vergleich von Problemlösekompetenz und mathematischer Kompetenz 139 5.5 Zusammenfassung und Diskussion 143 Literatur 145 6 Schülermerkmale im Ländervergleich 147 Reinhard Pekrun, Anne C. Frenzel, Karin Zimmer und Stephanie Liehtenfeld 6.1 Selbstvertrauen, Engagement und Lernverhalten im Fach Mathematik 147 6.1.1 Variablen und ihre Erfassung 148 6.1.2 Selbstvertrauen 149 6.1.3 Emotionales und motivadonales Engagement 151 6.1.4 Lern verhalten: Kognitive und metakognitive Strategien 153 6.1.5 Länderunterschiede in PISA 2000 und PISA 2003: Gibt es Veränderungen? 154 6.1.6 Schlussfolgerungen 154 Literatur 155 7 Die schulische Computernutzung in den Ländern und ihre Wirkungen 157 Martin Senkbeil 7.1 Computerbildung von Jugendlichen und Aufgaben der Schule 157 7.2 Der Einfluss der schulischen Computernutzung auf die computerbezogene Selbstwirksamkeit von Jugendlichen 158 7.3 Die Wirksamkeit der schulischen Computernutzung im internationalen Vergleich 163 7.4 Zusammenfassung und Diskussion 165 Literatur 166 8 Der Blick in die Länder 169 Manfred Prenzel, Karin Zimmer, Barbara Drechsel, Heike Heidemeier und Clemens Draxler 8.1 Vergleiche innerhalb und zwischen Ländern 169 8.2 Baden-Württemberg 172 8.3 Bayern 175 8.4 Berlin 179 8.5 Brandenburg 183 8.6 Bremen 187 8.7 Hamburg 191 8.8 Hessen 195 8.9 Mecklenburg-Vorpommern 199 8.10 Niedersachsen 202 8.11 Nordrhein-Westfalen 206 8.12 Rheinland-Pfalz 210 8.13 Saarland 214 8.14 Sachsen 218 8.15 Sachsen-Anhalt 221 8.16 Schleswig-Holstein 225 8.17 Thüringen 229 8.18 Ein abschließender Blick über die Länder 232 Literatur 233 9 Soziale Herkunft im Ländervergleich 235 Timo Ehmke, Thilo Siegle und Fanny Hohensee 9.1 Soziale Herkunft, Kompetenzniveau und Bildungsbeteiligung 235 9.2 Familiäre Lebensverhältnisse in den Ländern 236 9.2.1 Allgemeine Strukturmerkmale von Familien 237 9.2.2 Sozioökonomischer Status 239 9.2.3 Erwerbstätigkeit 241 9.2.4 Bildungsabschluss und kulturelle Ressourcen 244 9.2.5 Zusammenfassung der Befunde 249 9.3 Der ökonomische, soziale und kulturelle Status in den Ländern 250 9.4 Zusammenhang von sozialer Herkunft und Kompetenz 252 9.5 Soziale Herkunft und Bildungsbeteiligung 258 9.5.1 Gymnasiale Bildungsbeteiligung in den Ländern 260 9.5.2 Relative Wahrscheinlichkeit des Gymnasialbesuchs 261 9.6 Zusammenfassung und Diskussion 263 Literatur 265 10 Soziokulturelle Herkunft und Migration im Ländervergleich 269 Gesa Ramm, Oliver Walter, Heike Heidemeier und Manfred Prenzel 10.1 Herausforderung Migration 269 10.2 Soziokulturelle Herkunft und Sprachgebrauch 271 10.2.1 Zur Herkunft der Jugendlichen und ihrer Eltern 272 10.2.2 Zur Verwendung der deutschen Sprache 276 10.3 Kompetenzen von Jugendlichen mit Migrationshintergrund in den Ländern 280 10.3.1 Mathematische Kompetenz und Herkunft 281 10.3.2 Mathematische Kompetenz, Lesekompetenz und Sprachgebrauch 283 10.4 Der sozioökonomische und soziokulturelle Status von Migrantenfamilien 287 10.5 Befunde zu den beiden größten Herkunftsgruppen 291 10.5.1 Aus der ehemaligen Sowjetunion zugewanderte Jugendliche 292 10.5.2 In Deutschland geborene Jugendliche mit Eltern aus der Türkei 293 10.6 Zusammenfassung und Diskussion 294 Literatur 297 11 Schulmerkmale und Schultypen im Vergleich der Länder 299 Martin Senkbeil 11.1 Wie werden Schulmerkmale in PISA erfasst? 299 11.2 Welche Schultypen lassen sich differenzieren? 301 1 1.3 Wie verteilen sich die Schultypen auf die Schularten und Länder der Bundesrepublik? 309 11.3.1 Welche Zusammenhänge bestehen zwischen Schultypus und Schulart? 309 11.3.2 Die Verteilung der Schultypen auf die Länder der Bundesrepublik 311 11.3.3 Die Verteilung der Schultypen unter den Gymnasien der Länder der Bundesrepublik 313 11.4 Inwieweit stimmen die Schultypen mit den Einschätzungen der Lehrkräfte und der Schülerschaft überein? 315 11.5 Zusammenfassung und Diskussion 318 Literatur 320 12 Wirtschaftliche, soziale und kulturelle Lebensverhältnisse und regionale Disparitäten des Kompetenzerwerbs 323 Jürgen Baumert, Claus H. Carstensen und Thilo Siegle 12.1 Alltagserfahrungen und regionalstatistische Evidenz 323 12.2 Regionale Kontexte als Sozialisationsmilieus: Forschungsstand 326 1 2.3 Merkmale familialer Herkunft, wirtschaftliche, soziale und kulturelle Umgebungen von Schulen und regionale Leistungsunterschiede in PISA 2003: Theoretischer Rahmen der Untersuchung 330 12.4 Stichprobe und technisches Vorgehen 336 12.5 Deskriptive Ergebnisse 338 12.6 Individuelle und familiale Voraussetzungen sowie institutionelle und regionale Rahmenbedingungen und der Erwerb von mathematischen Kompetenzen 341 12.6.1 Individuelle und familiale Voraussetzungen und der Erwerb von mathematischen Kompetenzen 341 12.6.2 Demographische, wirtschaftliche, soziale und ethnisch-kultutelle Rahmenbedingungen der Arbeit von Schulen und der Erwerb von mathematischen Kompetenzen 344 12.7 Wechselwirkungen zwischen sozialen Kontexten und familialen Merkmalen 350 12.8 Regionale Disparitäten des Kompetenzerwerbs — ein Ergebnis individueller Verteilungsunterschiede und regionaler Strukturdifferenzen? 351 12.9 Zusammenfassung 358 Literatur 362 13 Ein Fazit des Ländervergleichs: Ausgangslagen, Stärken und Herausforderungen 367 Manfred Prenzel und Claus H. Carstensen 13.1 Kompetenzvergleiche bei unterschiedlichen Ausgangslagen: Adjustierung nach sozialer Herkunft und Migration 368 13.1.1 Adjustierte Vergleiche 369 13.1.2 Adjustierter Vergleich der Mathematikkompetenz 370 13.1.3 Die Adjustierung im Detail 371 13.1.4 Adjustierung für vier Kompetenzen 373 13.1.5 Fazit 374 13.2 Kompetenzergebnisse im Überblick: Stärken und Entwicklungen 375 13.2.1 Kompetenzprofile 375 13.2.2 Veränderungen und Entwicklungen 377 13.3 Wichtige Erkenntnisse aus dem Ländervergleich: Fortschritte und Herausforderungen 379 Literatur 383 14 Technische Grundlagen des Ländervergleichs 385 Claus H. Carstensen, Steffen Knoll, Thilo Siegle, Jürgen Rost und Manfred Prenzel 14.1 Die Repräsentativität von PISA-E 2003 385 14.1.1 Stichprobenziehung PISA-E 386 14.1.2 Die realisierte Stichprobe 390 14.1.3 Gewichtung 391 14.2 Messwerte für den Ländervergleich 2003 395 14.2.1 Hintergrundmodell PISA-E 395 14.2.2 Skalierung für PISA-E 396 14.2.3 Das Verbinden der Ergebnisse aus PISA 2003 und PISA 2000 397 14.3 In PISA verwendete Verfahren zur Datenanalyse — Glossar 398 Literatur 401 Anhang 403 Abbildungs- und Tabellenverzeichnis 407 Abkürzungsverzeichnis 415 |
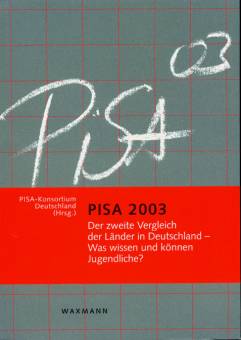
 Bei Amazon kaufen
Bei Amazon kaufen