|
|
|
Umschlagtext
Mit PISA hat die OECD neue Maßstäbe für internationale Bildungsvergleiche gesetzt. Das "Programme for International Student Assessment" untersucht, wie gut fünfzehnjährige Schülerinnen und Schüler auf die Anforderungen der Wissensgesellschaft und auf lebenslanges Lernen vorbereitet sind. Die Ergebnisse in den Schlüsselbereichen Lesekompetenz, mathematische und naturwissenschaftliche Grundbildung sowie Problemlösen lassen Rückschlüsse über Stärken und Schwächen der Bildungssysteme in den teilnehmenden Ländern zu. Da PISA in Abständen von drei Jahren durchgeführt wird, erhalten die Länder wichtige Informationen über Veränderungen der Qualität ihrer Bildungsergebnisse.
Dieser Band berichtet, wie Deutschland in der zweiten Erhebungswelle – PISA 2003 – abgeschnitten hat. Er präsentiert und diskutiert die Befunde über Kompetenzen deutscher Schülerinnen und Schüler im internationalen Vergleich. Es werden familiäre wie schulische Entwicklungsbedingungen beschrieben und die Chancen junger Menschen analysiert, ihre Potentiale auszuschöpfen und ihre Kompetenzen zu entwickeln. Der Bericht stellt dar, wie sich die Situation in Deutschland seit der ersten PISA-Erhebung im Jahr 2000 verändert hat. Das PISA-Konsortium Deutschland: Das PISA-Konsortium Deutschland: Prof. Dr. Manfred Prenzel, Leibniz-Institut für die Pädagogik der Naturwissenschaften, Kiel (Sprecher) Prof. Dr. Jürgen Baumert, Max-Planck-Institut für Bildungsforschung, Berlin Prof. Dr. Werner Blum, Universität Kassel Prof. Dr. Dr. Rainer Lehmann, Humboldt-Universität zu Berlin Prof. Dr. Detlev Leutner, Universität Duisburg-Essen Prof. Dr. Michael Neubrand, Carl von Ossietzky Universität Oldenburg Prof. Dr. Reinhard Pekrun, Ludwig-Maximilians-Universität München Prof. Dr. Hans-Günter Rolff, Institut für Schulentwicklungsforschung, Universität Dortmund Prof. Dr. Jürgen Rost, Leibniz-Institut für die Pädagogik der Naturwissenschaften, Kiel Prof. Dr. Ulrich Schiefele, Universität Bielefeld Rezension
PISA ist in aller Munde. Die Medien haben die Ergebnisse des internationalen Bildungsvergleichs in allen Details ausgeschlachtet. Leider wurden dabei auch nur Oberflächenergebnisse vermittelt. Wer die genauen Ergebnisse einsehen will, kann dies mit im vorliegenden Band. Der Bericht stellt detailiert dar, wie sich die Bildungslage in Deutschland seit der letzten Erhebung (2000) verändert hat. Dabei ist sicher der Vergleich mit anderen Ländern von Interesse, doch wichtiger ist die Ursachenforschung. Warum haben deutsche Schülerinnen und Schüler große Lücken bei manchen Kompetenzen? Hierbei ist das vorliegende Buch sehr hilfreich und sollte daher vor allem für Bildungspolitiker und Lehrer unverzichtbar sein. Denn wirklich mitreden kann man nur, wenn man nicht nur Sekundärliteratur zur eigenen Meinungsbildung und Argumentation benutzt.
Arthur Thömmes, lehrerbibliothek.de Inhaltsverzeichnis
Vorwort
PISA 2003 - eine Einführung Mafifred Prenzel, Barbara Drechsel, Claus H. Carstensen und Gesa Ramm 1.1 Die Erhebung 1.2 Der theoretische Rahmen: Kompetenzbereiche und Hintergrundmerkmale 1.3 Nationale Ergänzungen und Erweiterungen 1.4 Anlage der Untersuchung 1.4.1 Untersuchungspopulation und Ziehung der Stichprobe 1.4.2 lest- und Fragebogenentwicklung sowie Testdesign 1.4.3 Durchführung der Erhebung in Deutschland 1.4.4 Auswertung und Skalierung 1.4.5 Berichterstattung und Darstellung 1.5 Von PISA 2000 nach PISA 2003: Belastbare Aussagen über Veränderungen 1.6 PISA - ein kooperatives Unternehmen41 1.7 Überblick über den Berichtsband „PISA 2003 - Der Bildungsstand der Jugendlichen in Deutschland— Ergebnisse des zweiten internationalen Vergleichs" Literatur 2 Mathematische Kompetenz Werner Blum, Michael Neubrand, limo Ehmke, Martin Senkbeil, Alexander Jordan, Frauke Ulfig und Claus H. Carstensen 2.1 Der internationale PISA-Test 2.1.1 Das Konzept Mathematical Literacy 2.1.2 Konzeption des internationalen Tests 2.1.3 Aufgabenbeispiele 2.1.4 Kompetenzstufen 2.2 Der nationale Ergänzungstest 2.2.1 Mathematische Grundbildung und Typen mathematischen Arbeitens 2.2.2 Aufbau des nationalen Mathematiktests 2.2.3 Beispiele aus dem nationalen Ergänzungstest in Mathematik 2.2.4 Messwerte des nationalen Tests und Beziehungen zum internationalen Test 2.3 Zur curricularcn Validität des PISA-Tests 2.4 Ergebnisse des nationalen Ergänzungstests 2.5 Mathematische Kompetenz im internationalen Vergleich 2.5.1 Ergebnisse des internationalen Vergleichs auf der Gesamtskala 2.5.2 Verteilungen auf die Kompetenzstufen 2.5.3 Ergebnisse in den Inhaltsbereichen (Übergreifende Ideen) 2.5.4 Unterschiede zwischen Jungen und Mädchen in der mathematischen Kompetenz 2.6 Veränderungen in der mathematischen Kompetenz zwischen PISA 2000 und PISA 2003 2.6.1 Veränderungen im internationalen Vergleich 2.6.2 Veränderungen innerhalb Deutschlands 2.7 Zusammenfassung und Diskussion Literatur 3 Lesekompetenz Ellen Schaffner, Ulrich Schiefele, Barbara Drechsel und Cordula Artelt 3.1 Lesekompetenz in PISA: Die Testkonzeption 3.1.1 Die Konstruktionskriterien und die Auswertung des Tests 3.1.2 Stufen der Lesekompetenz 3.2 Ergebnisse des internationalen Vergleichs 3.3 Unterschiede zwischen den Schulformen in Deutschland 3.4 Unterschiede in der Lesekompetenz zwischen PISA 2000 und PISA 2003 3.5 Zusammenfassung und Diskussion Literatur 4 Naturwissenschaftliche Kompetenz Jürgen Rost, Oliver Walter, Claus H. Carstensen, Martin Senkbeil und Manfred Prenzel 4.1 Die Kompetenz der Schülerinnen und Schüler im internationalen Vergleich 4.1.1 Der internationale Naturwissenschaftstest 4.1.2 Ergebnisse des internationalen Tests 4.2 Eine differenzierte Analyse der naturwissenschaftlichen Kompetenz1 4.2.1 Die Konzeption des nationalen Naturwissenschaftstests 4.2.2 Die Messwerte des nationalen Naturwissenschaftstests 4.3 Curriculare Validität der Naturwissenschaftsaufgaben 4.4 Kompetenzunterschiede zwischen Schulformen und Geschlechtern 4.4.1 Die Kompetenzverteilungen in den Schulformen 4.4.2 Die Kompetenzverteilungen von Jungen und Mädchen 4.5 Zusammenfassung und Diskussion Literatur 5 Problemlösen Detlev Leutner, Eckhard Klieme, Katja Meyer und Joachim Wirth 5.1 Das Konzept des fächerübergreifenden Problemlösens in PISA 5.2 Der internationale Test: Analytisches Problemlösen 5.2.1 Konzeption des analytischen Problemlösens und Kompetenzstufen 5.2.2 Die Testaufgaben des internationalen Tests 5.2.3 Analytisches Problemlösen im internationalen Vergleich 5.2.4 Analytische Problemlösekompetenz deutscher Schülerinnen und Schüler in den Schulformen 5.3 Der nationale Test: Dynamisches Problemlösen 5.3.1 Konzeption des dynamischen Problemlösens und seiner computergestützten Erfassung 5.3.2 Die Testaufgaben des nationalen Tests 5.3.3 Dynamische Problemlösekompetenz deutscher Schülerinnen und Schüler in den Schulformen 5.4 Struktur der Tests zur Problemlösekompetenz und deren Beziehungen zu anderen Kompetenzmaßen 5.5 Zusammenfassung und Diskussion Literatur 6 Vertrautheit mit dem Computer Martin Senkbeil und Barbara Drechsel 6.1 Computervertrautheit im internationalen Vergleich 6.1.1 Wie erfahren sind Fünfzehnjährige im Umgang mit neuen Medien? 6.1.2 Welchen Stellenwert besitzt die Schule für den Erwerb computerbezogener Kenntnisse? 6.2 Computerbezogene Nutzung und Kenntnisse in Deutschland 6.2.1 Welche Arten der Computernutzung lassen sich differenzieren? 6.2.2 Welcher Zusammenhang besteht zwischen der Computernutzung und der computerbezogenen Kompetenz? 6.2.3 Wie unterscheiden sich Jungen und Mädchen in der Computernutzung und im Computerwissen? 6.2.4 Wie hängt der Ort des Erwerbs computerbezogener Kenntnisse mit Computernutzung und Computerkompetenz zusammen? 6.3 Zusammenfassung und Diskussion Literatur 7 Schülermerkmale im Fach Mathematik Reinhard Pekrun und Anne Zirngibl 7.1 Theoretischer Hintergrund 7.1.1 Selbstvertrauen in Mathematik: Selbstkonzept und Selbstwirksamkeit 7.1.2 Emotionales und motivationales Engagement in Mathematik 7.1.3 Lemverhalten und Selbstregulation in Mathematik 7.1.4 Wechselwirkungen zwischen Schülermerkmalen und Kompetenzen 7.2 Erfassung und Vergleich von Schülermerkmalen bei PISA 2003 7.3 Befunde zum Selbstvertrauen 7.4 Emotionales und motivationales Engagement 7.5 Lernverhalten und Selbstregulation 7.6 Fazit: Merkmalsprofile deutscher Schülerinnen und Schüler im Fach Mathematik Literatur 8 Kompetenzen von jungen und Mädchen Karin Zimmer, Desiree Burba und Jürgen Rost 8.1 Einfuhrung 8.2 Internationaler Vergleich: Geschlechtsspezifische Kompetenzmuster 8.3 Wenig kompetente und kompetenzstarke Jungen und Mädchen 8.3.1 Risikoschülerinnen und -schaler 8.3.2 Kompetenzstarke Jungen und Mädchen 8.4 Zusammenhang zwischen dem Kompetenzniveau und den Selbsteinschätzungen im Bereich Mathematik 8.5 Zusammenfassung und Diskussion Literatur 9 Soziale Herkunft 9.1 Familiäre Lebensverhältnisse, Bildungsbeteiligung und Kompetenzerwerb225 Timo Ehmke, Fanny Hohensee, Heike Heidemeier und Manfred Prenzel 9.1.1 Einleitung 9.1.2 Familiäre Lebensverhältnisse im internationalen Vergleich 9.1.3 Die soziale Herkunft leistungsschwacher und leistungsstarker Schülerinnen und Schüler 9.1.4 Der Index des ökonomischen, sozialen und kulturellen Status 9.1.5 Mathematik im Elternhaus aus nationaler Perspektive 9.1.6 Soziale Herkunft und Bildungsbeteiligung 9.1.7 Die Kopplung von sozialer Herkunft und Kompetenzerwerb im internationalen Vergleich 9.1.8 Zusammenf assung 9.2 Soziokulturelle Herkunft: Migration Gesa Ramm, Manfred Prenzel, Heike Heidemeier und Oliver Walter 9.2.1 Was versteht PISA unter Migrationshintergrund? 9.2.2 Jugendliche mit Migrationshintergrund im internationalen Vergleich 9.2.3 Jugendliche mit Migrationshintergrund m Deutschland 9.2.4 Vergleich Deutschland, Schweiz und Österreich 9.2.5 Effekte sprachlastiger Testaufgaben 9.2.6 Zusammenfassung 9.3 Soziale Herkunft und mathematische Kompetenz Manfed Prenzel, Heike Heidemeier, Gesa Ramm, Fanny Hohensee und Timo Ehrnke Literatur 10 Schule und Unterricht 10.1 Institutionelle und organisatorische Rahmenbedingungen von Schule und Unterricht Barbara Drechsel und Martin Senkbeil 10.2 Kompetenzunterschiede zwischen Schulen Manfed Prenzel, Martin Senkbeil und Barbara Drechsel 10.3 Merkmale und Wahrnehmungen von Schule und Unterricht Martin Senkbeil, Barbara Drechsel, Hans-Günter Rolff, Martin Bonsen, Karin Zimmer, Rainer H. Lehmann und Astrid Neumann 10.3.1 Schule und Unterricht im internationalen Vergleich 10.3.2 Merkmale von Schulen nach Schulform 10.3.3 Zusammenfassung und Diskussion 10.4 Mathematikunterricht aus Sicht der PISA-Schülerinncn und -Schüler und ihrer Lehrkräfte Jürgen Baumert, Mareike Kunter, Martin Brunner, Stefan Krauss, Werner Blum und Michael Neubrand 10.4.1 Auf der Suche nach gutem Unterricht 1 0.4.2 Wie kann man Unterrichtsqualität empirisch erfassen? 10.4.3 Untersuchungsinstrumente und methodisches Vorgehen 10.4.4 Rekonstruktion des Mathematikunterrichts aus Lchrkräftesicht 10.4.5 Schülerinnen und Schüler als Experten - Mathematikunterricht aus Schülersicht 10.4.6 Gegenüberstellung der Sichtweisen 10.4.7 Diskussion Literatur 11 Von PISA 2000 zu PISA 2003 Manfred Prenzel, Claus H. Carstensen und Karin Zimmer 11.1 Zur Vergleichbarkeit der Ergebnisse beider Studien 11.2 Ein Blick in Schulen und Unterricht 11.3 Veränderungen in den Kompetenzen 11.4 Der Zusammenhang von sozialer Herkunft und Kompetenz 11.5 Wichtige Erkenntnisse aus PISA 2003 Literatur 12 Technische Grundlagen Claus H. Carstensen, Steffen Knoll, Jürgen Rost und Manfred Prenzel 12.1 Die Repräsentativität von PISA 12.1.1 Stichprobenziehung 12.1.2 Realisierte Stichprobe 12.1.3 Gewichtung 12.2 Wahre Zusammenhänge - Die Berechnung der Messwerte von PISA377 12.2.1 Multi-Matrix-Design und IRT-Skalicrung 12.2.2 Latente Zusammenhänge und Hintergrundmodelle 12.2.3 In PISA 2003 modellierte und analysierbare Zusammenhänge 12.3 Die Genauigkeit von PISA 12.3.1 Die Berechnung von Stichprobenfehlern 12.3.2 Die Messgenauigkeit der Skalenwerte Literatur Anhang A Anhang B Abbildungsverzeichnis Tabellenverzeichnis Abkürzungsverzeichnis |
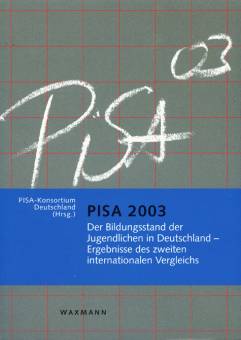
 Bei Amazon kaufen
Bei Amazon kaufen