|
|
|
Umschlagtext
Der neue Weg des "Phonetischen Schreibens" hat seinen Ausgangspunkt bei der mündlichen Sprache und bei der Gedankenwelt des Kindes.
Schwerpunkte des Bandes: - Unterschiede der Konzeption "Phonetisches Schreiben" von herkömmlichen Verfahren - Welche Rolle spielt die Lehrkraft bei diesem Lernprozess? - Welche Schreibanlässe bieten sich für den Unterricht an? - Strukturierung und Organisation des 1. Schuljahres - Elternarbeit - Erfahrungen aus den Versuchsschulen - Materialien * Lauttabellen * Kopiervorlagen für die Erstellung von Arbeitsmaterialien * Sortierter Grundwortschatz für die Jahrgangsstufen 1 und 2 Rezension
Diese Dokumentation über den von 1997 - 2001 durchgeführten Schulversuch ist sehr praxisnah gehalten und dokumentiert vor allem die pädagogische Arbeit an den jeweiligen Versuchsschulen. Nach einer kurzen aber prägnanten theoretischen Einführung, worin u.a. die Gründe für alternative Wege im Schriftspracherwerb, neueste Erkenntnisse der Phonetik und - sehr anschaulich anhand von Beispielen - die Stufen im Lese- und Schreiblernprozess dargelegt werden, die als Grundlage für die Konzeption des Schulversuchs dienten, wird der größte Raum für die Beschreibung der unterrichtspraktischen Umsetzung in den Versuchsschulen reserviert. Hier wird, immer wieder durch anschauliche Beispiele und Praxiserfahrungen ergänzt, sehr ausführlich und gut verständlich auf alle Aspekte der Konzeption eingegangen. Dazu gibt es sehr nützliche Praxishilfen wie z.B. zur Einführung der Lauttabelle, zum ersten Elternabend, zur Leistungsbeurteilung, Beispiele für Beobachtungsbögen und verschiedenste Kopiervorlagen. Den Abschluss bildet ein ausführliches Grundwortschatz-Register, gegliedert nach lauttreuen, phonologisch und orthographisch verschriftbaren Wörtern.
Insgesamt eine sehr interessante Lektüre, die keine Fragen offen lässt und besonders wertvoll für Lehrkräfte sein dürfte, die schon länger im Beruf stehen und sich mit den neuesten Entwicklungen im Schriftspracherwerb vertraut machen möchten. B. Lensch, lehrerbibliothek.de Verlagsinfo
Der neue Weg des "Phonetischen Schreibens" hat seinen Ausgangspunkt bei der mündlichen Sprache und bei der Gedankenwelt des Kindes. Diese alternative Methode beginnt mit der Verschriftung der mündlichen Sprache des Kindes mit Hilfe einer Lauttabelle. Damit werden die Unterschiede zur Schriftsprache der Erwachsenen verdeutlicht mit dem Ziel, dass die Kinder diese schrittweise erwerben. In dieser Handreichung wird die Konzeption des Schulversuchs an ausgewählten Grundschulen differenziert beschrieben. Sie vermittelt Ihnen, wie Sie diesen Weg zum Schriftspracherwerb methodisch richtig und Erfolg versprechend mit Ihren Kindern beschreiten können. Inhaltsverzeichnis
Vorwort (6)
1 Warum sind alternative Wege im Anfangsunterricht notwendig? (8) 1.1 Ausgangslage für den Schulversuch (8) 1.2 Studie der OECD (8) 1.3 Erkenntnisse aus der Schriftspracherwerbsforschung (8) 1.4 Erkenntnisse aus der Legasthenieforschung (10) 1.5 Zielstellungen des Schulversuchs (10) 1.6 Berücksichtigung der neuen Erkenntnisse im Lehrplan 2000 für die Grundschule (11) 2 Wodurch unterscheidet sich die Konzeption des Schulversuchs von herkömmlichen Verfahren? (12) 2.1 Gegenüberstellung von Schulversuch und konventionellem Fibelunterricht unter Berücksichtigung des unterschiedlichen Ausgangspunktes (Sprache - Schrift) (12) 2.1.1 Phonetisches Schreiben als Entwicklungsstufe beim Schriftspracherwerb (12) 2.1.2 Ausgangspunkt: Gedankenwelt und mündliche Sprache des Kindes (13) 2.1.3 Abhängigkeit von Lesen und Schreiben beim Schriftspracherwerb (13) 2.2 Die Konzeption des Schulversuchs (15) 2.2.1 Lesenlernen durch Schreiben (15) 2.2.2 Arbeit mit verschiedenen Lauttabellen (15) 2.2.3 Freies Schreiben (16) 2.2.4 Systematisierung des Grundwortschatzes für den Rechtschreibunterricht (17) 2.2.5 Gestaltung des Unterrichts (17) 2.3 Grundsätzliche Überlegungen aus der Sicht der Phonetik zum Einsatz schriftsprachlicher Unterrichtsmittel zu Beginn des ersten Grundschuljahres (17) 3 Wie lernen Kinder lesen und schreiben? (20) 3.1 Das neue Verständnis von Lernen (20) 3.2 Entwicklungsmodell zum Lesen- und Schreibenlernen (21) 3.3 Beobachtungen der Lehrkräfte zu den Entwicklungsstufen (25) 3.4 Beobachtungen der Lehrkräfte zum Leselernprozess (26) 4 Welche Rolle spielt die Lehrkraft bei diesem Lernprozess? (27) 4.1 Die Lehrkraft sollte bereit sein, ihren traditionellen Standpunkt zu überdenken. (27) 4.2 Die Lehrkraft muss die neuen Forschungsergebnisse über die Entwicklungsstufen im Schriftspracherwerb der Kinder kennen. (27) 4.3 Die Lehrkraft soll Lernprozesse strukturieren, initiieren und begleiten. (28) 4.4 Die Lehrkraft muss den individuellen Entwicklungsstand beobachten und analysieren. (28) 4.5 Die Lehrkraft sollte in der Lage sein, den Schülern anhand ihrer Schreibprodukte individuelle Hilfestellung anzubieten. (29) 4.6 Die Lehrkraft muss offene Unterrichsstrukturen ermöglichen und ein anregendes Lernklima schaffen. (31) 4.7 Die Lehrkraft sollte zur Zusammenarbeit im kollegialen Kreis bereit sein. (32) 5 Wie begleitet der Lehrer die Schriftsprachentwicklung im Unterricht? (34) 5.1 Schulung phonologischer Bewusstheit als Basis für sichere Lese- und Rechtschreibleistungen (34) 5.1.1 Phonologische Bewusstheit im weiteren Sinn bezieht sich auf den sprechrhythmischen Bereich (34) 5.1.2 Phonologische Bewusstheit im engeren Sinn bezieht sich gezielt auf die einzelnen Phoneme (36) 5.1.3 Durchführung des Trainingsprogramms im ersten Schuljahr (37) 5.2 Die phonetische Stufe (38) 5.3 Die phonologische Stufe (51) 5.3.1 Die phonologischen Regelhaftigkeiten (51) 5.3.2 Möglichkeiten der Erarbeitung (52) 5.4 Die orthografische Stufe (54) 5.4.1 Die orthografischen Laute der Tabelle (55) 5.4.2 Einführung des Begriffes Merkwort (55) 5.4.3 Die Wörter des Grundwortschatzes eingeteilt in Ähnlichkeitsklassen (55) 5.4.4 Wortspezifisches Lernen (65) 5.4.5 Individuelle Überarbeitung der Schülertexte (70) 5.4.6 Nachschlagtechnik - Arbeit mit Wörterlisten und einem Wörterbuch (72) 5.4.7 Arbeit mit dem Karteikasten (73) 6 Welche Schreibanlässe bieten sich für den Unterricht an? (78) 6.1 Was fordert der Lehrplan 2000 im Bereich "Für sich und andere schreiben"? (78) 6.2 Schreibsituationen im Unterricht (84) 6.2.1 Gezielte Schreibaufgaben (84) 6.2.2 Offene Schreibanlässe (85) 6.3 Der Umgang mit den Schreibprodukten - die Korrektur (90) 7 Strukturierung und Organisation des 1. Schuljahres (92) 7.1 Gliederung des Schuljahres (92) 7.2 Erstellung des Klassenlehrplans und Wochenplans (94) 7.3 Lernbeobachtung und Leistungsfeststellung (95) 7.3.1 Lernzielkontrollen (95) 7.3.2 Schülerbeobachtungen (98) 7.3.3 Das Erstellen von Zeugnissen (100) 8 Elternarbeit (103) 8.1 Notwendige Informationen (103) 8.2 Beispiel für die Gestaltung des Elternabends (104) 8.2.1 Ablauf (104) 8.2.2 Materialien für die Gestaltung (105) 8.3 Beitrag der Eltern (108) 9 Erfahrungen aus den Versuchsschulen (110) 9.1 Erfahrungen in Klassen mit überwiegend ausländischen Kindern (110) 9.2 Ergebnisse einer Befragung der Lehrkräfte an den Versuchsschulen (111) 9.2.1 Aussagen zur Methode allgemein (111) 9.2.2 Aussagen zum Leselernprozess (113) 9.2.3 Aussagen zur Individualisierung und Differenzierung (116) 9.2.4 Aussagen zum Schreiblernprozess (118) 9.2.5 Aussagen zum Elternstandpunkt (120) 9.2.6 Abschließende Stellungnahme der Lehrkräfte (121) 9.3 Schüleräußerungen - So habe ich lesen und schreiben gelernt (122) 9.4 Weiterarbeit in den Jahrgansstufen 3 und 4 mit Bezug zum Lehrplan 2000 "Für sich und andere schreiben" (122) Literaturhinweise (125) Anhang (127) Lauttabellen des Schulversuchs (128) Kopiervorlagen zur Erstellung von Arbeitsmaterialien (131) Sortierter Grundwortschatz für die Jahrgangsstufen 1 und 2 (154) Versuchsschulen (162) Mitarbeiter im Arbeitskreis und Erstellung der Handreichung (163) |
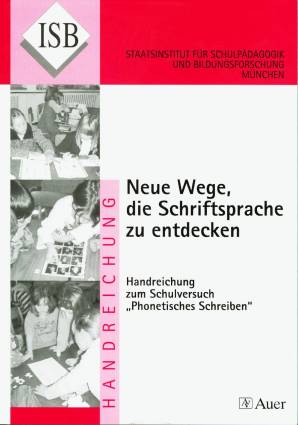
 Bei Amazon kaufen
Bei Amazon kaufen