|
|
|
Umschlagtext
Die "Trümmerfrau" gehört zum festen Repertoire nahezu jeder historischen Darstellung der Nachkriegszeit, ganz gleich, ob in TV- und Printmedien, in Schulbüchern oder in Ausstellungen der historischen Museen. Seit Anfang der 1950er Jahre bis in unsere unmittelbare Gegenwart kam es darüber hinaus in den unterschiedlichsten Städten immer wieder zur Errichtung von "Trümmerfrauen"-Denkmälern.
Leonie Treber hat erstmals die überlieferten Fakten geprüft und kommt zu dem Ergebnis, dass die "Trümmerfrauen" ein Mythos sind; es gibt nur ganz wenige Belege dafür, dass tatsächlich Frauen im Krieg und in der Nachkriegszeit Bombentrümmer beseitigt haben. Wie für Mythen gemeinhin üblich, handelt es sich bei den heute verbreiteten stereotypen "Trümmerfrauen"-Narrativen jedoch keineswegs um reine Lügen, vielmehr enthalten sie einige Brocken Wahrheit, die jedoch mitunter verfälscht und aus dem Kontext gerissen sind bzw. Wesentliches verschweigen. Die Autorin stellt dar, wie die Enttrümmerung der deutschen Städte tatsächlich stattgefunden hat. Meist waren professionelle Firmen mit technischem Großgerät und Fachkräften die Hauptakteure bei der Trümmerräumung. Und sie zeigt, wie der Mythos „Trümmerfrau“ mit all seinen Facetten entstanden ist. Die Grundlagen für den Mythos der "Trümmerfrau" wurden bereits in der unmittelbaren Nachkriegszeit gelegt. Eine Analyse der zeitgenössischen Presseerzeugnisse von 1945 bis 1949 legt die dabei entworfenen Bilder offen und fragt nach dem Ursprung des "Trümmerfrauen"-Begriffs. Die Traditionslinien der "Trümmerfrauen" reichen in der DDR bis ins Jahr 1945 zurück und sind seitdem niemals abgebrochen, sondern kontinuierlich gepflegt worden. Die lange und stabile Tradierung der "Trümmerfrau" in der Erinnerungskultur der DDR trug somit wesentlich dazu bei, dass sich aus den getrennten und zum Teil diametral gegenüberliegenden Erinnerungssträngen der BRD und der DDR schließlich der gesamtdeutsche Erinnerungsort der "Trümmerfrau" flechten ließ. Rezension
Die Sache erscheint plausibel: Als Deutschland im Mai 1945 kapitulierte, waren viele Städte zerbombt, und es waren die Frauen, welche als Ersatz für die gefallenen, noch nicht aus dem Krieg zurückgekehrten oder in Kriegsgefangenenschaft geratenen Männer die Aufräumarbeiten übernehmen mussten.
Doch so einfach diese Erklärung auch ist, ergibt sich nach dem Lesen des vorliegenden Buches ein deutlich vielschichtigeres Bild. Und das ist auch gut so, denn Leonie Treber hat die „Trümmerfrauen“ im Titel ihres Buches nicht umsonst als Mythos bezeichnet. Zutreffend ist der Begriff nämlich allenfalls für Berlin und die Sowjetische Besatzungszone, wo sich ein derartiger weiblicher Einsatz gut in das sozialistische Weltbild einfügte. Hinzu kommt, dass die quantitative Überlegenheit der Frauen bei der Trümmerräumung in Berlin nur für ein verhältnismäßig kurzes Zeitfenster gilt, so dass sich im zweiten Teil der Studie auch die Frage stellt, wie es die „Trümmerfrau“ dennoch geschafft hat, Teil des kollektiven Gedächtnisses in ganz Deutschland zu werden. Korrekterweise blickt Leonie Treber dabei sowohl in die DDR als auch in die BRD, da die Systemunterschiede in Ost und West durchaus markante Unterschiede im kulturellen und erinnerungspolitischen Umgang vermuten lassen. Im ersten Teil, in welchem die Vorgehensweise bei der Trümmerräumung während der Nachkriegszeit im Mittelpunkt steht, ist eine derartige systematische Betrachtungsweise weitaus schwieriger, da nicht nur Unterschiede in den vier Besatzungszonen bestanden, sondern auch – insbesondere zu Beginn – in den einzelnen Städten selbst. Dies hat letztlich zur Folge, dass die Autorin für ihre Studie elf mehr oder weniger repräsentative (Groß-)Städte auswählt, an denen sie die Herangehensweise und die beteiligten Personengruppen analysiert. Deutlich wird dabei, dass – anders als der Mythos suggestiert - viele Personengruppen an der Trümmerräumung beteiligt waren. Mit zunehmender Dauer musste zudem auf professionelle Unternehmen zurückgegriffen werden, um die Trümmer nicht nur fachgerecht zu beseitigen, sondern auch die Wege für einen Wiederaufbau offenzulassen. FAZIT: Leonie Treber "enttrümmert" mit dieser lesenswerten Veröffentlichung ihrer Dissertation die Nachkriegsgeschichte vom Mythos der "Trümmerfrauen", die heute als Inbegriff der Aufbauleistung Deutschlands nach dem Zweiten Weltkrieg stehen. Eine sehr differenziert ausgearbeitete und vorbildliche Studie, welche einen wichtigen Beitrag für das Verständnis der deutschen Nachkriegsgeschichte leistet. Matthias Schmid, lbib.de Inhaltsverzeichnis
Danksagung 9
Einleitung 11 Die Trümmer müssen weg: Enttrümmerungsmaßnahmen während des Luftkrieges und in der Nachkriegszeit 27 I. Die Trümmerbeseitigung während des Luftkrieges 28 1.Ein System wird etabliert: Der SHD und die Trümmerräumung als Sofortmaßnahme 29 2. Arbeitskraftreserven I: Wehrmacht, Hitlerjugend und Reichsarbeitsdienst 34 3. Instandsetzung statt Trümmerräumung: Die Eingliederung des Bauhandwerks 39 4. Arbeitskraftreserven II: Die Trümmerräumung wird zur Zwangsarbeit 43 4.1 Kriegsgefangene und Zivilarbeiter 44 4.2 KZ-Häftlinge 51 5. Resümee 60 II. Der Krieg ist aus: Ein Reich liegt in Trümmern 63 1. Viele Kriegsenden: Kapitulation und Beginn der Besatzungszeit in den Städten 66 2. Die Konsolidierung der deutschen Stadtverwaltungen 69 2.1 Das Beispiel Nürnberg 70 2.2 Das Beispiel Berlin 73 2.3 Pragmatismus versus Ideologie: Kontinuitäten deutscher Stadtverwaltungen 77 3. Die Trümmerräumung als städtische Herausforderung 79 III. Die Trümmerräumung in der Nachkriegszeit 82 1. Die Trümmerräumung als Strafarbeit 83 1.1 Ehemalige Parteigenossen 84 1.2 Kriegsverbrecher und Häftlinge des »Automatischen Arrests« 92 1.3 Deutsche Kriegsgefangene 96 1.4 Strafgefangene 99 2. Die Professionalisierung der Trümmerräumung 101 2.1 Das Bauhandwerk arbeitet weiter 103 2.2 Die Eingliederung der Bauunternehmen in die Arbeiten der Enttrümmerung 105 2.3 Die Konzepte: Trümmerbeseitigung versus Trümmerverwertung 112 2.4 Die Trümmerverwertungsgesellschaft in Frankfurt am Main 114 2.5 Der Beginn der planmäßigen Trümmerräumung in Dresden 120 2.6 Die Professionalisierung der Trümmerräumung in der SBZ und den drei westlichen Zonen: ein Vergleich 123 3. Die Bevölkerung als Arbeitskräftereservoir 137 3.1 Arbeitslose 139 3.2 Bürgereinsätze 157 3.3 Deutsche Staatsbürger oder wer waren eigentlich die Arbeitskräfte? 172 3.4 Arbeitslose und Bürger als (un)erschöpfliches Arbeitskräftereservoir für die Trümmerräumung: ein Systemvergleich 184 4. Resümee 197 IV. Frauen als Akteurinnen bei der Trümmerräumung 199 1. Die Zeit des Luftkrieges 199 2. Die Nachkriegszeit 202 2.1 Die Trümmerräumung als Resozialisierungsmaßnahme für »leichte Mädchen« 204 2.2 Von der arbeitslosen Frau zur Bauhilfsarbeiterin 206 2.3 Die Heranziehung von Frauen zu den Bürgereinsätzen 225 2.4 Frauen und Selbsthilfe: Die Dimension der privaten Enttrümmerung 230 3. Die Frau als Akteurin bei der Trümmerräumung: eine Frage des Systems? 234 Die Repräsentation der Trümmerräumung in den Medien der deutschen Nachkriegszeit und die Geburtsstunde de: »Trümmerfrau « 241 I. Die Deutung der Trümmerräumung in der zeitgenössischen Presse von Berlin und SBZ 245 1. Die enttrümmernde Frau wird zum Medienschlager 252 2. Der Begriff der »Trümmerfrau« 264 II. »Trümmerfrau« versus Bauunternehmen, Bagger und männliche Arbeitskraft: Die Darstellung der Trümmerräumung in der >West<-Presse 269 III. Resümee 275 Deutsch-Deutsche Erinnerungen: Die »Trümmerfrau« in den kollektiven Gedächtnissen von DDR und BRD 277 I. Die Etablierung divergierender »Trümmerfrauen«-Bilder in den 1950er Jahre 280 1. DDR 281 1.1 Die »erwerbstätige Mutter«: Frauenleitbild und Frauenpolitik in SBZ und DDR 281 1.2 Das Bild der »Trümmerfrau« in SBZ und DDR: Vorbild für die Frau im Männerberuf und Vorreiterin der Gleichberechtigung 291 1.3 Die »Trümmerfrau« in Bronze gegossen - Denkmäler in Dresden und Berlin-Ost 298 1.4 »Aufbauhelferin« versus »Trümmerfrau«: zwei weibliche Ikonen im Ringen um die Deutungshoheit über die Aufbauleistung der Frauen 304 2. BRD 308 2.1 Restauration der Mutter- und Hausfrauenrolle: Frauenbild und Frauenpolitik in der BRD 309 2.2 Das »Trümmerfrauen«-Bild in West-Berlin: Heldin des Wiederaufbaus 318 2.3 Das »Trümmerfrauen«-Bild in der BRD: Erst auf den zweiten Blick sichtbar 325 3. Resümee: Die »Trümmerfrau« im Zwiespalt 339 II. »Erbauerin des Sozialismus« und »Vorreiterin für die Gleichberechtigung der Frau«: Die Kontinuitätslinien des »Trümmerfrauen« - Bildes in der DDR 344 1. Rolle rückwärts: Von der »Aufbauhelferin« zur »Trümmerfrau« 345 2. Die Frau im Bauberuf: Von der »Trümmerfrau« zur Ingenieurin 347 3. Die politischen Gedenk- und Feiertage der DDR 351 3.1 Die »Trümmerfrau« und der Internationale Frauentag 354 3.2 1. Mai, 8. Mai und 7. Oktober: Tage der »Trümmerfrau« 358 4. Die »Trümmerfrau«: Ikone des kommunalen Gedächtnisses 369 5. Resümee 374 III. Von der »armen Schwester im Osten« zur »Grundsteinlegerin des Wirtschaftswunders«: Ein wechselhafter Erinnerungsdiskurs an die »Trümmerfrau« in der BRD 375 1. Wenig Anlass zum Feiern? Die politischen Feier- und Gedenktage in der BRD 375 1.1 Die »Trümmerfrau« in den erinnerungspolitischen Reden zum 8. Mai 379 2. Die »Trümmerfrau« in den Medien der 1960er und 1970er Jahre 383 3. Die »Trümmerfrau« wird zur bundesrepublikanischen Gedenkikone: Die 1980er Jahre 387 3.1 Frauengeschichte 388 3.2 Frauen in der Rentenversicherung der 1970er und 1980er Jahre 404 4. Resümee 415 Schluss 417 Abkürzungsverzeichnis 449 Quellen- und Literaturverzeichnis 451 Abbildungsnachweis 483 |
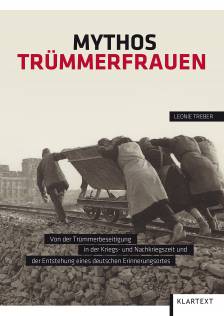
 Bei Amazon kaufen
Bei Amazon kaufen