|
|
|
Umschlagtext
Das »Metzler Lexikon Literatur- und Kulturtheorie« bietet mit mehr als 700 Artikeln einen kompakten Überblick über die Vielfalt der literatur- und kulturwissenschaftlichen Ansätze. Es erläutert die zentralen Grundbegriffe und verschafft einen Zugang zu den Theoretikern, die die Debatten geprägt haben. Für die zweite Auflage wurde das Lexikon umfassend aktualisiert und um rund 130 Artikel erweitert, die aus verschiedenen Bereichen der Literatur- und Kulturtheorie, insbesondere aus der Medientheorie und der Geschichtstheorie, stammen oder aber interdisziplinäre und inter-mediale Aspekte der Theoriebildung berücksichtigen.
Im Zentrum steht die moderne Literaturtheorie, die durch literaturgeschichtliche Überblicksartikel u.a. über Antike, Mittelalter, Renaissance, Klassizismus, Romantik und Ästhetizismus auch in ihrer historischen Entwicklung erschlossen wird. Neben textzentrierten und traditionellen Methoden wird eine Vielzahl von autoren-, leserund kontextorientierten Ansätzen in einem internationalen und interdisziplinären Zusammenhang vorgestellt. Umfassend berücksichtigt werden vor allem kultur- und medienwissenschaftliche Ansätze sowie neuere Entwicklungen wie Dekonstruktion, Diskurstheorie, feministische Theorien und Geschlechterforschung, Konstruktivismus, New Historicism, Mentalitätsgeschichte, postkoloniale Literaturkritik, Poststrukturalismus. In Form von Autorenporträts werden die wichtigsten Theoretiker/innen und ihre Werke vorgestellt (z.B. Aristoteles, Bachtin, de Man, Derrida, Foucault, Greenblatt, Iser, Jauß und Luhmann). Die von ihnen geprägten Begriffe (von Appellfunktion bis Zirkulation) werden in über 350 Sachartikeln erklärt. Fast zweihundert Wissenschaftler/innen aus dem deutschsprachigen Raum haben an diesem Lexikon mitgearbeitet. Es richtet sich an Studierende, Fachwissenschaftler/innen und Lehrende sämtlicher Philologien und Kulturwissenschaften sowie an theorieinteressierte Leser/innen benachbarter Disziplinen (insbesondere an Historiker/innen, Soziolog/innen und Psycholog/innen) . Rezension
Die "alten" Wissenschaftssparten scheinen überholt. Die Postmoderne liebt das Cross-Over. Dem trägt dieses Lexikon Rechnung. Es ist Literatur- und Kulturwissenschaft in einem. Kulturwissenschaft wird zum fächerübergreifenden Zentralbegriff, der auch die Philosphie umfaßt. -
Der Autor ist tot, - es lebe die Leser-Theorie. Der Band enthält Ansätze, Begriffe und Personen, die den kultur- und medienwissenschaftlichen Diskurs besonders der letzten Jahre geprägt haben wie Strukturalismus, Dekonstruktion, Gender-Theorie, Konstruktivismus, Diskurstheorie, New Historicism, Post-Colonialism. Hier werden schnell, tiefgründig und am Puls der Zeit die neuen -ismen erklärt. Unbedingt empfehlenswert - keineswegs nur für Germanisten! Buschmann, lehrerbibliothek.de Verlagsinfo
Das "Metzler Lexikon Literatur- und Kulturtheorie" bietet in über 700 Artikeln einen kompakten Überblick über die Vielfalt der literatur- und kulturwissenschaftlichen Ansätze. Es erklärt die zentralen Grundbegriffe und stellt die wichtigsten Theoretiker/innen vor. Autoreninformation: Ansgar Nünning, geb. 1959, lehrte von 1985 bis 1996 an der Universität zu Köln; seit 1997 Professor für Englische und Amerikanische Literatur- und Kulturwissenschaft an der Justus-Liebig-Universität Gießen; zahlreiche Veröffentlichungen, vor allem zur englischen Literatur des 17. bis 20. Jahrhunderts sowie zu literatur- und kulturtheoretischen Ansätzen (u.a. Narratologie, New Historicism, Gender Studies, Mentalitätsgeschichte, komparatistische Imagologie, radikaler Konstruktivismus). Pressestimmen: "Dieses Lexikon ist eine nützliche Sache, eine Studienreform im kleinen, die einem in den achtziger Jahren manches ratlose Semester hätte ersparen können. Es gehört auf den Gabentisch jedes Erstsemesters." Die Zeit "Was verdanken wir Walter Benjamin? Wie denken Dekonstruktionisten? Ist die Postmoderne wirklich tot? Hier steht´s. Nützlich." Die Woche "Die schwierige Aufgabe, komplexe Zusammenhänge in wenige Zeilen zu pressen, ist gut gelöst ... ein Kompass in Form eines kompakten Lexikons." Neue Zürcher Zeitung Insgesamt ist das Lexikon für alle unentbehrlich, die in ihrer exegetischen Arbeit an Literatur- und kulturwissenschaftliche Theorien anknüpfen. Der Dschungel von Theorien wird hier gut erschlossen... International Review of Biblical Studies Inhaltsverzeichnis
Leseprobe:
Religion und Literatur, ein Grenzgebiet, das sich, entsprechend den Forschungsinteressen von Lit.Wissenschaft// Komparatistik und Theologie/R.swissenschaft, in drei Bereiche gliedern läßt: (a) Lit. in der R., (b) R. in der Lit. und (c) Ästhetisierung des Religiösen. - (a) R. eignet, in ihrer sinnstiftenden Intentionalität, ein normativer und ein ästhetischer Aspekt. Normativ ist R. insofern, als sie Werte setzt und vermittelt (Gesetze, Gebote, Weisung) und Instanzen schafft, diese zu reflektieren und deren Einhaltung zu kontrollieren. Dieser Aspekt ist gekennzeichnet durch die Abstraktion ethischer Prinzipien und Glaubenssätze. Demgegenüber zeichnet sich der / ästhetische Aspekt durch Konkretisierung aus: Ereignisse, die für die Fundierung der R. konstitutiv sind, werden in Form von / Erzählungen tradiert und reinszeniert, Ritus und Kult dienen der Vergegenwärtigung des Heiligen in der konkreten Anschauung. Im Inszenierungscharakter (Kultdrama, Lehrgespräch, Mysterienspiel), in der narrativen Struktur (/ Mythos, Ahnen- und Heldensage, Heiligenlegende) und der lyrischen Verdichtung (Mantra, Psalm, Kirchenlied) dokumentiert sich die literar. Qualität dieser religiösen Ausdrucksformen; hinzu kommen das Moment der Identifikation und das der / Fiktionalität. Interdisziplinäre Forschungsinteressen (/ Interdisziplinarität) richten sich zum einen auf die (v. a. in der Liturgie vorherrschenden) lyrischen Formen; insbes. die Hymnologie hat sich als fächerübergreifendes Forschungsgebiet etabliert. Ein weiteres komparatistisches Anliegen ist zum anderen die Erforschung der Bibel als Lit. Schon das spätantike Christentum erkannte die / Lite-rarizität biblischer Texte: Hieronymus verstand die Bibel als Lit. hohen Stils; Augustinus entwarf eine umfassende Rezeptionstheorie zum christlichen Sprachumgang. In der Neuzeit war es v. a. J.G. /Herder, der die Bibel als literar. Werk in den Blick rückte (Vom Geist der Ebräischen Poesie, 1782/83) und die Frage nach den Einflüssen der Bibel in der Lit. inaugurierte. Systematische Untersuchungen richten sich seitdem z.B. auf Fragen der / Periodisierung oder auf die Typologisierung der Adaption von Bibelstoffen. - (b) Dies verweist bereits auf die große Anzahl von / stoff- und motivgeschichtlichen Untersuchungen zur Bearbeitung religiöser / Motive, Themen oder Figuren. In typologischer Hinsicht wird u.a. unterschieden zwischen zitathaften Reminiszenzen (F.W. /Nietzsche, Ecce homo, 1908), parodistischen Gegenlektüren (G. Grass, Die Blechtrommel, 1959) und expliziten Neugestaltungen religiöser oder biblischer / Stoffe (Th. Mann, Joseph und seine Brüder, 1933-43). Über die deskriptive Erarbeitung thematologi-scher und intertextueller Bezüge (/ Intertextualität und Intertextualitätstheorien) hinaus richten sich die Interessen problemorientierter Studien auf die Aktualisierungen der Stoffe und deren Verwendung als Projektionsfläche gesellschaftlicher Konflikte. Dabei geht es um die kritische Auseinandersetzung mit der institutionalisierten R. und ihrem Verhältnis zu Tota-litarismus und Fundamentalismus einerseits und zum demokratischen Pluralismus andererseits (H. Böll, Ansichten eines Clowns, 1963; R. Hochhuth, Der Stellvertreter, 1963; S. Rushdie, The Satanic Verses 1988). Thema ist auch das implizite Weiterleben religiöser Tradition in der säkularisierten Gesellschaft (W. Percy, Love in the Ruins, 1971; J. Updike, Roger's Version, 1986; J. Irving, A Prayer for O wen Meany, 1989). Einen weiteren Schwerpunkt bildet die Untersuchung der poetologischen Valenz (und Ambivalenz) religiöser Ausdrucksformen, in deren intertextuellen Verdichtungen R. u. Lit. koinzidieren (F. Hölderlin, E. Lasker-Schüler, P. Celan). - (c) Das romantische Konzept (/ Romantik) einer progressiven Universalpoesie< leitet programmatisch die Ästhetisierung des Religiösen ein. So definiert F. Schleiermacher R. in Abgrenzung von Logik und Ethik als > Anschauung und Gefühls wobei er ihr als einem Medium jeder menschlichen Tätigkeit >Sinn und Geschmack fürs Unendliche< zuschreibt. In ihrem Bezug auf das Unendliche kommt nach F. v. Schlegel aber v. a. der Poesie eine entscheidende Funktion zu, die über die Entstehung einer >neuen Mythologie< zur Stiftung einer neuen Universal-R. führen soll. Novalis, der den Gedanken einer Vermittlung zwischen Mensch und Unendlichem an Jesus Christus als den poetischen Messias bindet, stellt das Liebesmotiv ins Zentrum seiner Konzeption, um so eine Erneuerung des Christentums als Liebes- und Friedensreligion zu imaginieren. Die Korrespondenz von R. und Kunst erweist sich in der romantischen Lit., indem diese die intentionale Bewegung auf das Unendliche hin vollzieht und damit zugleich Ausdrucksmedium des Religiösen wird. In der / Moderne führt die Ästhetisierung des Religiösen zum einen zur Sakralisierung nicht nur der Kunst, sondern auch der Person des Künstlers mit Hilfe religiöser Topoi (S. George), zum anderen zur Idee des Gesamtkunstwerkes (R. Wagner). Deren postmoderne (/ Postmoderne) Varianten bevorzugen allerdings andere Medien: So wirken z.B. die >Ikonen< der Popkultur durch Bühne und Film bzw. Video-Clip (Madonna, Like a Prayer), und in Komposition und Inszenierung wird von Kino-Mythen der Anspruch eines Gesamtkunstwerkes erhoben (G. Lucas, Star Wars, 1977-99). Lit.: H. Timm: Die heilige Revolution. Das religiöse Totalitätskonzept der Frühromantik. Schleiermacher -Novalis - E Schlegel, FfM. 1978. - M. Fuhrmann et al. (Hgg.): Text und Applikation. Theologie, Jurisprudenz und Lit.wissenschaft im hermeneutischen Gespräch, Mchn. 1981. - H. Koopmann/W. Woesler (Hgg.): Lit. u. R., Freiburg et al. 1984. - W.Jens/H. Küng (Hgg.}: Dichtung und R., Mchn. 1985. - diess. (Hgg.): Theologie und Lit.: Zum Stand des Dialogs, Mchn. 1986. -A. Dürr/W. Killy (Hgg.): Das protestantische Kirchenlied im 16. und 17. Jh.: Text-, musik- und theologiegeschichtliche Probleme, Wiesbaden 1986. - J. Holzner/ U. Zeilinger (Hgg.): Die Bibel im Verständnis der Ge-genwartslit., St. Polten/Wien 1988. - Z. Konstantino-vic: »Die Nachwirkungen der Bibel als Problem der Vergleichenden Lit.wissenschaft«. In: Holzner/Zeilinger 1988. S. 17-24. - W. Nethöfel: »Literar.-religiöse Reflexion der Gegenwart«. In: W. Härle/R. Preul (Hgg.): Theologische Gegenwartsdeutung, Marburg 1988. S. 11-42. - W. Braungart et al. (Hgg.): Ästhetische und religiöse Erfahrungen der Jh.wenden, 3 Bde., Paderborn et al. 1997-99. |
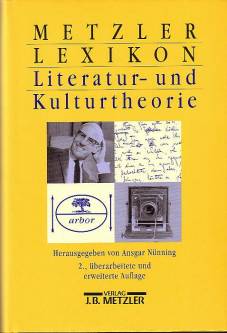
 Bei Amazon kaufen
Bei Amazon kaufen