|
|
|
Umschlagtext
„Man mache die Dinge so einfach wie möglich. Aber nicht einfacher. Soll Einstein geraten haben. Diese Einführung in die Methoden der empirischen Sozialforschung erfüllt diesen Anspruch. Darum ist sie ein Klassiker. Nicht nur für Soziologen.“
Prof. Dr. Peter Gross, Universität St. Gallen „Ein ausgereiftes Lehr- und Handbuch, das für die Studierenden wegen der umfassenden Darstellung, die doch leicht verständlich bleibt, fast unentbehrlich ist.“ Prof. Dr. Dr. h.c. Friedrich Fürstenberg, Rheinische Friedrich-Wilhelms-Universität Bonn „Ein Klassiker, der von Auflage zu Auflage besser geworden ist.“ Prof. Dr. Hans-Joachim Hoffmann-Nowotny, Universität Zürich „Atteslander versteht es ausgezeichnet, empirische Sozialforschung lesefreundlich und trotzdem wissenschaftlich exakt zu vermitteln.“ Prof. Dr. Klaus Zapotoczky, Johannes-Kepler-Universität Linz Autoren und Mitarbeiter: Atteslander, Peter, Dr. phil., Dr. rer. pol. b.c., ordentlicher Professor em. für Soziologie und empirische Sozialforschung, Universität Augsburg Cromm, Jürgen, Dr. rer. pol., Dr. rer. pol. habil., M.A., apl. Professor, Universität Augsburg Grabow, Busso, Dr. rer. pol., Dipl. oec., wissenschaftlicher Mitarbeiter und Projektleiter, Deutsches Institut für Urbanistik, Berlin Klein, Harald, Dr. phil., M.A., Publizistik- und Kommunikationswissenschaftler, Lehrbeauftragter, Universität Jena Maurer, Andrea, Dr. rer. pol., ordentliche Professorin für Organisationssoziologie am Institut für Soziologie und Gesellschaftspolitik, Universität der Bundeswehr München Siegert, Gabriele, Dr. rer. pol., ordentliche Professorin für Publizistikwissenschaft, Institut für Publizistikwissenschaft und Medienforschung, Universität Zürich Rezension
In der 10. Auflage seit 1968 immer wieder aktualisiert und verbessert handelt es sich hier um ein verständliches Standardwerk zu den Methoden empirischer Sozialforschung mit Schwerpunkt auf Erhebungs- und Auswertungsmethoden sozialer empirischer Daten. Hilfreich auch für Nicht-Sozialwissenschaftler; Empirie gewinnt auch in den Geisteswissenschaften immer mehr an Bedeutung. Ein 6-seitiges Sachregister ist zusätzlich behilflich bei der Erschließung des Buches.
G.B. für lehrerbibliothek.de Verlagsinfo
Die bewährte Einführung wurde erneut überarbeitet, alle Kapitel wurden durchgesehen und zum Teil erweitert, die Literatur aktualisiert. Auf dem aktuellen Stand und in neuer Rechtschreibung. Rezensionen: Aus den Rezensionen der Vorauflage „Man mache die Dinge so einfach wie möglich. Aber nicht einfacher. Soll Einstein geraten haben. Diese Einführung in die Methoden der empirischen Sozialforschung erfüllt diesen Anspruch. Darum ist sie ein Klassiker. Nicht nur für Soziologen.“ Prof. Dr. Peter Gross, Universität St. Gallen „Ein ausgereiftes Lehr- und Handbuch, das für die Studierenden wegen der umfassenden Darstellung, die doch leicht verständlich bleibt, fast unentbehrlich ist.“ Prof. Dr. Dr. h.c. Friedrich Fürstenberg, Rheinische Friedrich-Wilhelms-Universität Bonn „Ein Klassiker, der von Auflage zu Auflage besser geworden ist.“ Prof. Dr. Hans-Joachim Hoffmann-Nowotny, Universität Zürich „Atteslander versteht es ausgezeichnet, empirische Sozialforschung lesefreundlich und trotzdem wissenschaftlich exakt zu vermitteln.“ Prof. Dr. Klaus Zapotoczky, Johannes-Kepler-Universität Linz Aus den Rezensionen zur 10. Auflage "Ein klassisches Buch zu den Methoden der Sozialforschung, vielfach erprobt und im akademischen Unterricht bewährt." Prof. Dr. Theo Stammen, Universität Augsburg "Nach zehn Auflagen handelt es sich um ein ausgereiftes Lehrbuch, mit dem Dozenten und Studierende kein Risiko eingehen." Prof. Dr. Fritz Gründger, Evangelische Fachschule Berlin Inhaltsverzeichnis
I Entstehung sozialer Daten l
1 Grundprobleme empirischer Sozialforschung 3 1.1 Drei Hauptfragen 3 l .2 Erste begriffliche Klärungen 5 1.2.1 Empirie - Empirismus 7 1.2.2 Hauptsächliche Anwendungen 8 1.2.3 Empirisch-analytische oder gesellschaftskritisch- dialektische Sozialforschung? 9 1.3 Historische Entwicklung 10 1.3.1 Pioniere der Quantifizierung und Mathematisierung 10 l .3.2 Qualitatives Vorgehen und die Bedeutung von Monographien 12 1.4 Darstellung sozialer Daten 15 1.4.1 Soziale Daten als abstrahierte Wirklichkeit 15 1.4.2 Verkürzte Darstellung sozialer Daten 16 1.4.3 Erste Beurteilungskriterien 19 2 Forschungsablauf 21 2.1 Fünf Phasen des Forschungsablaufes 21 2.2 Theoretische Orientierungen 23 2.2.1 Problembenennung 23 2.2.2 Wissenschaftstheoretische Aspekte und die Funktionen von Theorien 25 2.2.3 Arten von Theorien 36 2.3 Operationalisierungsvorgang 40 2.3.1 Gegenstandsbenennung 40 2.3.2 Definition von Begriffen 44 2.3.3 Formulierung von Hypothesen 47 2.3.4 Begriffe - Variablen - Indikatoren 50 2.4 Forschungsdesign 54 2.4.1 Dimensionen des Forschungsablaufes 54 2.4.2 Methoden und Gegenstandsbereiche 59 2.4.3 Empirische Sozialforschung als sozialer Prozess . . 60 2.4.4 Einige typische Forschungsdesigns 63 2.5 Systematische Kontrolle des gesamten Forschungs prozesses 69 2.5.1 Mutilierte Methodenverwendung 71 2.5.2 Systematik der Interpretation 72 2.5.3 Repräsentativ!tat und Zentralität 74 2.5.3.1 Repräsentativität 74 2.5.3.2 Zentralität 75 II Erhebung sozialer Daten 77 3 Beobachtung 79 3.1 Beobachtung in der Sozialforschung 79 3.1.1 Begriff 79 3.1.2 Geschichte 80 3.1.3 Quantitative und qualitative Beobachtung 82 3.1.3.1 Quantitativ orientierte Beobachtung 83 3.1.3.2 Qualitativ orientierte Beobachtung 84 3.1.4 Anwendungsgebiete 86 3.2 Bestandteile der Beobachtung 87 3.2.1 Beobachtungsfeld 88 3.2.2 Beobachtungseinheiten 90 3.2.3 Beobachter 92 3.2.4 Beobachtete 93 3.3 Formen der Beobachtung 94 3.3.1 Strukturiertheit 95 3.3.2 Offenheit 99 3.3.3 Teilnahme 102 3.3.4 Klassifikation 104 3.4 Die qualitativ-teilnehmende Beobachtung 104 3.4.1 Begriff 105 3.4.2 Forschungspraxis 107 3.4.2.1 Forschungsablauf 107 3.4.2.2 Feldzugang 108 3.4.2.3 Rollendefinition bzw. Rollenauswahl 109 3.4.2.4 Datenerhebung und -auswertung 110 3.4.2.5 Feldrückzug 111 3.4.3 Anwendungsgebiete - Vorzüge - Grenzen 112 3.5 Probleme und Grenzen wissenschaftlicher Beobachtung . 113 3.5.1 Methodische und forschungspraktische Probleme . 113 3.5.2 Forschungsethische Fragen 116 4 Befragung 120 4.1 Allgemeines 120 4.2 Alltägliche Befragung - wissenschaftliche Befragung ... 121 4.2.1 Alltagsgespräche als Austausch von Informationen 121 4.2.2 Kriterien der Wissenschaftlichkeit 122 4.3 Interview als soziale Situation 123 4.3.1 Stimulus-Reaktions-Modelle 124 4.3.2 Verbindliche und unverbindliche Meinungen 131 4.3.3 Meinungen als Artefakte 134 4.4 Formen der Befragung 143 4.4. l Vom wenig strukturierten zum stark strukturierten Interview 146 4.4.2 Kommunikationsart 149 4.4.2.1 Interviewerverhalten: weich, hart, neutral . 149 4.4.3 Anwendungsbereiche einzelner Befragungstypen . 153 4.4.3. l Offene Konzepte - wenig strukturierte Befragung 153 4.4.3.2 Befragung in Gruppen 155 4.4.3.3 Leitfaden-Befragungen 156 4.4.3.4 Narratives Interview 158 4.4.3.5 Befragung mit Fragebogen 158 4.4.4 Standardisiertes - nicht-standardisiertes Interview 160 4.4.5 Offene und geschlossene Fragen 161 4.4.6 Direkte und indirekte Fragen 165 4.4.7 Fragen nach unterschiedlicher Zentralität von Meinungen 167 4.4.7.1 Beispiel für hohe Zentralität 169 4.4.7.2 Einstellungsfragen 169 4.4.7.3 Sonntags-Frage 169 4.4.7.4 Bilanzfragen 171 4.4.7.5 Faustregeln bei der Frageformulierung ... 173 4.5 Weitere Fragebogenstrategien 174 4.5.1 Schriftliche Befragung 174 4.5.2 Telefoninterviews 176 4.5.3 Kombinierte Verfahren 178 4.5.3. l Versand von Fragebogen bei telefonischer Befragung 180 4.5.3.2 Fehlerquellen in Befragungen 182 4.5.3.3 Die Delphi-Methode 183 4.5.4 Computergestützte Verfahren 184 4.5.4.1 Internet und Online-Befragungen 186 4.5.4.2 Ausblick 190 4.6 Sind Antworten Fakten oder Artefakte? 191 5 Experiment 196 5.1 Das Experiment in der Sozialforschung 196 5.1.1 Funktion und allgemeine Begriffsbestimmung des Experimentes 197 5.1.2 Grundbedingungen 199 5.2 Verschiedene Arten von Experimenten 200 5.2.1 Laboratoriums- und Feldexperiment 200 5.2.2 Projektives Experiment und ex-post-facto-Verfahren 200 5.2.3 Simultan- und sukzessives Experiment 201 5.2.4 Simulation und Planspiel 201 5.2.4.1 Simulation 202 5.2.4.2 Planspiel 203 5.2.5 Beispiel eines Experimentes 203 5.3 Techniken und Probleme bei der Kontrolle des Experimentes 205 5.3.1 Technik der Kontrolle 205 5.3.2 Probleme bei der Kontrolle des Experimentes .... 208 5.4 Einwände gegen das Experiment in den Sozial wissenschaften 209 5.4.1 „Self-fulfilling" und „self-destroying prophecy" .. 209 5.4.2 Das Experiment ist selektiv 210 5.4.3 Ethische Vorbehalte 211 5.4.4 Zusammenfassung und Ausblick 212 6 Inhaltsanalyse 215 6.1 Gegenstand sozialwissenschaftlicher inhaltsanalytischer Verfahren 215 6.2 Zur Geschichte der Methode 219 6.3 Gegenstandsbereiche der Inhaltsanalyse 224 6.4 Kategorienbildung und ihre Probleme 225 6.5 Typologie inhaltsanalytischer Verfahren nach Zielen und Mitteln 229 6.6 Forschungsablauf 232 6.6.1 Grundlagen qualitativer Verfahren 235 6.6.2 Unterschiede zwischen quantitativen und qualitativen Ansätzen 238 6.7 Inhaltsanalysen mit Computerprogrammen 239 6.7.1 Computerunterstützte Inhaltsanalyse 241 6.7.2 Qualitative Datenanalysen (QDA) mittels Computer 247 III Auswertung sozialer Daten 251 7 Skalierungsverfahren 253 7.1 Funktion und Begriffsbestimmungen 253 7.1.1 Begriffe 253 7.1.2 Indikator als Grundelement der Skalierung 254 7.2 Gültigkeit (Validität) und Verlässlichkeit (Reliabilität) .. 255 7.3 Klassifizierung der Skalierungsverfahren 256 7.3.1 Messniveau der Verfahren 256 7.3.2 Was wird gemessen? 258 7.4 Wichtige Skalierungsverfahren 260 7.4.1 Rangordnung und Paarvergleich 260 7.4.2 Polaritätsprofil 261 7.4.3 Verfahren der gleich erscheinenden Abstände nach Thurstone 264 7.4.4 Verfahren der summierten Einschätzungen nach Likert 264 7.4.5 Skalogramm-Analyse nach Guttman 265 7.4.6 Hinweise auf weitere Skalierungsverfahren für komplexere Problemstellungen 268 7.5 Zusammenfassung und Ausblick 269 8. Verwendung mathematischer und statistischer Verfahren in der empirischen Sozialforschung 272 8.1 Bemerkungen zur Bedeutung mathematischer und statistischer Verfahren in der Sozialforschung 272 8.2 Mathematische Ansätze 275 8.2.1 Wahrscheinlichkeitstheorie 276 8.2.2 Matrizenrechnung 279 8.2.3 Andere mathematische Ansätze 281 8.2.3.1 Funktionen 281 8.2.3.2 Spieltheorie 284 8.3 Statistik in der Sozialforschung 287 8.3.1 Einteilung der Statistik 287 8.3.2 Statistische Merkmale und Messniveau 288 8.4 Beschreibende Statistik 290 8.4.1 Darstellung von Häufigkeiten 290 8.4.2 Statistische Maßzahlen 292 8.4.3 Korrelation und Regression 296 8.4.3.1 Korrelation 296 8.4.3.2 Regression 298 8.4.4 Theoretische Häufigkeitsverteilungen 300 8.5 Stichproben 304 8.5.1 Stichprobenarten 305 8.5.1.1 Zufallsstichproben 305 8.5.1.2 Systematische Stichproben 308 8.5.2 Systematische Fehlerquellen 309 8.5.3 Stichprobenschätzwerte 310 8.5.4 Bestimmung der Stichprobengröße 314 8.6 Prüfung von Hypothesen 316 8.6.1 Hypothesentests 316 8.6.2 Chi Hoch 2-Test (Chi-Quadrat-Test) 318 8.7 Varianzanalyse und multivariate Methoden 320 9 Auswertung der erhobenen Daten 324 9.1 Vorbereitung der Erhebung 325 9.1.1 Hypothesen und Operationalisierung 325 9. l .2 Erhebungsinstrument und EDV-Unterstützung ... 326 9.1.2.1 Wahl der EDV-Instrumente 327 9.1.2.2 Angemessenheit des Erhebungsinstrumentes 329 9. l .2.3 Berücksichtigung von anderen Untersuchungen 329 9.1.3 Gütekriterien und Pretest 329 9.1.3.1 Zuverlässigkeit (Reliabilität) und Gültigkeit (Validität) 330 9.1.3.2 Verständlichkeit von Fragen 331 9.1.3.3 Klarheit von Kategorien und Kategorienbildung 331 9.1.3.4 Probleme der Erhebung 333 9.1.3.5 Der Umgang mit Restriktionen 334 9.2 Aufbereitung der erhobenen Daten 335 9.3 Analyse der aufbereiteten Daten 340 9.3.1 Auswertung einzelner Merkmale 342 9.3.1.1 Beschreibende Auswertungen 342 9.3.1.2 Analytische Verfahren 345 9.3.2 Auswertungen mehrerer Merkmale im Zusammenhang 346 9.4 Interpretation und Forschungsbericht 354 IV Zukunftsaussichten 361 10 Entwicklung der empirischen Sozialforschung seit 1945 - Aufgaben in der Zukunft 363 10.1 Empirische Daten zwischen Wissen und Nichtwissen .. 363 10.2 Wiedereinführung der empirischen Sozialforschung in der Bundesrepublik 369 10.3 Überwindung gegensätzlicher Annahmen über das Verhältnis von Theorie und Empirie 372 10.4 Exaktheit bis ins Bedeutungslose? 376 10.5 Zukunftsaussichten 379 10.5.1 Die Verantwortung der Forscher wächst 379 10.5.2 Neue Herausforderungen durch Globalisierung . 384 Literaturverzeichnis 387 Sachregister 405 |
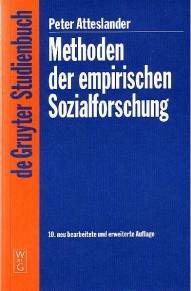
 Bei Amazon kaufen
Bei Amazon kaufen