|
|
|
Umschlagtext
Das Dilemma der vorgeburtlichen Diagnostik
Schwanger zu sein, Mutter zu werden ist häufig mit einer Mischung aus Hoffnungen und Ängsten verbunden. Um diese Ängste zu bannen, ist es für die meisten werdenden Eltern heute selbstverständlich, die Möglichkeiten der Pränataldiagnostik in Anspruch zu nehmen, oft ohne sich über deren Tragweite bewusst zu sein. Denn werden bei Ultraschall, Blut- oder Fruchtwasseruntersuchung Erkrankungen oder Behinderungen des ungeborenen Kindes festgestellt, legen Ärzte schnell den Abbruch der Schwangerschaft nahe. Die werdenden Eltern stehen damit vor einer Entscheidung, die viele so nie treffen wollten. Schonungslos offen und ergreifend berichtet Monika Hey von ihrer eigenen Erfahrung mit der Pränataldiagnostik und öffnet zugleich die Augen für ein ethisches Dilemma, das jede Schwangere, jedes werdende Elternpaar und unsere Gesellschaft als Ganzes betrifft. Monika Hey studierte Politik, Amerikanistik und Film in Göttingen und Berkeley, Kalifornien. Sie arbeitete zwanzig Jahre als Filmemacherin und Fernsehredakteurin und ist seit 1996 Supervisorin und Coach mit eigener Praxis in Köln. Mit dem Thema Pränataldiagnostik beschäftigt sie sich seit 1998, als sie aus Unkenntnis einem Schwangerschaftsabbruch zustimmte. Rezension
Vorgeburtliche Diagnostik gehört heute im Kontext einer Schwangerschaft zum üblichen Standard - und nur wenige Mütter und Eltern machen sich ernstlich Gedanken über die ethischen Implikationen der vorgeburtlichen Diagnoseverfahren, u.a. Ultraschall, Blut- oder Fruchtwasseruntersuchung. Um mögliche Ängste im Kontext einer Schwangerschaft zu bannen, ist es für die meisten Schwangeren heute selbstverständlich, die Möglichkeiten der Pränataldiagnostik in Anspruch zu nehmen, oft ohne sich über deren Tragweite bewusst zu sein; denn bei Erkrankungen des ungeborenen Kindes raten Ärzte schnell zum Abbruch der Schwangerschaft. Die Autorin berichtet auch aus eigener Erfahrung vom ethischen Dilemma der vorgeburtlichen Diagnostik: Welches Kind ist es wert, geboren zu werden?
Dieter Bach, lehrerbibliothek.de Inhaltsverzeichnis
Mein gläserner Bauch 9
Danksagung 197 Literaturempfehlungen 198 Methoden der Pränataldiagnostik 199 Anmerkungen 208 Sachregister 220 Leseprobe: Scwanger zu sein, Mutter oder Vater zu werden, eine Geburt zu erleben, ist mit intensiven Gefühlen verbunden, einer oft komplizierten Mischung aus Hoffnungen und Ängsten. Um diese Ängste zu bannen, ist es für die meisten Schwangeren heute selbstverständlich, sich und ihr Kind von Anfang an regelmäßig untersuchen zu lassen. Neben der üblichen Schwangerenvorsorge gibt es dabei auch Verfahren, die gezielt eine Erkrankung oder Fehlbildungen des Kindes sowie Hinweise auf mögliche genetische Störungen ausfindig machen sollen – in der Medizin Pränataldiagnostik genannt. Pränataldiagnostik ist nicht zu verwechseln mit Präimplantationsdiagnostik, kurz PID, über die in den Medien seit 2010 intensiv berichtet und in der Öffentlichkeit heftig gestritten wurde, denn Präimplantationsdiagnostik findet statt, bevor ein künstlich befruchteter Embryo operativ in die Gebärmutter eingepflanzt wird – also vor einer tatsächlichen Schwangerschaft. Die Untersuchungen der pränatalen Diagnostik hingegen beginnen etwa ab der neunten Schwangerschaftswoche. Zu ihnen gehören bestimmte Ultraschall- und Bluttests – die sogenannten non-invasiven Methoden – sowie direkte Eingriffe in die Gebärmutter, bei denen mit einer Punktionsnadel genetisches Material des Kindes entnommen wird – die sogenannten invasiven Methoden. Eine Broschüre für Schwangere, die ich vor Kurzem im Wartezimmer einer Gynäkologin fand, lockt schon auf dem Titelblatt mit den Worten: sicher – geschützt – geborgen. Und auf der letzten Seite steht das Versprechen: Wir sind für Sie da. Welche Schwangere wünscht sich das nicht? 10 Unter der Überschrift »Vorsorge bedeutet Sicherheit für Ihr ungeborenes Kind« macht die Gynäkologin darauf aufmerksam, dass die werdende Mutter noch weitaus mehr für sich und ihr Kind tun kann, als die Krankenkassen bewilligen dürfen. »Diese Leistungen können im Einzelfall sinnvoll sein, um Ihnen und Ihrem Kind die größtmögliche Sicherheit zu bieten«, erklärt die Ärztin. So werden zum Beispiel 3D-Ultraschalluntersuchungen mit zauberhaften Bildern beworben als eine Möglichkeit, »eine photoähnliche Abbildung Ihres Kindes im Mutterleib zu erhalten … Eine Erinnerung fürs Leben!« Welche medizinische Bedeutung dieser Ultraschall hat, steht in der Broschüre jedoch nicht. Deutlich erkennbar wird das Faltblatt, in dem für dieses Angebot geworben wird, »Informationsträger« genannt. Und es wird versichert: »Dies ist keine Werbebroschüre.« Denn Ärzte dürfen für sich keine Reklame machen. Unter dem Vorwand, der Schwangeren und ihrem Kind die größtmögliche medizinische Sicherheit zu bieten, wird hier etwas angepriesen, das über die übliche Kassenleistung hinausgeht. Es werden Untersuchungen empfohlen, die von der Patientin privat bezahlt werden müssen. Inzwischen gibt es in manchen Praxen sogar die Möglichkeit, gegen Bezahlung ein Video vom Kind über Ultraschall aufzuzeichnen. Natürlich wünscht sich jede werdende Mutter Sicherheit für ihr Ungeborenes. Aber leider sind es falsche Versprechungen, die hier gemacht werden. Falsche Fährten für Schwangere, gerade wenn sie sich allzu vertrauensvoll auf alle Zusatzangebote bei der medizinischen Betreuung ihrer Schwangerschaft einlassen. Denn für die meisten der schon im Mutterleib erkennbaren Abweichungen oder Krankheiten gibt es bis heute keine Therapie. Für ein gesundes Kind gibt es keine Garantie, auch nicht durch die Maßnahmen der vorgeburtlichen Diagnostik. »Vorsorge ist wichtig für Sie und Ihr Kind«, heißt es in der Broschüre, und zu den empfohlenen Vorsorgeuntersuchungen 11 gehört an erster Stelle das sogenannte Ersttrimester-Screening. Ein Test, der mittels Ultraschall und einer Blutuntersuchung der Mutter Informationen über das Risiko möglicher Chromosomenstörungen liefern soll. Diese ergänzende Ultraschalluntersuchung am Ende des ersten Schwangerschaft-Trimesters ist keineswegs harmlos. Sie dient der Messung der Nackenfalte oder, wie es medizinisch heißt, der Nackenfaltentransparenz des Ungeborenen. Innerhalb der Verfahren der Pränataldiagnostik ist diese Untersuchung der erste Schritt, um eventuell vorhandene Chromosomenabweichungen zu entdecken. Bei einem auffälligen Befund folgen dann üblicherweise im nächsten Schritt die sogenannten invasiven Methoden, eine Chorionzottenbiopsie oder eine Fruchtwasseruntersuchung, mit denen problematische Ergebnisse des Ersttrimester-Screenings abgeklärt werden sollen. All das wird jedoch in der Broschüre nicht deutlich. Obwohl pränatale Diagnostik meistens tief in das Erleben von werdenden Müttern eingreift, wird auf die möglichen Folgekonflikte für die Schwangere bei einer auffälligen Diagnose und auf das Risiko für das Kind durch die weiterführende Diagnostik in der Broschüre nicht hingewiesen. Und schon gar nicht auf das Recht der Schwangeren, keinesfalls unvorbereitet in diesen Konflikt gebracht werden zu dürfen. Während es für die meisten Schwangeren heute selbstverständlich ist, die Angebote der Pränataldiagnostik in Anspruch zu nehmen, ist ihnen die Tragweite der Entscheidung für diese Art von Vorsorge meistens nicht bewusst. Worauf sie sich eingelassen haben, erfassen viele erst dann, wenn es zu spät ist. Dann, wenn ihre Kinder schon vor der Geburt in diagnostische Schubladen gesteckt werden. Und natürlich vor allem dann, wenn das Leben ihres Kindes infrage gestellt wird, weil es nicht der Norm entspricht. Die Schwangeren geraten damit in den ethischen Konflikt, über das Leben ihres Kindes, über einen Abbruch der Schwangerschaft entscheiden zu müssen. Die möglichen psychi12 schen Folgen solch einer Erfahrung werden in unserer Gesellschaft oft verschwiegen oder sogar tabuisiert. Einer Studie zufolge haben selbst Frauen, die sich über mögliche Untersuchungen in der Schwangerschaft gut informiert haben, im Nachhinein das Gefühl, in etwas hineingerutscht zu sein, ohne es wirklich bewusst entschieden zu haben. Weil von allen Beteiligten – sowohl von den Frauen als auch den Ärztinnen und Ärzten – im Vorfeld die bedrohlichen Seiten der Diagnostik ausgeblendet werden. Sie werden verharmlost oder so weit wie möglich verdrängt.1 Bei den heute üblichen Verfahren der Pränataldiagnostik wird vor allem nach ungeborenen Kindern mit Down-Syndrom gesucht. Trisomie 21, wie das Down-Syndrom auch genannt wird, ist eine sogenannte Chromosomenabweichung, die im Mutterleib nicht therapiert werden kann. Trotzdem gilt die Suche nach der auf das Down-Syndrom hinweisenden verdickten Nackenfalte in Deutschland als Standardprogramm pränataler Vorsorge. Dies betraf bis vor wenigen Jahren besonders Frauen ab fünfunddreißig, da die statistische Wahrscheinlichkeit, ein behindertes Kind zu bekommen, mit dem Alter zunimmt. Ein Großteil der Schwangerschaften, bei denen Ärzte eine Behinderung des Kindes feststellen, endet mit einem Abbruch der Schwangerschaft. Ist das wirklich der Wunsch aller betroffenen Eltern? Oder ist es weitgehend unbemerkt medizinische Praxis in Deutschland geworden, Vorsorgeuntersuchungen schwangerer Frauen ganz selbstverständlich mit der Aussonderung behinderter Ungeborener zu verknüpfen? Trotz bestehender Gesetze. Ohne die Not der Eltern, die ethischen Fragen und psychischen Folgen angemessen zu berücksichtigen. Als könne man mit dem Abbruch der Schwangerschaft etwas ungeschehen machen. Weit über neunzig Prozent der Schwangeren, bei deren ungeborenen Kindern eine Trisomie 21 festgestellt wurde, brechen die Schwangerschaft ab. Liegt das an einer eugenischen Grund13 haltung der Frauen und ihrer Partner, die ihre Kinder daraufhin überprüfen lassen, ob sie es wert sind, zur Welt zu kommen? Oder spielt nicht auch der defektzentrierte Medizinerblick eine Rolle und eine hochentwickelte Technologie, vielleicht sogar ein stillschweigend bestehender gesellschaftlicher Konsens gegen das Austragen behinderter Kinder – wenig beachtete Aspekte, die alle ihren Teil dazu beitragen, dass werdende Mütter sich und ihr Kind einer Abtreibung ausliefern. Ein Fachartikel, der die Veränderungen in der gynäkologischen Praxis durch Pränataldiagnostik beschreibt, machte mich bei meiner Recherche zu diesem Thema besonders nachdenklich, denn dort fragt sich eine Gynäkologin: »Haben wir nicht tatsächlich inzwischen eine ›Allianz zur Selektion‹, nie so ausgesprochen, das Wort ist zu sehr negativ besetzt, aber gesellschaftlich toleriert und von den Ärzten und Ärztinnen umgesetzt?«2 Ich teile ihre Besorgnis. Denn schon lässt sich nachweisen, dass als Folge der immer umfassenderen pränataldiagnostischen Untersuchungen immer weniger Kinder mit Down-Syndrom zur Welt kommen. Und bald soll sogar ein früher Bluttest bei Schwangeren ausreichen, um eine Trisomie 21 nachzuweisen. Schon heute sind die vorgeburtlichen Kontrollen engmaschig und haben vor allem ein Ziel: Kinder mit Down-Syndrom frühzeitig zu entdecken. Mit tödlicher Konsequenz. Eine Studie der Bundeszentrale für gesundheitliche Aufklärung hat gezeigt, dass sich fast alle Frauen im Verlauf ihrer Schwangerschaft mit den Angeboten der Pränataldiagnostik auseinandersetzen müssen, während ihr Informationsstand zum Thema zugleich gering ist.3 Sich erst während einer Schwangerschaft über die vorgesehenen Untersuchungen und ihre möglichen Folgen Gedanken zu machen, reicht nicht aus. Denn sogar Frauen, die wussten, welche Untersuchungen sie wollten und welche nicht, haben erlebt, dass sie während ihrer Schwangerschaft viel Kraft aufwenden mussten, sich tatsächlich anders zu 14 entscheiden, als routinemäßig von ihnen erwartet wird. Nicht allen gelingt es, sich gegen die perfekt eingespielten Mechanismen der Pränataldiagnostik durchzusetzen. Es ist kaum zu übersehen, dass heute sowohl die Medizin als auch die Arbeitswelt immer mehr dem Modell des perfektionierbaren Menschen anhängen. Ein Leben im Wahn der Optimierung. Von Anfang an. Um jeden Preis. Eltern bekommen diesen Druck besonders zu spüren. Vollkommene Eltern von vollkommenen Kindern sollen sie sein. Wie werdende Eltern mit den Angeboten zur pränatalen Diagnostik umgehen, ihre Ängste und ihre Entscheidungen spiegeln auch diese gesellschaftlichen Bedingungen und Bewertungen wider. Pränataldiagnostik stellt das Leben von Kindern infrage, die anders sind als die Norm. Und den Eltern wird zugemutet, eine Entscheidung über Leben und Tod ihres Kindes zu treffen. Das ist eine geradezu unmenschliche Anforderung. Um es ganz deutlich zu sagen: Ich wende mich keineswegs gegen das mühsam erkämpfte Recht auf Abtreibung. Hier geht es um etwas anderes. Ich habe mich entschieden, meine eigene Erfahrung mit Pränataldiagnostik zu veröffentlichen, weil mir scheint, dass werdende Eltern zunehmend unter Druck stehen, ein behindertes Kind abzutreiben. Und mit dieser extremen Belastung meistens allein bleiben. Bis es mich selbst betraf, hatte ich wenig darüber nachgedacht, was eine Frau empfindet, die ihr Kind abgetrieben hat. Die einem Schwangerschaftsabbruch zustimmt, obwohl sie sich mit ihrem ungeborenen Kind vielleicht schon innig verbunden fühlt. Das Tabu, über eine Abtreibung nach pränataler Diagnostik zu sprechen, ist groß. Und möglicherweise kommt zur selbstverständlichen Erwartung an Schwangere, sich pränataldiagnostisch untersuchen zu lassen, bis heute die Ignoranz gegenüber dem Schmerz derjenigen Eltern hinzu, die ihr Kind wegen eines problematischen Befunds nach solch einer Untersuchung abgetrieben haben. 15 Selbst in Veröffentlichungen zur Trauer von Eltern geht es fast ausschließlich um Fehl- und Totgeburten – und man sollte nicht vergessen, dass über Generationen auch dieses Leid tabuisiert und ignoriert worden ist. Dass Mütter ihre Kinder nach der Geburt nicht einmal zu sehen bekamen, ein Kind einfach entsorgt wurde, wenn es schon im Mutterleib oder bei der Geburt gestorben war. Es hat lange gedauert, zehn Jahre etwa, bis ich mich stark genug fühlte, mir die medizinischen Unterlagen aus der Zeit meiner eigenen Schwangerschaft anzusehen. Bis ich in der Lage war, von meinem Recht Gebrauch zu machen, meine Krankenakte einzusehen in der Praxis der Gynäkologin, die mich während der Schwangerschaft betreut hatte. Eine jüngere Ärztin hat inzwischen die Praxis übernommen. Befundberichte aus den Labors und der Klinik, und, zu meiner Überraschung, sogar die Aufzeichnungen meiner früheren Gynäkologin bekam ich in Kopie ausgehändigt. Darüber hinaus recherchierte ich, was ich mich so lange nicht getraut hatte anzuschauen. Ich beschäftigte mich mit Krankheitsbildern und suchte nach Erklärungen für Fachbegriffe, die ich in den Berichten aus den Labors und der Klinik gefunden hatte. Trisomie 21. Down-Syndrom. Hydrops fetalis. Meine journalistische Erfahrung gab mir den Rahmen, einer extrem schwierigen Zeit in meinem Leben noch einmal nachzuspüren. In Ruhe nachzudenken und zu schreiben. Um zu verstehen – so gut es geht –, was damals passiert ist. Es war ein schwieriger Prozess, in dem ich versucht habe, der entsetzlichen Erinnerung ein Gesicht zu geben. Damit sie mich nicht immer wieder hinterrücks überfällt, mich lähmt, oder in Tränen ausbrechen lässt, wenn jemand fragt: »Hast du Kinder?« Und hinter meiner eigenen Trauer entdeckte ich dabei sehr bald ein Thema, das über meinen eigenen Verlust weit hinausgeht. |
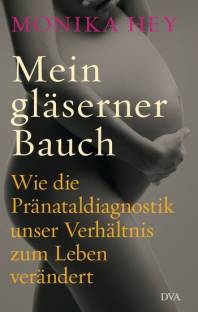
 Bei Amazon kaufen
Bei Amazon kaufen