|
|
|
Umschlagtext
Der Einsatz von sachangemessenen und adressatengemäßen Medien stellt in einem medienbestimmten Zeitalter große und neue Anforderungen an alle, die Unterrichts- und Erziehungsprozesse kompetent und wirkungsvoll gestaltenwollen.
Die vorliegende Einführung beschäftigt sich mit - der medientheoretischen und begrifflichen Einordnung sowie der Systematik der Unterrichtsmedien - Begründungen der Medienwirkung - der Gestaltung von Lernprozessen mit Medien - der unterrichtsmethodischen Einbindung des Medieneinsatzes - fachspezifischen Verwendungsmöglichkeiten - den technischen Grundlagen von Medien - im begrenzten Umfang auch mit der Geschichte einzlner Unterrichtsmedien und - mit dem pädagogischen Umgang mit Medien. Zahlreiche Graphiken ergänzen die textliche Darstellung. Ausführliche Literaturangaben bieten Hinweise für die weitere Beschäftigung mit der Frage des Lehrens und Lernens mit Medien im Unterricht. Im einzelnen widmet sich das Buch den Medien - Bild – Text –Arbeitsblatt –Tafel – Tageslichtprojektor – Dia - Unterrichtsfilm und Schulfernsehen – Computer - Zeitung. Zu den Autoren: Prof Dr. Volker Ladenthin (Lehrgebiet: Historische und Systematische Pädagogik mit dem Schwerpunkt Schulpädagogik) und Prof. Dr. Ingbert von Martial(Lehrgebiet: Schulpädagogik und Allgemeine Didaktik) lehren am Institut für Erziehungswissenschaft der Universität Bonn. Rezension
Eine erste Euphorie hinsichtlich des Medieneinsatzes vor allem sog. neuer Medien im Unterricht scheint verebbt. Gleichwohl aber bleiben Medien - insbesondere auch die klassischen - bedeutsamer Bestandteil unterrichtlichen Geschehens. Dieses Buch setzt hier erfreulich tradionell an und geht - nach vier einführenden Grundlegungskapiteln - auf die ganz traditionellen, aber wesentlichen Unterrichtsmedien ein: Bilder, Texte, Arbeitsblätter, Tafel, Tageslichtprojektor, Dia, Unterrichtsfilm - und erst gegen Ende der Computer. Stets ist die Darstellung dem Titel gemäß konkret auf Unterricht bezogen, also keine allgemeine Mediendidaktik. Ziel ist durchgängig der sachangemessene und der adressatengemäße Medieneinsatz in Unterrichtsprozessen. Natürlich begegnen dabei auch grundlegende Fragen nach Medienwirkung oder technischen Grundlagen von Medien. Die Darstellung ist verständlich und wird durch zahlreiche Graphiken visualisiert. Sachregister und weiterführende Literatur sind vorhanden.
Jens Walter, lehrerbibliothek.de Inhaltsverzeichnis
1. Unterricht (I. vonMartial) 11
2. Unterrichtsmedien (I. von Martial) 15 2.1 Die Stelle der Medien im Unterricht 15 2.2 Medien als Lernobjekte 16 2.3 Medien als Hilfsmittel 18 2.4 Begriff Unterrichtsmedium 19 2.5 Einteilung der Unterrichtsmedien 20 2.51 Lernobjekte 20 2.511 Originale 21 2.512 Informationelle Objekte 22 2.52 Hilfsmittel 24 3. Lernen mit Unterrichtsmedien (I. von Martial) 27 3.1 Zwei Beispiele aus der Geschichte der Didaktik 27 3.11 Anschauung in der Didaktik des Comenius 27 3.12 Medien als Mittel zur Bildung von Vorstellungen 29 3.2 Medien des Denkens 30 3.3 Lernen als Aufbau und Ausbau von strukturiertem Wissen 34 3.31 Äquilibration, Assimilation, Akkommodation und der Aufbau von Schemata 34 3.32 Wissen als semantisches Netzwerk 36 3.33 Schemata 38 3.331 Schemata im engeren Sinne 39 3.332 Ereignisschemata (Skripts) 40 3.333 Mentale Modelle 41 3.4 Konzepte und die Theorie der multimodalen Repräsentation 41 3.5 Ebenen der kognitiven Verarbeitung 45 4. Medienverwendung im Unterricht (l. von Martial) 47 4.1 Medienfunktionen 47 4.2 Analyse und Vorbereitung bei der Verwendung von Medien im Unterricht 57 4.3 Planung von Unterricht mit Medien 57 4.31 Lernziele 58 4.32 Thema 58 4.33 Methoden 59 4.34 Lernvoraussetzungen der Schüler 59 4.4 Analyse und Beurteilung von Unterrichtsmedien 60 5. Bilder (I. von Martial) 63 5.1 Zum Begriff Bild 63 5.11 Abbilder 65 5.111 Realistische Bilder 65 5.112 Graphische Modelle 66 5.113 Konstruierende Bilder 67 5.12 Logische Bilder 67 5.121 Visualisierung qualitativer Zusammenhänge 68 5.122 Visualisierung quantitativer Zusammenhänge 71 5.13 Bildliche Analogien 76 5.131 Strukturelle bildliche Analogien 77 5.132 Funktionale bildliche Analogien 78 5.133 Strukturell-funktionale bildliche Analogien 78 5.14 Mischform von Abbild und logischem Bild 79 5.15 Zur Codierung bildlicher Darstellungen 80 5.151 Wiedergabecodes bei Abbildern 81 5.152 Wiedergabecodes bei logischen Bildern 82 5.153 Steuerungscodes 82 5.2 Bildwahrnehmung und die Verarbeitung von Bildinformation - Bildverstehen 84 5.21 Mehrstufigkeit des Wahrnehmens und Verstehens von Bildern 85 5.22 Bildwahrnehmung und Lernen 88 5.3 Anforderungen an die Gestaltung von Bildern 89 5.31 Gesetze der Bildwahrnehmung 89 5.311 Gruppierung 89 5.312 Differenzierung im Wahrnehmungsfeld 91 5.32 Unterstützung des Bildverstehens durch geeignete Bildgestaltung 93 5.321 Farbgebung 93 5.322 Vertrauter Blickwinkel 93 5.323 Kontextualisierung 93 5.33 Anforderungen an die graphische Gestaltung im einzelnen 94 5.331 Vorklärung 94 5.332 Graphische Gestaltung 95 5.34 Didaktische Hinweise im Bild 97 5.341 Hinweise auf die zentrale Information 97 5.342 Hinweise für die Verarbeitung 97 5.4 Bilder und Texte 98 5.41 Texte in Bildern 98 5.42 Bilder in Texten 98 5.43 Unterschiede der Rezeption von Texten und Bildern 101 5.431 Bilder als Störquelle 101 5.432 Bilder, auf die im Text nicht eingegangen wird 102 5.433 Voreingenommenheit 102 5.5 Lernen mit Bildern im Unterricht 103 5.51 Didaktische Funktionen von Bildern 103 5.52 Didaktische Funktionen von Bildern in Texten 105 5.53 Hinweise für die Arbeit mit Bildern im Unterricht 105 5.531 Maßnahmen zur Sicherung der Bildwahrnehmung 106 5.532 Maßnahmen zur Sicherung des Bildverstehens 106 5.533 Verdeutlichung der MiUeilungsubsicht 107 5.534 Maßnahmen zur Sicherung der Nutzung von Bildern 107 5.535 Das Bild als Sprechanlaß 108 5.536 Lernkontrolle mit Hilfe von Bildern 108 5.6 Analyse und Beurteilung von Bildern 108 6. Texte (V.Ladenthin) 111 6.1 Vorbemerkung: Kritik von Sprache, Schrift, Text und Buch 111 6.2 Begriffsbestimmungen: Text 113 6.3 Historische Beispiele pädagogischer Textarbeit 115 6.4 Textverstehen 116 6.41 Der Sprachcharakter des Textverstehens 117 6.42 Lesen oder Kommunikation? 117 6.43 Textlinguistik 119 6.44 Lesepsychologie und Neuropsychologie 121 6.45 Die Bedeutung der Schrift 122 6.46 Die Leiblich-und Sinnenhaftigkeit des Lesens 124 6.5 Evaluation 126 6.6 Unterrichtsmethodische Konsequenzen 127 6.7 Texte als Unterrichtsmedien 130 6.71 Expositorische Textarbeit 131 6.711 Die Analyse des Gedankengangs: Vorschläge für ein Schema zur Analyse expositorischer Texte 134 6.712 Beispiele für Leseübungen an expositorischen Texten 135 6.72 Literarische Textarbeit 139 6.721 Vorschläge für Methoden des literarischen Textverstehens 141 6.722 Beispiel: Johann Wolfgang von Goethe - "Willkommen und Abschied" 143 6.73 Schematische Darstellung unterrichtlicher Textarbeit 143 6.74 Vorschlag für ein Schema zur schriftlichen Analyse expositorischer Texte 144 7. Das Arbeitsblatt (V. Ladenthin) 153 7.1 Definition 153 7.2 Hinweise zur Geschichte des Arbeitsblattes 153 7.3 Pädagogische Funktionen 157 7.31 Lernpsychologische Funktionen 157 7.32 Unterrichtsmethodische Funktionen 159 7.33 Pädagogische Anforderungen 163 7.4 Unterrichtsmethodische Hinweise 164 7.5 Arten von Arbeitsblättern 165 7.51 Arbeitsblätter ohne Aufgabenstellung 166 7.511 Das Motivationsblatt 167 7.512 Das Informationsblatt 168 7.513 Das Ergebnissicherungsblatt 168 7.514 Das Anschaiwngsblalt 169 7.52 Arbeitsblätter mit Aufgabenstellung 169 7.522 Das Versuchsbegleitblatt 170 7.523 Das Anwendungsblatt 170 7.524 Das Übungsblatt 170 7.525 Das Lernkontrollblatt 171 7.526 Das Klausurblatt 173 7.527 Der Testbogen 173 7.6 Handhabung von Arbeitsblättern 176 7.61 Rechtsfragen 176 7.62 Technische Herstellung von Arbeitsblättern 177 7.621 Hinweise zur Gestaltung von Arbeitsblättern 178 7.622 Unterrichtsorganisatorische Hinweise 183 7.623 Aufbewahrung 185 7.7 Die Stellung des Arbeitsblattes im Unterrichtsgeschehen einzelner Schulformen und einzelner Fächer 186 7.71 Die Stellung des Arbeitsblattes im Unterrichtsgeschehen einzelner Schulformen 186 7.72 Die Stellung des Arbeitsblattes im Unterrichtsgeschehen einzelner Fächer 186 7.8 Das Arbeitsblatt in der Lehrerausbildung 187 8. Die Tafel (I.vonManial) 189 8.1 Die Schreibtafel 189 8.11 Tafelarten 189 8.111 Wandtafel 190 8.112 Hebetafel 190 8.113 Schiebetafel 190 8.114 Flügeltafel 191 8.115 Rolltafel 191 8.116 Freistehende Tafel 191 8.117 Blättertafel 192 8.12 Oberflächen von Harttafeln 193 8.121 Kunststoff-oder Patenttafel 193 8.122 Emailletafel 193 8.123 Glastafel 193 8.13 Zusatzvorrichtungen 194 8.2 Hafttafeln 194 8.21 Tuchtafel 194 8.22 Klettentafel 195 8.23 Magnettafeln 196 8.3 Anschlagtafeln 197 8.31 Die Anschlagtafel als Wandtafel 197 8.32 Die Anschlagtafel als freistehende Tafel 197 8.4 Lehrtafeln 199 8.5 Kombinationen 199 8.6 Der Einsatz der Tafel im Unterricht 199 8.61 Einsatz von Schrcibtafcln 200 8.62 Hinsal/. der Tuchtalcl 201 8.63 liinsal/der Klcllcntafel 202 8.63 Einsatz der Klettentafel 202 8.64 Einsatz der Magnettafeln 202 8.65 Einsatz der Anschlagtafeln 203 8.66 Qualität des Tafelbildes 205 8.67 Lehren und Lernen mit Tafelbildern 208 8.68 Die Tafelarbeit im unterrichtsmethodischen Zusammenhang 209 8.7 Die Tafel im Medienverbund 212 9. Der Tageslichtprojektor (I.vonManial) 213 9.1 Das Gerät 213 9.2 Informationsträger 215 9.3 Herstellung von Bildern auf Folie 215 9.4 Technische Bedingungen für den Einsatz des Tageslichtprojektors 217 9.5 Lehren und Lernen mit dem Tageslichtprojektor 219 9.51 Allgemeine Regeln 219 9.52 Der statische Einsatz von Bildern auf Folie 220 9.53 Der dynamische Einsatz des Tageslichtprojektors 220 9.531 Markierungstechnik 221 9.532 Aufdecktechnik 221 9.533 Ergänzungstechnik 222 9.534 Aufbautechnik 222 9.535 Abbautechnik 224 9.536 Zieh-und Drehtechnik 225 9.537 Schattenrißtechnik 226 9.538 Durchleuchtungstechnik 227 9.539 Dynamische Modelle 227 9.54 Minitransparente, Kiemfolien und Aufleger 227 9.55 Kombinationen 228 9.56 Computerunterstützte Darstellungen 228 9.6 Der Tageslichtprojektor im Kontext der Unterrichtsmethodik 229 9.61 Unterrichtsphasen 229 9.62 Klassenunterricht 230 9.63 Gruppenunterricht 230 9.7 Der Tageslichtprojektor im Medienverbund 231 10. Dia, Diareihe und Tonbildschau (I.vonManial) 233 10.1 Technische Ausstattung 233 10.11 Geräte 233 10.12 Projektionsflächen 236 10.13 Zubehör 236 10.14 Informationsträger 237 10.15 Projektion 238 10.2 Arien von Dkircihcn 240 10.3 Der Einsatz von Dias und Diareihen im Unterricht 241 10.31 Vorklärung 241 10.32 Technische und organisatorische Vorbereitung 242 10.33 Dias und Diareihen im unterrichtsmethodischen Zusammenhang 242 10.34 Dias im Medienverbund 243 10.4 Die Tonbildschau 244 10.41 Zur Kennzeichnung des Mediums Tonbildschau 244 10.42 Arten der Tonbildschau 244 10.5 Der Einsatz der Tonbildschau im Unterricht 245 10.51 Die Tonbildschau im unterrichtsmethodischen Zusammenhang 245 10.52 Grenzen des Einsatzes 245 10.6 Hinweise zur eigenen Herstellung von Dia-und Tonbildreihen 245 11. Unterrichtsfilm und Schulfernsehen (l. von Martial) 247 11.1 Zur Geschichte des Films im Unterricht 247 11.2 Technische Aspekte des Films 248 11.21 DasFilmband 249 11.22 Der Filmprojektor 250 11.23 Filmarten 251 11.24 Der Unterrichtsfilm 252 11.25 Ausleihpraxis: VHS-Videokopien und Filme auf DVD 253 11.3 Einige Grundbegriffe der Filmgestaltung 254 11.31 Einstellung 255 11.32 Sequenz 256 11.33 Einstellungsgrößen 256 11.34 Kamerabewegungen 260 11.35 Achsenverhältnisse 261 11.36 Aufnahmeperspektiven 262 11.37 Verhältnis von Bild und Ton 263 11.38 Montage 264 11.4 Vermittlungsformen in Unterrichtsfilm und Schulfernsehen 265 11.5 Schulfernsehen 270 11.51 Organisationsformen 270 11.52 Arten von Sendungen 270 11.53 Schulfernsehen als Medienverbund 271 11.531 Schulfernsehsendung als Eeitmedium 272 11.532 Informationen für Eehrer 272 11.533 Arbeitsmaterial 274 11.6 Zur Rezeption von Filmen und Sendungen des Fernsehens 275 11.61 Notwendigkeit einer adressatenfreundlichen Dramaturgie 275 11.62 Aufnahme und Verarbeitung audiovisueller Information 276 11.63 Wirksamkeit von Sendungen des Schulfernsehens in Abhängigkeit von Schülervariablen 279 11.7 Der Einsatz von Unterrichtsfilm und Schulfernsehen im Unterricht 282 11.71 Vorlaufender, begleitender und nachfolgender Unterricht 283 11.72 Technische und organisatorische Vorbereitungen 283 11.73 Der Einsatz von Unterrichtsfilm und Schulfernsehen im methodischen Kontext 284 11.74 Einteilung des Unterrichts 284 11.8 Die Arbeit mit dem Film im Unterricht 290 11.9 Zur Analyse und Beurteilung von Unterrichtsfilmen und Sendungen des Schulfernsehens 290 12. Der Computer im Unterricht (l. von Martial) 291 12.1 Geräte 297 12.11 Personalcomputer 297 12.111 Aufbau eines Personalcomputers 297 12.112 Peripherie 300 12.12 Datenprojektor und Tageslichtprojektor mit LCD-Platte 300 12.13 Elektronische Tafel 301 12.2 Programmiertes Eernen 302 12.3 Eernobjekte und Informationen für Eehrer 305 12.31 Eernprogramme 305 12.32 Simulation und Experiment 308 12.33 Datenbank 309 12.34 Internet und Schule 310 12.341 Informationen für Lehrer und Lernobjekte 310 12.342 Unterrichtsmethodische Einbindung der Lernobjekte im Netz 315 12.343 Eehrgänge im Netz 315 12.344 Projekte im Netz 316 12.35 Multimedia 318 12.4 Eehren und Eernen mit dem Computer im Unterricht 319 12.41 Eern-und Übungsprogramme 319 12.42 Unterrichtsmethodik und Computerarbeit 320 12.421 Die Arbeit mit dem Computer in verschiedenen Sozialformen 320 12.422 Die Arbeit mit dem Computer in Phasen des Unterrichts 322 12.423 Projektunterricht und Computer 323 12.43 Computerräume - "Digitale Klassenzimmer" 324 12.431 Multifunktionale Nutzung 324 12.432 Das digitale Sprachlabor 325 12.44 Der Computer im Medienverbund 327 12.5 Kriterien für die Analyse und die Beurteilung von Lernsoftware 327 13. Zeitung und Zeitschrift als Unterrichtsmedien (V. Ladenihin) 329 13.1 Begriff 329 13.2 Tages und Wochenzeitungen 329 13.3 Zur Geschichte des Umgangs mit dem Medium im Unterricht 330 13.4 Geräte - organisatorische und apparative Vorgaben 337 13.41 Schriftmedium 337 13.42 Material 338 13.43 Drucktechniken 339 13.5 Unterrichts- und lerntheoretische Grundlagen - Epistemologie und Repräsentation 339 13.51 Zeitung 339 13.52 Text 340 13.53 Bild 341 13.54 Material 343 13.6 Die Arbeit mit der Zeitung im Unterricht 344 13.61 Der technische Umgang mit dem Medium 344 13.62 Lernzieldimensionen 344 13.63 Die Zeitung im thematischen Zusammenhang - Eignung für die verschiedenen Unterrichtsfächer 345 13.64 Zeitung und methodische Gestaltung des Unterrichts 354 13.65 Das Medium im Medienverbund 356 13.7 Kriterien für die Beurteilung und die Auswahl von Zeitungen einschließlich der Grenzen des Mediums 357 14. Das Institut für Film und Bild in Wissenschaft und Unterricht und das Bildstellenwesen (I. von Martial) 359 14.1 Geschichte und gegenwärtige Aufgaben 359 14.2 Anschriften 361 15. Literatur 363 16. Register 395 |
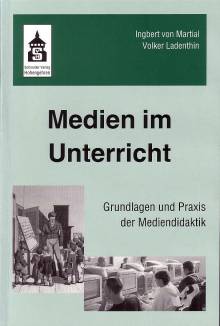
 Bei Amazon kaufen
Bei Amazon kaufen