|
|
|
Umschlagtext
Interkulturelle Pädagogik heißt, das Bewusstsein zu verinnerlichen, in einer multikulturellen Gesellschaft zu leben, sich deren Anforderungen zu stellen und in der Kulturbegegnung die Chance gegenseitiger Bereicherung nicht nur zu erkennen, sondern auch zu verwirklichen.
Daher ist das Hinterfragen der eigenen interkulturellen Grundhaltung eine der Grundvoraussetzungen für pädagogisches Personal in Tageseinrichtungen für Kinder und für Lehrkräfte in Schulen. Sprachförderung ist keine - und schon gar keine zeitlichbegrenzte - sonderpädagogische Ma<128>nahme speziell für ausländische Kinder, sondern ein großes Mosaiksteinchen im Rahmen der interkulturellen Erziehung. Das bedeutet, einen Erziehungs- und Bildungsauftrag im ständigen Kontakt mit der Familie und anderen Erziehungsberechtigten durchzuführen. Sprachförderung wird ständig betrieben - mal bewusst und geplant, mal in alltäglichen Situationen, aber auch dort zunehmend bewusster. Dabei ist die Sprachförderung am sinnvollsten im Tun und im Kontakt mit anderen und nicht dann, wenn man etwa das Formale der Sprache zum Thema macht. Wir unterscheiden grundsätzlich zwischen - der Sprachförderung im normalen Alltagsleben zwischen Kind und Pädagogen und - der Sprachförderung in bewusst herbei geführten Fördersequenzen. Für die bewusst herbei geführte, d.h. geplante Sprachförderung -systematisch, nicht curricular, aber auf der Basis mit Hilfe von Entwicklungsbögen festgestellter Sprachstände - sollen alltägliche Aktivitäten nutzbar gemacht werden. Auch hat sich die in diesem Buch vorgestellte Kleeblattmethode als geeignetes Hilfsmittel für die Planung von Fördereinheiten erwiesen. Die Autoren: Wilfried Berghoff, Jahrgang 1954, Abteilungsleiter am Berufskolleg Vera Bek-kers in Krefeld und verantwortlich für den Aufbaubildungsgang Sprachförderung, unterrichtet dort seit 1985 an der Fachschule für Sozialpädagogik die Unterrichtsfächer Deutsch/Kommunikation und Politik/Gesellschaftslehre. Seit 1999 liegt sein besonderer Schwerpunkt auf der Förderung von Deutsch als Zweitsprache. Birgit Mayer-Koenig, Jahrgang 1960, ist Sachgebietsleiterin für Tageseinrichtungen für Kinder der Stadt Krefeld. Im Rahmen ihrer 18-jährigen Tätigkeit als Erzieherin kann sie auf sieben Jahre Erfahrung mit interkultureller Pädagogik als Leiterin einer multikulturellen Einrichtung zurück blicken. In ihrer Arbeit als Fachberaterin bildet die interkulturelle Pädagogik einen Schwerpunkt. Schneider Verlag Hohengehren GmbH Rezension
Der Erwerb der deutschen Sprache ist Voraussetzung für schulischen wie beruflichen Erfolg. Insbesondere auch Ausländerkinder der sog. dritten Generation haben noch immer Nachteile im Bildungswesen und später auf dem Arbeitsmarkt. Frühzeitige und gezielte Förderung muss sich besonders als vernetzte Förderung darstellen. Die Stadt Krefeld hat sich seit 1999 intensiv um solche Vernetzung bemüht. Es ist wichtig, die gesamte ausländiche Familie in die Bemühungen zur Spracherwerbsförderung mit einzubeziehen. Das Resultat liegt mit diesem praxisorientierten Handlungskonzept für eine interkulturelle Pädagogik vor, das viele Fallbeispiele bietet und geeignet ist für Tageseinrichtungen, Schulen, Jugendeinrichtungen und Erwachsenenbildung.
Oliver Neumann, lehrerbibliothek.de Inhaltsverzeichnis
Inhaltsverzeichnis 1
Vorwort 3 1. „Die Grenzen meiner Sprache bedeuten die Grenzen meiner Welt." - 5 Einige grundlegende Gedanken zur Konzeption dieses Buches 2. Gedanken zu Kooperation und Vernetzung 7 2.1 Kooperation und Vernetzung aus der Sicht der Familie 7 2.2 Produktive interkulturelle Arbeit durch Synergieeffekte - ein Fallbeispiel 10 3. Voraussetzungen für den Zweitspracherwerb 14 3.1 Außersprachliche Faktoren 14 3.1.1 Interkulturelle Pädagogik als Grundhaltung in Tageseinrichtung für Kinder und Schule 16 3.1.2 Interkulturelles Einverständnis vom Träger bis zur Fachaufsicht 23 3.1.3 Gedanken zu kulturellem und religiösem Hintergrundwissen 23 3.1.4 Elternarbeit 28 3.1.5 Grenzen interkultureller Pädagogik 30 3.2. Sprachliche Faktoren 32 3.2.1 Bedingung und Bedeutung des Spracherwerbs 32 3.2.2 Der Erwerb der Muttersprache und der Zweitsprache im Vergleich 34 3.2.3 Vier Stadien des Lernens - auch beim Zweitspracherwerb 38 3.2.4 Besonderheiten der jeweiligen Herkunftssprache 39 3.2.4.1 Deutsch 40 3.2.4.2 Türkisch 42 3.2.4.3 Bosnische, kroatische, serbokroatische Sprache(n) 44 3.2.4.4 Polnisch 47 3.2.4.5 Russisch 49 3.2.4.6 Arabisch 51 4 Sprachförderung - bewusst gemacht 52 4.1 Mit Sicherheit zum Sprachvorbild 52 4.2 Falsches muss nicht immer ein Fehler sein 53 4.3 Sprachförderung - ein ständiger und auch alltäglicher Prozess 56 4.4 Geplantes Vorgehen - aber nicht curricular: die Kleeblatt-Methode 56 5. Sprache als Produkt von Sinnes-, Bewegungs- und sozialen Umfelderfahrungen 62 5.1 Der Einfluss der Sinne auf die Sprache 63 5.2 Sprache ist ein Teil der Gesamtmotorik 65 5.3 Positive soziale Umfelderfahrungen - eine Grundvoraussetzung für den Spracherwerb 66 6. Von der Sprachstandserfassung bis zur Evaluation 68 6.1 Die Sprachstandserfassung - Bedingungen und Probleme 69 6.2 Der Förderbogen und die Entwicklungsprotokolle 73 6.3 Die Evaluation 86 7. Neue Ideen, aber keine Angst vor dem Bewährten: praktische Anregungen 88 7.1. Satzstruktur 91 7.2. Begriffsbildung 123 7.3. Wortschatz nach Wortarten 166 7.4. Besondere Probleme bei der Formenbildung 200 7.5. Sozial-emotionale bzw. interaktive Schwerpunkte 215 8. Literaturverzeichnis 240 9. Anhang 263 |
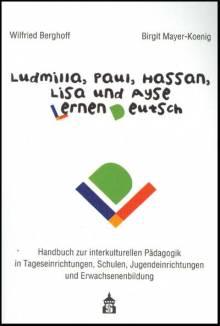
 Bei Amazon kaufen
Bei Amazon kaufen