|
|
|
Umschlagtext
Dieses ausführliche, neue zweiteilige Lehrbuch bietet im zweiten Band empirisch fundierte und praxisnahe Schilderungen aller in der Verhaltenstherapie mit Kindern und Jugendlichen wichtigen diagnostischen Methoden und Interventionsverfahren.
Die von erfahrenen und renommierten Autorinnen und Autoren verfassten Beiträge behandeln die vorgestellten Methoden mit folgenden Schwerpunkten: theoretische Grundlagen Indikationen und Kontraindikationen Anschauliche Beschreibung des Vorgehens mit Fallbeispielen Effektivität und mögliche Nebenwirkungen Darüber hinaus wird im Sinne einer Allgemeinen Psychotherapie in wegweisenden Beiträgen die Möglichkeit der Kombination von Verhaltenstherapie mit anderen Therapieschulen praxisnah erörtert. Das vorliegende Buch ist konsequent störungsübergreifend konzipiert. Die einzelnen Methoden werden so ausführlich und nachvollziehbar dargestellt, dass auch nicht verhaltenstherapeutisch ausgebildete Kolleginnen und Kollegen sie in ihr Handlungsrepertoire übernehmen können. Rezension
Dieses grundlegende Lehrbuch ist auch für alle an der Psychologie und psychischen Störungen von Kindern und Jugendlichen interessierte PädagogInnen aufschlußreich; der 1. Band als Grundlagenband bietet elementare Informationen zu entwicklungspsychologischen Grundlagen, Modellen psychischer Störungen, Vorkommen und Verbreitung psychischer Störungen im Kindes- und Jugendalter sowie deren gesellschaftliche Rahmenbedingungen. Der 2. Band zeigt die Interventionsmethoden auf, erläutert aber zuvor auch die diagnostischen Methoden und bezieht komplexe multimodale Trainings mit ein, wie z.B. Sozialverhaltenstraining, Konzentrations- und Aufmerksamkeitstrainings oder Elterntrainings. Besonders an dieser Stelle leigt auch der Bezug zur Pädagogik. Als Hintergrundinformation für die Lehrerhand und für die schulpsychologische Bibliothek ist das doppelbändige "Lehrbuch der Verhaltenstherapie mit Kindern und Jugendlichen" jedenfalls hilfreich.
Thomas Bernhard für lehrerbibliothek.de Verlagsinfo
Leseprobe: Zur bisherigen und zukünftigen Entwicklung der Kinder- und Jugendlichenpsychotherapie Mit diesem abschließenden Beitrag soll ein Ausblick auf weitere Entwicklungen der Kinder- und Jugendlichenpsychotherapie gewagt werden. Da die zukünftige Entwicklung dieser Profession nicht unabhängig von ihrer Vergangenheit ist, muss dieser Ausblick in der Vergangenheit beginnen. Der Ausgangspunkt der Geschichte der Kinderpsychotherapie im weiteren Sinne kann mit Schmidtchen (2001) in der Gründung pädagogischer und heilpädagogischer Einrichtungen durch Pestalozzi (1770, „Gut Neuhof“), Fröbel (1816) und Wichern (1833, „Raues Haus“) gesehen werden. Spezifischer therapeutisch orientierte Einrichtungen wurden gegen Ende des 19. und zu Beginn des 20. Jahrhunderts gegründet: – Witmer eröffnete 1896 in Philadelphia eine „Psychologische Klinik“1 zur Behandlung von Kindern. – 1909 gründete Healy in Chicago eine heilpädagogische Beratungsstelle zur Unterstützung von Jugendgerichten, deren Konzept später wegweisend für die amerikanischen „Child-Guidance-Clinics“ wurde, welche wiederum nach dem Zweiten Weltkrieg in Deutschland Vorbildcharakter für die hier dann flächendeckend eingeführten Erziehungsberatungsstellen hatten (vgl. Woldrich, 1998). Im deutschsprachigen Raum wurden die ersten Vorläufer der heutigen Erziehungsberatungsstellen Anfang dieses Jahrhunderts gegründet: – 1903 die „Heilpädagogische Beratungsstelle“ in Hamburg durch Cimbal, – 1906 die „Medico-pädagogische Poliklinik für Kinderforschung, Erziehungsberatung und ärztliche erzieherische Behandlung“ in Berlin durch Fürstenheim, – 1916 ebenfalls durch Fürstenheim die „Jugendsichtungsstelle“ in Frankfurt, – 1917 die „Heilpädagogische Beratungsstelle“ an der Kinderklinik Heidelberg durch Homburger und – 1918 die „Elternberatungsstelle“ in Leipzig durch Gregor (vgl. Woldrich, 1998). – 1919 wurde erstmalig die heute gängige Bezeichnung „Erziehungsberatungsstelle“ für die von Adler und Aichhorn in Wien begründeten Einrichtungen gewählt. Einer der Pioniere der Kinderpsychotherapie, Lightner Witmer, der bereits erwähnte Gründer der ersten „Psychologischen Klinik“, sah die Kinder- und Jugendlichenpsychotherapie bereits Anfang des 20. Jahrhunderts als Anwendung der Erkenntnisse verschiedener akademischer Disziplinen an: In einem Beitrag für die Zeitschrift „Psychological Clinic“ beschreibt Witmer (1907), wie sehr er sich durch die psychologische Grundlagenforschung (z.B. Fechner) in seiner Arbeit in der von ihm geführten Psychologischen Klinik leiten lässt, und legt dar, dass Klinische Psychologie eine große Nähe nicht nur zur Medizin, sondern auch zur Soziologie und zur Pädagogik aufweist. Er sieht für die therapeutische Arbeit mit Kindern keine Profession (weder Psychologen noch Pädagogen, Sozialarbeiter oder Mediziner) als ausreichend qualifiziert an. Stattdessen fordert er bereits damals eine Ausbildung vor allem in pädagogischen Fragen, wobei er eine psychologische Grundausbildung voraussetzt. Andere Pioniere der psychologischen Forschung und Praxis veröffentlichten in den zwanziger Jahren des 20. Jahrhunderts Fallberichte, in denen die Anwendung psychologischer Grundlagenforschung in der Verhaltensänderung bei Kindern praktisch demonstriert wurde (Jones, 1924; Watson & Rayner, 1920). Dennoch – als psychotherapeutische Methode dominierte in der ersten Hälfte des 20. Jahrhunderts die Psychoanalyse und mit ihr verwandte Therapieformen und dies bildete sich auch in der Kinder- und Jugendlichenpsychotherapie ab. Erstmals beschrieb von Hug-Helmut (1913) die psychoanalytische Kindertherapie und insbesondere A. Freud (1927/1983) und Klein (1932/1987) vertieften diese Denkrichtung und entwikkelten kindertherapeutische Verfahren auf einer tiefenpsychologischen Grundlage. Axline (1947/1990) entwarf das Grundmodell einer klientenzentrierten Kinderpsychotherapie. In Deutschland bemühte sich Schmidtchen (1974) um die wissenschaftliche Fundierung dieser Therapieform (vgl. dazu ausführlich Mrochen & Bierbaum- Luttermann, in diesem Band). Die Verhaltenstherapie als eigenständige Therapieform entwickelte sich erst in den 50er Jahren, erstmals genannt wurde der Begriff „Behavior Therapy“ im Jahr 1953 von Lindsley, Skinner und Solomon. In der Verhaltenstherapie wurde über lange Zeit nicht zwischen der Therapie mit erwachsenen Klienten und der Therapie mit Kindern unterschieden (vgl. dazu auch Meyer, Richter, Grawe, Graf v. d. Schulenburg & Schulte, 1991), da im Gegensatz zur tiefenpsychologischen und zur klientenzentrierten Therapie in der Verhaltenstherapie keine grundsätzlich anderen Methoden bei den unterschiedlichen Altersgruppen zum Einsatz kamen. Von Beginn an wurden sowohl Kinder als auch Jugendliche und Erwachsene mit dem breiten Methodeninventar der Verhaltenstherapie behandelt. Dabei stand bei der Verhaltenstherapie zunächst die ausschließlich am beobachtbaren Verhalten orientierte Behandlung im Vordergrund, während im Zuge der „kognitiven Wende“ in den 70er Jahren intrapsychische Zustände (Kognitionen, Emotionen) immer mehr in den Vordergrund rückten (vgl. dazu ausführlicher Lauth, Brack & Linderkamp, 2001). Als in der zweiten Hälfte der 80er Jahre immer mehr störungsspezifische Therapiemanuale entstanden, kam es auch zu einer ersten Differenzierung zwischen verhaltenstherapeutischer Kinder- und Erwachsenentherapie, denn viele Manuale waren nur für die eine oder andere Zielgruppe nutzbar. Heute werden – obwohl die eigentliche Methodik immer noch große Überschneidungen zwischen der Therapie mit Kindern und Erwachsenen aufweist – viele Spezifika der Kinderverhaltenstherapie gesehen, etwa im psychotherapeutischen Prozess (vgl. Borg-Laufs & Hungerige, 1999), bei der Entwicklungsabhängigkeit der Therapie (Borg-Laufs & Trautner, 1999), beim Motivationsund Beziehungsaufbau (Mackowiak, 1999), bei der Diagnostik und Therapieplanung (Döpfner & Borg-Laufs, 1999) u.v.a. (s. im Überblick Borg-Laufs, 1999a). Die gesetzliche Entwicklung mit dem Inkrafttreten des Psychotherapeutengesetzes am 1.1.1999 verlief parallel dazu mit einem ähnlichen Ergebnis. Es wurden zwei neue Grundberufe geschaffen, die Psychologische Psychotherapeutin und der Kinder- und Jugendlichenpsychotherapeut, für die getrennte Ausbildungen gesetzlich vorgegeben sind. Dadurch entstand erstmals auch für Anbieter verhaltenstherapeutischer Ausbildungen die Notwendigkeit, spezifisch kindertherapeutische Ausbildungen zu konzipieren und anzubieten (vgl. Borg-Laufs & Per, 1999). Die aktuelle Kinder- und Jugendlichenpsychotherapie, insbesondere die Verhaltenstherapie, ist stark von störungsspezifischen Konzeptionen geprägt (s. z.B. Döpfner, Schürmann & Frölich, 1998; Lauth & Schlottke, 1999; Petermann & Petermann 2000a, 2000b; Warschburger, Petermann, Fromme & Wojtalla, 1999). Dies ist eine neue und wichtige Perspektive in der Verhaltenstherapie, in der die Behandlung ursprünglich ohne weitere Beachtung der nosologischen Zuordnung fast ausschließlich aus der funktionalen Analyse abgeleitet wurde. Durch das angewachsene Störungswissen und empirisch überprüfbare Therapiekonzeptionen für bestimmte Störungen konnte die Qualität psychotherapeutischer Behandlung verbessert werden. Dennoch soll an dieser Stelle nochmals darauf hingewiesen werden, dass die störungsorientierte Sichtweise allein in der Regel nicht hinreichend für eine angemessene Therapieplanung ist (vgl. ausführlich Borg-Laufs & Merod, 2000). So ist die alleinige Konzentration auf störungsspezifisches Wissen aus folgenden Gründen nicht ausreichend: – Es kann von Komorbidität als praktischem Regelfall ausgegangen werden (Auckenthaler, 2000), d.h. bei der Behandlung unausgelesener Patientengruppen im therapeutischen Alltag weisen die Betroffenen häufig mehrere Störungen auf, deren Wechselwirkungen auch therapeutisch bedacht werden müssen. – Die als umschriebene Störung klassifizierbare Symptomatik stellt nur einen kleinen Teil der Lebensäußerungen der KlientInnen dar. Geprägt von ihrer Kultur, ihrer Familie und ihrer sonstigen Lebenswelt kommt mit jedem Klienten ein „Einzelfall“ mit spezifischen Ressourcen und Defiziten in die Therapie. – Viele Interventionsmethoden sind nicht bestimmten Störungsbildern zuzuordnen (vgl. das einführende Kapitel dieses Buches), sondern werden in Abhängigkeit von den jeweiligen Umgebungsbedingungen und den Ergebnissen der funktionalen Analyse „quer“ zu den Störungsbildern eingesetzt. Somit müssen auch in der Ausbildung weiterhin störungsübergreifende Inhalte und Kompetenzen vermittelt und in der Forschung störungsübergreifende Probleme angegangen werden. Wie bereits in mehreren Beiträgen dieses Lehrbuches betont, wird die Zukunft der Kinder- und Jugendlichenpsychotherapie – ebenso wie bei der Therapie mit Erwachsenen (vgl. Grawe, 1998, u.a.) – in der Entwicklung einer schulenüberwindenden Allgemeinen Kinderpsychotherapie liegen (vgl. auch Schmidtchen, 2001). Im Sinne einer effizienten Versorgung mit Kinder- und Jugendlichenpsychotherapie ist es – auch wenn die Psychotherapierichtlinien von dieser Sichtweise noch meilenweit entfernt sind (vgl. Vogel, Borg-Laufs & Wagner, 1999) – offensichtlich, dass die nachgewiesenermaßen wirksamen psychotherapeutischen Interventionen in eine Allgemeine Kinder- und Jugendlichenpsychotherapie integriert werden müssen, während die Hilfesuchenden nicht länger mit weniger effizienten oder gar unnützen Methoden belästigt werden sollten. Auf dieser allgemeinen Ebene würden viele wissenschaftlich und praktisch tätige KollegInnen sicherlich zustimmen. Aber wie sieht es mit der Konkretisierung aus? Welche Anteile der einzelnen Therapieschulen verdienen es, in eine allgemeine Kinder- und Jugendlichenpsychotherapie überführt zu werden, und welche müssen als Ballast abgeworfen werden? Hier erscheint es bei dem aktuellen Diskussionsstand fraglich, ob in naher Zukunft eine Lösung gefunden werden kann. So hat Schmidtchen (2001) letztlich aufgrund des noch unbefriedigenden Forschungs- und Diskussionsstandes sein Buch zur Allgemeinen Kinder- und Jugendlichenpsychotherapie, das als erster Schritt hin zu einer schulenüberwindenden Therapie gelten kann, als „orientierende Rahmenkonzeption“ (S. 142) bzw. als „Diskussionsgrundlage“ (ebd.) beschrieben. Bei seinem Vorschlag geht er davon aus, dass Therapeuten entweder Verhaltenstherapie, klientenzentrierte oder tiefenpsychologische Spieltherapie als Basisverfahren ihres Handelns wählen, da diese nach seiner Einschätzung ein breites Indikationsspektrum und differenzierte Interventionsmöglichkeiten bieten. Für eine adäquate Therapiedurchführung müsse die Therapeutin aber – da keine dieser Therapieschulen hinsichtlich aller zu verfolgenden Therapieziele allein hinreichend ist – in der Regel Interventionen aus den anderen Basisverfahren oder den ergänzenden Verfahren Familientherapie und Pharmakotherapie in die Therapie importieren. Bei entsprechender Ausbildung kann sie dies selber tun, ansonsten muss die Kompetenz von Kolleginnen und Kollegen genutzt werden, was am ehesten in mutliprofessionell besetzten Institutionen (Beratungsstellen, Kliniken u.a.) möglich erscheint, da dort entsprechend qualifizierte Teams zusammenarbeiten. Zur weiteren Entwicklung einer Allgemeinen Psychotherapie für Kinder, Jugendliche und Familien sind dringend weitere wissenschaftlich fundierte Arbeiten notwendig, gleichzeitig sollten die Psychotherapierichtlinien und andere Rahmenbedingungen des Versorgungssystems so gestaltet werden, dass der Weg zu einer Allgemeinen Kinder- und Jugendlichenpsychotherapie nicht erschwert, sondern gefördert wird. Die Diskussion über Weiterentwicklungen der Kinder- und Jugendlichenpsychotherapie (und auch ihrer Qualitätssicherung, vgl. Borg-Laufs, in Druck) macht nur dann wirklich Sinn, wenn auch sichergestellt ist, dass die Betroffenen von diesen Erkenntnissen profitieren können. Dies muss zur Zeit infrage gestellt werden. Im Bereich der Kinder- und Jugendlichenpsychotherapie muss in Deutschland von einer eklatanten Unterversorgung ausgegangen werden (Löcherbach et al., 1999; Wittchen, o.J.). Wittchen (ebd.) geht aufgrund umfangreicher Datenerhebungen davon aus, dass nur 17% aller psychotherapeutisch behandlungsbedürftigen Kinder und Jugendlichen überhaupt therapeutisch betreut werden und von diesen 17% wiederum nur die Hälfte „in einer Form, die als adäquat eingeschätzt wurde“ (ebd., S. 20). Dies gilt mutmaßlich auch dann, wenn die im Rahmen der Jugendhilfe erbrachten Leistungen miteinbezogen werden, was allerdings z.Zt. nicht geschieht und aufgrund unterschiedlicher Datenerfassungen in beiden Bereichen wohl auch in der nächsten Zeit nicht geschehen wird. Für die Zukunft ist hier zunächst zu fordern, dass eine Bedarfsplanung verwirklicht wird, die diesen Namen auch verdient und dass im Rahmen dieser Bedarfsplanung der Bedarf an Kinder- und Jugendlichenpsychotherapie getrennt von dem Bedarf an Erwachsenenpsychotherapie erfasst wird (vgl. Löcherbach et al., 1999). Pohl (2000) weist darüber hinausgehend darauf hin, dass auch im Rahmen der stationären Kinder- und Jugendlichenpsychotherapie und -psychiatrie von einer erheblichen Fehlversorgung auszugehen ist. Zusätzlich ist auch zu konstatieren, dass gerade die hoch wirksame Verhaltenstherapie zumindest im Bereich der Therapiedurchführung in ambulanter Praxis zum Zeitpunkt der Veröffentlichung dieses Bandes geradezu grotesk unterrepräsentiert ist. Da Kinder- und Jugendlichenpsychotherapie als eigene Profession, wie bereits geschildert, traditionell eine tiefenpsychologische Ausrichtung hatte, kam es im Rahmen der Übergangsregelungen mit der Einführung des Psychotherapeutengesetzes dazu, dass in vielen Gebieten nahezu ausschließlich tiefenpsychologisch orientierte Kollegen die Zulassung als Kinder- und Jugendlichenpsychotherapeuten erhielten. Damit eine wirklich patientengerechte Versorgung in diesem Bereich realisiert werden kann, wäre daher eine Sonderzulassung für verhaltenstherapeutisch orientierte Kolleginnen wünschenswert. Die von Psychologischen Psychotherapeuten und Kinder- und Jugendlichenpsychotherapeutinnen durchgeführte Psychotherapie hat mit dem Psychotherapeutengesetz die lang ersehnte feste Einbindung in das Gesundheitssystem Deutschlands erhalten. Diese Entwicklung war inhaltlich nur folgerichtig, war doch z.B. die verhaltenstherapeutische Forschung und Ideenentwicklung in hohem Maße von Psychologen und Psychologinnen geprägt, die im Rahmen des medizinischen Versorgungssystems aber nur auf Anweisung und unter Aufsicht von Medizinern tätig werden konnten. Dennoch soll hier zum Abschluss eine möglicherweise unpopuläre und angesichts der momentanen Entwicklungen nicht zeitgemäß wirkende Frage angesprochen werden. Als sich die Verhaltenstherapie Ende der 60er und Anfang der 70er Jahre in Deutschland ausbreitete, vermieden die damals praktisch tätigen und forschenden Kollegen und Kolleginnen die Bezeichnung „Patienten“ für diejenigen, die ihre Hilfe in Anspruch nahmen. Menschen mit psychischen Problemen sollten nicht als „krank“ gelten und dementsprechend nicht als Objekte einer Behandlung, sondern als Partner in einem therapeutischen Prozess betrachtet werden. Eine Aussage über die Patienten seiner Psychologischen Klinik aus dem bereits zitierten Artikel von L. Witmer aus dem Jahr 1907 zu diesem Thema macht deutlich, dass diese Herangehensweise in den 60er Jahren nicht neu erfunden wurde, sondern dass Zweifel am Krankheitscharakter psychischer Störungen schon von Beginn an bestanden: „These children are not, properly speaking, abnormal, nor is the condition of many of them to be designated as in any way pathological. They deviate from the average of children only in being at a lower stage of individual development.“ (Witmer, 1907, S. 6). Die endgültige Verortung der Psychotherapie im Gesundheitswesen hat diese Idee, dass psychische Probleme keine Krankheiten seien, schlagartig erstickt. Mit völliger Selbstverständlichkeit gelten aggressive Kinder (Störung des Sozialverhaltens, F915 ), schüchterne Kinder (Störung mit sozialer Ängstlichkeit des Kindesalters, F93.2), zappelige Kinder (Hyperkinetische Störung, F90), einnässende Kinder (Enuresis, F98.0), Kinder mit einem defizitärem Zuhause, in dem keine festen Bindungen entstehen können (reaktive Bindungsstörung, F94.1), Kinder, die in manchen Kontexten nicht sprechen mögen (Elektiver Mutismus, F94.0) u.v.m., als „Kranke“, als „Patienten“. Dabei zeigen sie letztlich ein „normales“ Verhalten lediglich im Übermaß (Verhaltensexzess) oder in zu geringem Maß (Verhaltensdefizit). Das heißt, das Verhalten dieser „kranken“ Kinder entspricht qualitativ dem Verhalten „gesunder“ Kinder, der Unterschied liegt in der Quantität.6 Welchen inhaltlichen Grund sollte es also für die Pathologisierung abweichender Kinder und Jugendlicher geben? Die meisten dieser „Störungen“ können gerade bei Kindern und Jugendlichen ebenso gut als „Entwicklungsstörungen“ betrachtet werden, deren Behebung also kein Gesundheitsproblem, sondern ein Problem der Entwicklungsförderung und der Veränderung von Entwicklungsbedingungen ist. Gerade Kinder haben diesbezüglich noch weniger Definitionsmacht über ihre eigenen Probleme als Erwachsene. Die Eltern, die Probleme mit ihren Kindern erleben, führen sie Institutionen zu, die sie anschließend als „krank“ klassifizieren. Während Erwachsene dies aus eigenem Antrieb und in der Regel mit voller Einsicht selber tun, werden Kinder von anderen „krank gemacht“. zu „gesundem“ menschlichen Verhalten gesehen werden kann, also etwa einer Schizophrenie (F20), deren typische Symptome (z.B. Gedankenlautwerden, Halluzinationen, bizarre Wahnvorstellungen) bei nicht Betroffenen nicht in geringerem Maße auftreten, sondern gar nicht. Es sei darauf hingewiesen, dass die hier aufgeworfene Frage im Wesentlichen keine „objektiven“ Unterschiede betrifft. Ob eine Störung „Krankheitswert“ besitzt, ist nicht abhängig von der Art und kaum abhängig von der Schwere eines Problems, es ist eine Frage der (Re-)Konstruktion eines Phänomens durch einen Beobachter. Das gleiche Kind mit dem gleichen Verhalten kann problemlos entweder als „aggressiv“ bezeichnet oder mit der Diagnose einer „Störung des Sozialverhaltens“ belegt werden. Keine dieser Bezeichnungen ist falsch, beide sind gleich richtig und können gleichzeitig benutzt werden. Aber nur die zweite Bezeichnung eröffnet die Möglichkeit, die Verhaltensänderung im Rahmen des Gesundheitssystems finanzieren zu lassen. Ist ein solches Kind aber wirklich „krank“? Nach dem Psychotherapeutengesetz wird die Durchführung von Maßnahmen, die der Überwindung sozialer Konflikte dienen, nicht als heilkundliche Psychotherapie verstanden. Was aber ist die Therapie aggressiven, schüchternen oder mutistischen Verhaltens, in die im Falle der Kinder- und Jugendlichenpsychotherapie regelmäßig das soziale Umfeld miteinbezogen werden muss, anderes als eine Behandlung, die der Überwindung sozialer Konflikte dient? Ist bei einem jungen Menschen, der in weitgehender Abhängigkeit von seinen Bezugspersonen lebt und von diesen einer Therapeutin vorgestellt wird, überhaupt eine Behandlung denkbar, bei der es nicht in weiten Teilen um die Überwindung sozialer Konflikte geht? Die sozialen Systeme in Deutschland und in vielen anderen Ländern der Welt sind so organisiert, dass die Zuweisung eines „Falles“ zu einem bestimmten Teil des Sozialsystems vor allem für die Finanzierung dieses „Falles“ von Bedeutung ist. Vor diesem Hintergrund birgt die vorstehende Argumentation die Gefahr, dass Finanzverantwortliche, die weniger am Wohl der Betroffenen als an der Minderung von in ihrem Verantwortungsbereich entstehenden Kosten interessiert sind, die Argumente missbräuchlich benutzen, um die Finanzierung der Behandlung von Menschen mit psychischen Problemen zukünftig abzulehnen. Vor einem solchen Hintergrund machen aber die hier genannten Argumentationsfiguren keinen Sinn. Die Argumente betreffen fachliche Fragen und nicht Fragen der Zuweisung einer Problemlösung zu einem bestimmten Kostenträger. Darüber hinaus „stimmen“ ja die Diagnosen nach ICD-10; sind jeweils spezifische Kriterien erfüllt, kann nach diesem offiziellen Klassifikationssystem der Weltgesundheitsorganisation (WHO) eine bestimmte Diagnose gestellt werden – und damit ist der „Krankheitswert“ der Problematik bestätigt. Die schon zur Zeit zweifelsfrei bestehende Unterversorgung im Bereich psychotherapeutischer Behandlung vor allem von Kindern und Jugendlichen noch weiter zu verschärfen, wäre für Betroffene im Einzelfall katastrophal und gesamtgesellschaftlich völlig absurd. Hier sind fachliche Diskussionen und sozialpolitische Gestaltungen gefragt, die letztlich die bestmögliche Versorgung der betroffenen Kinder, Jugendlichen und Familien sicherstellen sollen. Auf welche Weise dies zu bewerkstelligen ist, wird nur dann herauszufinden sein, wenn das Wohl der Betroffenen und damit mittelbar auch die zukünftige Entwicklung der Gesellschaft im Focus der Aufmerksamkeit steht. Die Betrachtung psychischer Probleme auch als Entwicklungs- und Beziehungsdefizite legt jedenfalls nahe, die Durchführung von Psychotherapie auch in Einrichtungen außerhalb des Gesundheitswesens weiter (und verstärkt) zu fördern und generell – auch im Rahmen der Therapiedurchführung in niedergelassener Praxis – durch geeignete Richtlinien und Vergütungsvorgaben eine umfassende Behandlung zu ermöglichen, in der Haus- und Schulbesuche, familientherapeutische Vorgehensweisen, Sozialberatung, begleitende Elternberatung oder -therapie sowie die Einzel- und/oder Gruppentherapie mit den Kindern ihren Platz haben. 1 „During the last ten years the laboratory of psychology at the University of Pennsylvania has conducted, under my direction, what I have called ‚a psychological clinic’.“ (Witmer, 1907, S. 1). 2 Die Experimente von Watson und Rayner, bei denen sie die Möglichkeiten klassischer Konditionierung am „kleinen Albert“ demonstrierten, indem sie bei ihm eine Phobie vor Stofftieren erzeugten, müssen aus ethischen Gründen heute abgelehnt werden. Sie stellen auch keine therapeutische Intervention dar (das Symptom wurde ja erst erzeugt), aber sie demonstrieren die Umsetzbarkeit der Lerngesetze in der Arbeit mit Kindern. Mary Cover Jones hingegen führte 1924 eine erfolgreiche Desensibilisierungsbehandlung zur Überwindung einer phobischen Angst durch. Inhaltsverzeichnis
I Einführung
II Diagnostische Methoden II.1 Das Explorationsgespräch mit Kindern II.2 Das Explorationsgespräch mit Eltern II.3 Informationsgewinnung durch weitere Beteiligte II.4 Verhaltensbeobachtung II.5 Testdiagnostik II.6 Diagnostische Hausaufgaben / Selbstbeobachtung II.7 Zielklärung III Verhaltenstherapeutische Interventionsmethoden III.1 Rollenspiel III.2 Entspannungsverfahren III.3 Systematische Desensibilisierung III.4 Konfrontation und Reaktionsverhinderung III.5 Operante Verfahren III.6 Modelllernen III.7 Rationale Disputation III.8 Selbstinstruktionsmethoden III.9 Problemlösetraining IV Komplexe verhaltenstherapeutische Trainings IV.1 Trainings des Sozialverhaltens IV.2 Patiententrainings IV.3 Stressbewältigungstrainings IV.4 Konzentration- und Aufmerksamkeitstrainings IV.5 Verhaltenstherapeutische Eltern- Kind-Therapie IV.6 Elterntrainings V Kinder- und Jugendlichenverhaltenstherapie in Kombination mit anderen Verfahren V.1 Verhaltenstherapie und Systemische Therapie V.2 Hypnose in der Kinder- und Jugendlichenverhaltenstherapie V.3 Verhaltenstherapie und Spieltherapie V.4 Verhaltenstherapie und Pharmakotherapie VI Ausblick |
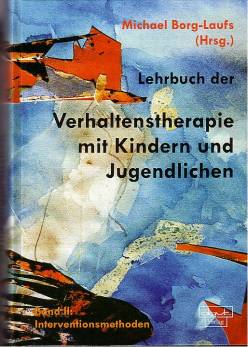
 Bei Amazon kaufen
Bei Amazon kaufen