|
|
|
Umschlagtext
Kommunikationspsychologie befasst sich mit der Kommunikation zwischen unterschiedlich komplexen personalen und sozialen Systemen. Das Lehrbuch behandelt die individuellen Voraussetzungen der interpersonalen Kommunikation, die Kommunikation zwischen zwei oder mehreren einzelnen Personen die Kommunikation innerhalb von Gruppen (Gruppenkommunikation), die Kommunikation zwischen Gruppen (Intergruppen-Kommunikation) sowie die interkulturelle Kommunikation aus psychologischer Perspektive. Insgesamt ist die Struktur der »Einführung in die Kommunikationspsychologie« von Wolfgang Frindte ausgiebig erweitert, z.B. durch Social-Media-Kommunikation, und durch hilfreiche didaktische Elemente veranschaulicht worden.
Rezension
Themen dieses Lehrbuchs sind:individuelle Voraussetzungen der interpersonalen Kommunikation, Kommunikation zwischen zwei oder mehreren einzelnen Personen (Interpersonale Kommunikation), Kommunikation innerhalb von Gruppen (Gruppenkommunikation), Kommunikation zwischen Gruppen (Intergruppen-Kommunikation), interkulturelle Kommunikation und mediale Kommunikation.
Schule und Lehrerberuf haben sehr viel mit Kommunikation zu tun. Insofern ist Kommunikationspsychologie für Lehrkräfte von grundlegender Bedeutung. Kommunikation ist nicht nur die Brücke zwischen den einzelnen menschlichen Individuen, sondern auch Quelle und Triebkraft menschlicher Entwicklung. Kommunikation ist eine Conditio sine qua non menschlichen Lebens und gesellschaftlicher Ordnung. Man kann - in der klassischen Formulierung Paul Watzlawicks ("Menschliche Kommunikation") - „nicht nicht kommunizieren". Der Mensch beginnt von den ersten Tagen seines Lebens an die Regeln der Kommunikation zu erlernen, obwohl diese Regeln selbst ihm kaum jemals bewusst werden. Durch gemeinschaftsspezifische Muster des Interpretierens und Kommunizierens grenzen sich soziale Gemeinschaften von ihren Umwelten ab, schaffen eine Grenze zwischen dem Innen und dem Außen ihrer Wirklichkeiten. Und: Interindividuelle Kommunikation, also die Kommunikation zwischen einzelnen Personen, Intergruppen-Kommunikation sowie interkulturelle Kommunikation sind vermittelt, mediiert. Es gibt keine Kommunikation zwischen Menschen, die ohne Medium auskommt. Die verschiedenen Phänomene des kommunikativen Austauschs von Menschen, die psychologischen Grundlagen dieses Austausches und die Bezüge zu anderen wissenschaftlichen Disziplinen sind der Gegenstand dieses Buches. Es handelt sich um eine grundlegende Überarbeitung der „Einführung in die Kommunikationspsychologie“, die im Jahre 2001 erschienen ist. Jens Walter, lehrerbibliothek.de Verlagsinfo
Schlagwörter: Psychologie | Kommunikation | Interkulturalität | Gruppe | Medien Kategorien: Pädagogik Kommunikation & Präsentation Psychologie Lehrbücher Training/ Weiterbildung Kommunikation/ Moderation/ Rhetorik Erziehungs- und Sozialwissenschaften Lehrbücher Inhaltsverzeichnis
Ziel und Aufbau des Lehrbuches 11
Kapitel 1 „Wir kommunizieren, also bin ich“. Kommunikationspsychologie – ein Versuch der Verortung 15 1.1 Am Anfang: Witze 16 1.2 Kommunikation ist Kommunikation: Ein Beispiel 19 1.3 Was ist Kommunikation – Definitionsprobleme 21 1.3.1 Kommunikations-Metaphern 21 1.3.2 Individual- und Massenkommunikation 29 1.3.3 Mediierte oder nichtmediierte Kommunikation? 31 1.4 Kommunikationspsychologie – Versuch einer Gegenstandsbestimmung 35 Kapitel 2 Prolegomena zu einer Geschichte der Kommunikationspsychologie. Kurze Geschichte und lange Vergangenheit 37 2.1 Zur Geschichte der Kommunikation 37 2.2 Vorwissenschaftliche Beispiele 45 2.3 Antike: Platon und Aristoteles 47 2.4 Mittelalter: Avicenna und die Scholastik als Beispiel 51 2.5 Renaissance: 1400 bis 1600 – Thomas Morus, Francis Bacon und andere 54 2.6 Aufklärung: 17. und 18. Jahrhundert – Von der Seelenkur zur Psychologischen Kur 58 2.7 19. Jahrhundert: Aufbruch in die Moderne 61 2.8 Das Ende einer schönen Zeit: Das frühe 20. Jahrhundert und Auswirkungen bis zur Jahrhundertmitte 67 Kapitel 3 Wissenschaftstheoretische Grundlagen 74 3.1 Paul Feyerabend und der Theorien- und Methodenpluralismus 74 3.2 Über das Finden und Validieren (kommunikations-)psychologischer Theorien 77 3.3 Fazit 82 Kapitel 4 Theoretische Grundlagen 85 4.1 Was sind (kommunikations-)psychologische Theorien? 85 4.2 Kommunikationspsychologische Theorien 90 4.3 Vier allgemeine Theorien 96 4.3.1 Der Symbolische Interaktionismus 97 4.3.2 Die Theorie des kommunikativen Handelns 100 4.3.3 Kommunikation in Luhmanns Theorie selbstreferentieller Systeme 102 4.3.4 Der Social Constructionism – oder: Woher kommen unsere Metaphern? 104 4.4 Ein Versuch über gelingende Kommunikation – eine Verunsicherung 108 4.5 Zwischenmenschliche Kommunikation – ein Prozess mit vielen Komponenten 113 4.6 Zusammenfassung und Schlussfolgerungen: Die Ebenen der Konstruktion und Kommunikation von Wirklichkeit 118 Kapitel 5 Individuelle Hintergründe von Kommunikation – Wer kommuniziert wie? Ausgewählte Phänomene und Theorien 121 5.1 Aktuelles 122 5.2 Ein Modell der interpersonalen Kommunikationen als Wegweiser 122 5.3 Persönlichkeit, Persönlichkeitseigenschaften und kommunikatives Verhalten 125 5.4 Empirische Evidenzen: Big Five, Facebook und andere Merkwürdigkeiten 130 5.5 Emotion in der Kommunikation 133 5.5.1 Begriff und Funktionen 133 5.5.2 Emotionstheorien 136 5.5.3 Emotionale Intelligenz 138 5.5.4 Empirische Evidenzen: Soziale Ansteckung und andere Auffälligkeiten 139 5.6 Kognitionen 141 5.6.1 Begriff 142 5.6.2 Daniel Kahneman und die Metapher von zwei Systemen 144 5.6.3 Automatisches und bewusstes Verarbeiten sozialer Botschaften 146 5.6.4 Heuristiken und Kognitive Faustregeln 151 5.6.5 Vom Vermeiden kognitiver Dissonanzen (Festinger, 1957) 154 5.7 Auf der Suche nach Ursachen – Attributionen 158 5.7.1 Ein Einstieg: „Der propere Ganter“ von James Thurber 158 5.7.2 Begriff und klassische Theorien 159 5.8 Einstellungen 163 5.8.1 Begriff, Geschichte, Struktur und Funktion 163 5.8.2 Einstellung und Verhalten 168 5.8.3 Explizite und implizite Einstellungen 173 5.8.4 Komplexe Datenanalyse oder schematische Beurteilung der Kommunikationssituation – das Modell der Elaborationswahrscheinlichkeit (ELM) 175 5.9 Generalisierte Einstellungen: Alte und neue „Radfahrer“ 180 5.9.1 Autoritäre Überzeugungen 180 5.9.2 Soziale Dominanzorientierung 182 5.9.3 Zwischenfazit 183 5.10 Evidenzen: Einstellung und Kommunikation 184 5.11 Zusammenfassung und Schlussfolgerungen 191 Kapitel 6 Kommunikation als interaktives Geschehen – Wer kommuniziert mit wem in welcher Weise? 193 6.1 Blicke zurück 194 6.1.1 Die Lasswell-Formel und Karl Bühlers Sprachtheorie 194 6.1.2 Paul Watzlawick und die Pragmatik der Kommunikation 198 6.1.3 Das Kommunikationsquadrat von Schulz von Thun 201 6.1.4 Zwischenfazit 204 6.2 Selbstoffenbarung und Selbstdarstellung 205 6.2.1 Selbstoffenbarung bzw. Self Disclosure 206 6.2.2 Impression Management 210 6.2.3 Zwischenfazit 216 6.3 Nonverbale Kommunikation 217 6.3.1 Historisches 217 6.3.2 Was heißt nonverbal? 219 6.3.3 Was unterscheidet nonverbale von verbalen Kommunikationszeichen? 222 6.3.4 Funktionen nonverbaler Kommunikation 223 6.3.5 Universalität versus kulturelle Spezifik von nonverbalen Kommunikationszeichen 229 6.3.6 Evidenzen: Chamäleon-Effekt, interindividuelle Unterschiede in der nonverbalen Kommunikation, Embodiment 231 6.3.7 Statt eines Fazits 235 6.4 Sprachliche Kommunikation 236 6.4.1 Konversationslogischer Ansatz 237 6.4.2 Das Linguistische Kategorienmodell 239 6.4.3 Evidenzen: Empirische Belege für das Linguistische Kategorienmodell 243 6.5 Schlussfolgerungen 245 Kapitel 7 Kommunikation als Gruppengeschehen 250 7.1 Blicke zurück: Walter Moede und andere 250 7.2 Formelle und informelle Kommunikationsstrukturen 252 7.3 Gruppen als Kommunikationssysteme 258 7.3.1 Gruppenspezifische Kommunikation 259 7.3.2 Gruppenspezifische Wirklichkeitskonstruktionen 262 7.3.3 Gruppenspezifische Emotionen 264 7.3.4 Gruppennormen und Rangstrukturen 265 7.3.5 Gruppenentwicklung, Gruppendenken, Gruppenpolarisation 269 7.4 Evidenzen: Ostrazismus, soziales Faulenzen, soziale Erleichterung 276 7.5 Fazit 283 Kapitel 8 Kommunikation als Intergruppengeschehen 285 8.1 Aktuelles 285 8.2 Blicke zurück: Stanley Milgram und Philip Zimbardo 286 8.3 Interpersonale und Intergruppen-Kommunikation 291 8.4 Theorie der Sozialen Identität und Theorie der Selbstkategorisierung 294 8.5 Sozialer Wandel durch Minoritäten 303 8.5.1 Sozialer Einfluss und Konformität 303 8.5.2 Ein Experiment von Solomon Asch 304 8.5.3 Minderheiten sind die Mehrheiten der nächsten Generation 307 8.5.4 Vorläufiges Fazit 309 8.6 Evidenzen: Stereotype, Vorurteile, Eigengruppenprojektion, Linguistischer Intergroup Bias 311 Kapitel 9 Interkulturelle Kommunikation 319 9.1 Aktuelles 319 9.2 Blicke zurück: In Weimar auf dem Beethoven-Platz 320 9.3 Kultur 323 9.3.1 Begrifflichkeiten 323 9.3.2 Kulturelle Praktiken 325 9.3.3 Interkulturelle Missverständnisse 327 9.4 Worin unterscheiden sich Kulturen und die Mitglieder verschiedener Kulturen? 328 9.4.1 Die Kulturtheorie von Geert Hofstede 328 9.4.2 Kritik an Hofstede und alternative Modelle 331 9.4.3 Zwischenfazit 335 9.5 Wenn Kulturen in Kontakt kommen 335 9.5.1 Akkulturation 335 9.5.2 Akkulturationsstrategien – John W. Berry 336 9.5.3 Erweiterungen von Berrys Modell 338 9.5.4 Bedrohungswahrnehmungen 341 9.5.5 Kulturschock: Ein Exkurs 342 9.6 Diversität, interkulturelle Kompetenz und interkulturelles Training 344 9.7 Evidenzen: Beispiel 346 Kapitel 10 Kommunikation mit Massenmedien 349 10.1 Aktuelles: Mediennutzung zwischen Lügenpresse und Sozialisationsinstanzen 349 10.2 Blicke zurück: Stimulus-Response und Zwei-Stufen-Fluss 354 10.3 Medienhandeln 360 10.3.1 Medienwahl 361 10.3.2 Mediennutzung 364 10.3.3 Medienwirkung 370 10.3.4 Mediengewalt 381 10.3.5 Zwischenfazit 392 10.4 Evidenzen: Medien und Einstellungen gegenüber dem Islam, Mediengewalt und aggressives Verhalten 393 Kapitel 11 Soziale Medien als Bühne des 21. Jahrhunderts 398 11.1 Blicke zurück: Die Vernetzung von Rechnern, Menschen und Dingen 399 11.2 Computervermittelte Kommunikation 400 11.3 Von digitaler Demenz und anderen Mythen: Macht das Internet uns wirklich krank, faul und gewalttätig? 405 11.4 Ein Exkurs: Aggression und Gewalt auf dem Desktop 407 11.5 Das Mitmach-Internet – Soziale Medien und soziale Netzwerke 410 11.6 Soziale Medien als Informationsquelle 411 11.7 Facebook als Meeting Point, Informationsplattform und Datenquelle 414 11.8 Facebook, Persönlichkeit und Cambridge Analytica 416 11.9 Twitter und Twitterisierung 419 11.10 Flaming, Shitstorms und Trolling 421 11.11 Filterblasen und Echokammern 426 11.12 Ausblick und Abschluss: Von Menschen, Internet und autopoietischen Systemen 430 Kapitel 12 Communicamus ergo sum! 433 Autorenhinweise 435 Literaturverzeichnis 437 Personenregister 486 Sachregister 497 |
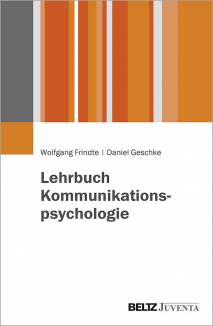
 Bei Amazon kaufen
Bei Amazon kaufen