|
|
|
Umschlagtext
In diesem internationalen Standardwerk zur Klinischen Psychologie werden alle wichtigen psychischen Störungen behandelt. Durch die verständliche Darstellung komplexer theoretischer Grundlagen und empirischer Belege, aber auch wegen seiner sehr anschaulichen Fallbeispiele und Übungsfragen eignet sich das Buch hervorragend als Einstieg in die Materie. Die Kapitel
folgen dabei einer einheitlichen Struktur: Diagnostik - Ursachen - Therapie. Fragen nach gesellschaftlichen Einstellungen zu psychischen Störungen, juristischen Aspekten und bislang ungelösten Problemen spielen dabei eine tragende Rolle Für die deutsche Ausgabe wurden die diagnostischen Kriterien nach DSM-IV um die ICD-10-Kriterien ergänzt und zusätzliche Fallbeispiele eingearbeitet. Weiter entsprechend der Verlagsinformation Rezension
Ist das noch im Rahmen des Normalen, oder krankhaft? Wächst sich das raus oder braucht er professionelle Hilfe? Oft ist es schwer zu entscheiden, ob die Verhaltensauffälligkeit eines Schülers auf eine seelische Erkrankung zurückgeht ober ob es sich um eine vorübergehendes Problem handelt, das auch ohne professionelle Begleitung in den Griff zu bekommen ist.
Der vorliegende Band, die Übersetzung eines Standartwerks aus den USA behandelt ausführlich den Bereich der seelischen Erkrankungen. Da der Band für den Studienanfänger, bzw. für das Bachelorstudium konzipiert ist, benötigt man keine besonderen Fachkenntnisse für die Lektüre. So ist der Band nicht nur für den Lehrer geeignet, sondern kann auch Schülern der Oberstufe für Referate, Seminararbeiten ... in die Hand gegeben werden. Der Stoff wird dabei sehr verständlich und motivierend dargeboten. Kästen mit Fallbeispielen, ermöglichen eine anschauliche Darstellung des Stoffes. Andere Kästen bieten Zusammenfassungen, Verständnisfragen, historische Rückblicke ... so dass man in diesem Buch auch sehr schön "schmökern" kann. Für denjenigen, der schnell Informationen sucht, ist auch der einheitliche Aufbau der Kapitel hilfreich. VPfueller, lehrerbibliothek.der Verlagsinfo
Dieses Buch gilt international als das umfassendste und aktuellste Lehrbuch der Klinischen Psychologie und liegt mittlerweile in der 13. Auflage vor. Die Autoren verfügen über langjährige Forschungs-, Lehr- und Praxiserfahrung an renommierten psychologischen Instituten. Dargestellt werden alle wichtigen psychischen Störungen. Die Kapitel folgen dabei einer einheitlichen Struktur: Diagnostik - Ursachen - Therapie. Angereichert werden sie durch zahlreiche Beispiele, Fallstudien und Anwendungen aus Forschung und klinischer Praxis. Fragen nach gesellschaftlichen Einstellungen zu psychischen Störungen, juristischen Aspekten und bislang ungelösten Problemen sind ebenfalls berücksichtigt. Für die deutsche Ausgabe wurden die diagnostischen Kriterien nach DSM-IV um die hierzulande verbindlichen ICD-10-Kriterien ergänzt und zusätzliche Fallstudien eingearbeitet. Inhalt 1. Klinische Psychologie: Einführung 2. Geschichte der Verhaltensforschung 3. Beurteilungskriterien 4. Klinische Diagnose 5. Stress- und Anpassungsstörungen 6. Panik- und Angststörungen 7. Depressive Störungen und Suizid 8. Somatoforme Störungen 9. Essstörungen und Fettleibigkeit 10. Gesundheit und Verhalten 11. Persönlichkeitsstörungen 12. Suchtverhalten 13. Sexuelle Störungen 14. Schizophrenie 15. Kognitionsstörungen 16. Störungen bei Kindern und Jugendlichen 17. Psychotherapie 18. Juristische und gesellschaftliche Aspekte 19. Anhang: Literaturhinweise, Glossar, Index Autoren James N. Butcher ist Professor am Institut für Psychologie an der University of Minnesota. Susan Mineka ist Professorin für Klinische Psychologie an der Northwestern University in Chicago. Jill M. Hooley ist Direktorin des Instituts für Klinische Psychologie an der Harvard University. Companion-Website Für Dozenten: Alle Abbildungen aus dem Buch elektronisch zum Download. Für Studenten: Multiple Choice-Tests, Klinische Fallstudien, Weiterführende Links. Inhaltsverzeichnis
Inhaltsverzeichnis
Vorwort zur amerikanischen Ausgabe xix Vorwort zur deutschen Ausgabe xxv Kapitel 1 Klinische Psychologie: Ein Überblick 1 1.1 Was genau ist eigentlich „abweichendes“ Verhalten? 5 1.1.1 Warum müssen wir psychische Störungen klassifizieren? 8 1.1.2 Welche Nachteile hat die Klassifikation? 9 1.1.3 Die Definition psychischer Störungen nach DSM-IV 10 1.1.4 Wie beeinflusst die Kultur, was als abweichendes Verhalten betrachtet wird? 12 1.1.5 Kulturspezifische Störungen 13 1.2 Wie häufig treten psychische Störungen auf? 14 1.2.1 Prävalenz und Inzidenz 15 1.2.2 Schätzungen der Prävalenz psychischer Störungen 15 1.2.3 Behandlung 17 1.2.4 Die ,,Profis“ für die Behandlung psychischer Störungen 18 1.3 Forschungsansätze in der Klinischen Psychologie 20 1.3.1 Informationsquellen 20 1.3.2 Die Bildung von Hypothesen über das Verhalten 22 1.3.3 Teilerhebung von Stichproben und Generalisierung auf die Population 23 1.3.4 Kriteriums- und Kontrollgruppen 24 1.3.5 Die Untersuchung der realen Welt 24 1.3.6 Retrospektive versus prospektive Strategien 25 1.3.7 Die Manipulation von Variablen: Experimentelle Studien in der Klinischen Psychologie 26 1.3.8 Die Untersuchung der Wirksamkeit von Therapien 27 1.3.9 Einzelfallstudien 28 1.3.10 Analogiestudien an Tieren 29 1.4 Das Ziel dieses Lehrbuches 30 Zusammenfassung 32 Kapitel 2 Historische und zeitgenössische Betrachtungsweisen abnormen Verhaltens 35 2.1 Historische Betrachtungsweisen abnormen Verhaltens 36 2.1.1 Dämonen, Götter undMagie 36 2.1.2 Die frühen medizinischen Vorstellungen des Hippokrates 37 2.1.3 Frühe philosophische Konzepte des Bewusstseins und der Erkenntnis 39 2.1.4 Spätere griechische und römische Betrachtungsweisen 40 2.1.5 Die Betrachtungsweise von Abnormalität im Mittelalter 41 2.2 Das Aufkommen humanitärer Behandlungsformen 44 2.2.1 Das Wiederaufkommen wissenschaftlichen Denkens in Europa 44 2.2.2 Die Gründung erster Irrenhäuser 45 2.2.3 Die humanitäre Reform 47 2.2.4 Sichtweisen psychischer Störungen und ihrer Behandlung im 19. Jahrhundert 51 2.2.5 Die Veränderung der Haltungen gegenüber der psychischen Gesundheit im frühen 20. Jahrhundert 52 2.2.6 Die Versorgung in den psychiatrischen Kliniken des 20. Jahrhunderts 52 2.3 Heutige Betrachtungsweisen abnormen Verhaltens 57 2.3.1 Biologische Entdeckungen: Die Verbindung zwischen dem Gehirn und psychischen Störungen 57 2.3.2 Die Entwicklung eines Klassifikationssystems 59 2.3.3 Kausale Betrachtungen: Die Entwicklung der psychologischen Ursache psychischer Störungen 59 2.3.4 Die Entwicklung der psychologischen Forschungstradition: Experimentalpsychologie 63 Zusammenfassung 69 Kapitel 3 Kausale Faktoren und Sichtweisen 73 3.1 Abweichendes Verhalten: Ursachen und Risikofaktoren 74 3.1.1 Notwendige, hinreichende und beitragende Ursachen 74 3.1.2 Rückkopplung und Zirkularität in abweichendem Verhalten 76 3.1.3 Diathese-Stress-Modelle 77 3.2 Sichtweisen der Ursachen abweichenden Verhaltens 80 3.3 Die biologische Sichtweise und biologische kausale Ursachen 81 3.3.1 Ungleichgewichte des Neurotransmitter- und Hormonhaushalts 81 3.3.2 Genetische Vulnerabilitäten 84 3.3.3 Temperament 90 3.3.4 Cerebrale Dysfunktion und neuronale Plastizität 91 3.3.5 Der Erkenntnisgewinn aus der biologischen Sichtweise 93 3.4 Die psychosozialen Sichtweisen 95 3.4.1 Die psychodynamischen Betrachtungsweisen 95 3.4.2 Die behavioristische Betrachtungsweise 102 3.4.3 Die kognitiv-behavioristische Betrachtungsweise 106 3.4.4 Was geschieht, wenn man sich eine bestimmte Betrachtungsweise zu eigen macht? 111 3.5 Psychosoziale kausale Faktoren 112 3.5.1 Deprivation oder Trauma im frühen Lebensalter 113 3.5.2 Nachteilige Erziehungsstile 117 3.5.3 Eheprobleme und Scheidung 120 3.5.4 Umgang mit sog. unangepassten Freunden und Bekannten 122 3.6 Die soziokulturelle Sichtweise 124 3.6.1 Die Aufdeckung soziokultureller Faktoren durch interkulturelle Studien 124 3.7 Soziokulturelle kausale Faktoren 128 3.7.1 Die soziokulturelle Umwelt 128 3.7.2 Pathogene gesellschaftliche Einflüsse 129 3.7.3 Der Einfluss der soziokulturellen Sichtweise 131 Zusammenfassung 133 Kapitel 4 Klinische Diagnostik 137 4.1 Grundelemente der klinischen Diagnostik 138 4.1.1 Bedeutung der Diagnosestellung 138 4.1.2 Die Erfassung der lebensgeschichtlichen Entwicklung und der Krankheitsanamnese 139 4.1.3 Der Einfluss der fachlichen Ausrichtung des Klinikers 140 4.1.4 Vertrauen und Einvernehmen in der Kliniker-Patient-Beziehung 140 4.2 Die Untersuchung des Organismus 141 4.2.1 Die allgemeine körperliche Untersuchung 141 4.2.2 Die neurologische Untersuchung 142 4.2.3 Die neuropsychologische Untersuchung 145 4.3 Die psychosoziale Diagnostik 145 4.3.1 Klinische Interviews 147 4.3.2 Klinische Verhaltensbeobachtung 148 4.3.3 Psychodiagnostische Tests 151 4.3.4 Vorzüge und Grenzen psychometrischer Persönlichkeitstests 160 4.3.5 Eine psychologische Fallstudie: Esteban 163 4.4 Die Integration verschiedener diagnostischer Daten 165 4.4.1 Ethische Fragen der Diagnostik 166 4.5 Die Klassifikation abweichenden Verhaltens 167 4.5.1 Reliabilität und Validität 168 4.5.2 Unterschiedliche Klassifikationsmodelle 169 4.5.3 Formale diagnostische Klassifikation psychischer Störungen 170 Zusammenfassung 177 Kapitel 5 Stress und Anpassungsstörungen 179 5.1 Was ist Stress? 180 5.1.1 Kategorien von Stressoren 180 5.1.2 Auslösende Bedingungen und Wirkmechanismen 183 5.1.3 Bewältigung von Stress 187 5.2 Die Auswirkungen von schwerem Stress 188 5.2.1 Biologische Auswirkungen von Stress 189 5.2.2 Psychische Auswirkungen von lang andauerndem Stress 192 5.3 Anpassungsstörungen: Reaktionen auf entscheidende Lebensveränderungen oder belastende Lebensereignisse 193 5.3.1 Anpassungsstörungen durch Arbeitslosigkeit 193 5.3.2 Anpassungsstörungen durch Trauer 194 5.3.3 Anpassungsstörungen durch Scheidung oder Trennung 195 5.4 Posttraumatische Belastungsstörung: Reaktionen auf extrem belastende Ereignisse 196 5.4.1 Die Prävalenz der PTBS in der allgemeinen Bevölkerung 196 5.4.2 Die Unterscheidung zwischen der akuten Belastungsreaktion und der posttraumatischen Belastungsstörung 197 5.4.3 Das Trauma einer Vergewaltigung 200 5.4.4 Das Trauma militärischer Konflikte 203 5.4.5 Schwere Bedrohungen der persönlichen Sicherheit und Unversehrtheit 206 5.4.6 Kausale Faktoren bei posttraumatischem Stress 210 5.4.7 Langfristige Auswirkungen von posttraumatischem Stress 212 5.5 Prävention und Behandlung von Belastungsstörungen 213 5.5.1 Prävention von Belastungsstörungen 213 5.5.2 Behandlung von Belastungsstörungen 213 5.5.3 Herausforderungen und Ergebnisse der Forschung zur Krisenintervention 216 Zusammenfassung 218 Kapitel 6 Panik- und Angststörungen 221 6.1 Reaktionsmuster von Furcht und Angst 223 6.2 Übersicht über verschiedene Angststörungen und deren Gemeinsamkeiten 225 6.3 Spezifische Phobien 226 6.3.1 Blut-Injektion-Verletzungs-Phobie 228 6.3.2 Alters- und geschlechtsbezogene Aspekte bei spezifischen Phobien 228 6.3.3 Psychosoziale Bedingungen 228 6.3.4 Genetische und temperamentsbezogene Bedingungen 232 6.3.5 Behandlung spezifischer Phobien 232 6.4 Soziale Phobien 234 6.4.1 Interaktion psychosozialer und biologischer Bedingungen 236 6.4.2 Behandlung sozialer Phobien 238 6.5 Panikstörung mit und ohne Agoraphobie 239 6.5.1 Panikstörung 239 6.5.2 Agoraphobie 241 6.5.3 Prävalenz, alters- und geschlechtsspezifische Aspekte bei Panikstörungen mit und ohne Agoraphobie 243 6.5.4 Komorbidität mit anderen Störungen 244 6.5.5 Der Zeitpunkt der ersten Panikattacke 244 6.5.6 Biologische Bedingungen 245 6.5.7 Verhaltensbezogene und kognitive Bedingungen 247 6.5.8 Die Behandlung von Panikstörung und Agoraphobie 251 6.6 Generalisierte Angststörung 254 6.6.1 Allgemeine Merkmale 254 6.6.2 Prävalenz und Alter bei Ausbruch 256 6.6.3 Komorbidität mit anderen Störungen 256 6.6.4 Psychosoziale Bedingungen 256 6.6.5 Biologische Bedingungen 260 6.6.6 Die Behandlung der generalisierten Angststörung 261 6.7 Zwangsstörung 262 6.7.1 Prävalenz, Alter bei Ausbruch und Komorbidität 263 6.7.2 Merkmale der Zwangsstörung 264 6.7.3 Psychosoziale Bedingungen 267 6.7.4 Biologische Bedingungen 269 6.7.5 Behandlung der Zwangsstörung 271 6.8 Soziokulturelle Aspekte von Angststörungen 273 Zusammenfassung 275 Kapitel 7 Affektive Störungen und Suizid 277 7.1 Was sind affektive Störungen? 278 7.1.1 Die Prävalenz affektiver Störungen 280 7.2 Unipolare affektive Störungen 281 7.2.1 Depressionen, die keine affektiven Störungen sind 281 7.2.2 Dysthymie 282 7.2.3 Major Depression 284 7.3 Entstehungsbedingungen bei unipolaren affektiven Störungen 289 7.3.1 Biologische Faktoren 289 7.3.2 Psychosoziale Bedingungen 294 7.4 Bipolare Störungen 309 7.4.1 Die zyklothyme Störung 309 7.4.2 Bipolar-I- und Bipolar-II-Störung 311 7.5 Bedingungsfaktoren bei bipolaren Störungen 314 7.5.1 Biologische Bedingungsfaktoren 314 7.5.2 Psychosoziale Bedingungsfaktoren 316 7.6 Soziokulturelle Faktoren mit Einfluss auf unipolare und bipolare Störungen 318 7.6.1 Kulturspezifische Unterschiede in der Symptomatik der Depression 318 7.6.2 Kulturspezifische Unterschiede in der Prävalenz 319 7.6.3 Demographische Unterschiede am Beispiel der USA 319 7.7 Behandlungsformen und Therapieerfolge 320 7.7.1 Pharmakologische Behandlung 321 7.7.2 Alternative biologische Behandlungen 323 7.7.3 Psychotherapie 324 7.8 Der Suizid 327 7.8.1 Merkmale und Hintergründe suizidalen Verhaltens 328 7.8.2 Suizidale Ambivalenz 333 7.8.3 Suizidprävention und -intervention 334 Zusammenfassung 335 Kapitel 8 Somatoforme und dissoziative Störungen 337 8.1 Somatoforme Störungen 338 8.1.1 Hypochondrie 339 8.1.2 Somatisierungsstörung 342 8.1.3 Schmerzstörung 345 xi Inhaltsverzeichnis 8.1.4 Konversionsstörung 346 8.1.5 Körperdysmorphe Störung 352 8.2 Dissoziative Störungen 357 8.2.1 Depersonalisationsstörung 357 8.2.2 Dissoziative Amnesie und dissoziative Fugue 359 8.2.3 Dissoziative Identitätsstörung 361 8.2.4 Allgemeine soziokulturelle Bedingungen bei dissoziativen Störungen 371 8.2.5 Behandlungsformen und Therapieerfolge bei dissoziativen Störungen 372 Zusammenfassung 374 Kapitel 9 Essstörungen und Adipositas 377 9.1 Klinische Aspekte von Essstörungen 379 9.1.1 Anorexia nervosa 379 9.1.2 Bulimia nervosa 382 9.1.3 Lebensalter beim Ausbruch der Störung und geschlechtsspezifische Unterschiede 387 9.1.4 Medizinische Komplikationen von Anorexia nervosa und Bulimia nervosa 387 9.1.5 Andere Formen von Essstörungen 388 9.1.6 Die diagnostische Unterscheidung zwischen den einzelnen Essstörungen 389 9.1.7 Zusammenhänge von Essstörungen mit anderen Formen der Psychopathologie 389 9.1.8 Die Prävalenz von Essstörungen 390 9.1.9 Essstörungen im Kulturvergleich 391 9.1.10 Verlauf und Genesung 392 9.2 Risiko- und Bedingungsfaktoren bei Essstörungen 393 9.2.1 Biologische Faktoren 393 9.2.2 Soziokulturelle Faktoren 394 9.2.3 Familiäre Einflüsse 396 9.2.4 Individuelle Risikofaktoren 397 9.3 Die Behandlung von Essstörungen 401 9.3.1 Die Behandlung von Anorexia nervosa 402 9.3.2 Die Behandlung von Bulimia nervosa 404 9.3.3 Die Behandlung der Binge-Eating-Störung 405 9.4 Adipositas 406 9.5 Risiko- und Bedingungsfaktoren bei Adipositas 407 9.5.1 Genetische Einflüsse 407 9.5.2 Hormonelle Regulierung von Appetit und Gewichtszunahme 407 9.5.3 Soziokulturelle Einflüsse 408 9.5.4 Familiäre Einflüsse 408 9.5.5 Stress und „Trostessen“ 409 9.5.6 Wege zur Adipositas 410 9.5.7 Die Behandlung von Adipositas 410 9.5.8 Die Wichtigkeit präventiver Maßnahmen 413 Zusammenfassung 414 Kapitel 10 Gesundheitsverhalten und Krankheit 417 10.1 Psychische Faktoren mit Einfluss auf Gesundheit und Krankheit 421 10.1.1 Stress und die Stressreaktion 421 10.1.2 Stress und das Immunsystem 422 10.1.3 Psychoneuroimmunologie 425 10.1.4 Lebensstilbezogene Faktoren mit Einfluss auf Gesundheit und Krankheit 427 10.1.5 Gesundheit, Krankheit und Coping-Ressourcen 427 10.2 Die kardiovaskuläre Erkrankung 430 10.2.1 Hypertonie 430 10.2.2 Die koronare Herzkrankheit (KHK) 433 10.2.3 Welche psychischen Faktoren sind an der koronaren Herzkrankheit beteiligt? 433 10.3 Allgemeine kausale Bedingungen bei körperlichen Erkrankungen 438 10.3.1 Genetische Faktoren 438 10.3.2 Psychosoziale Faktoren 439 10.3.3 Soziokulturelle Faktoren 442 10.4 Behandlungsformen und Therapieerfolge 442 10.4.1 Biologische Interventionen 443 10.4.2 Psychologische Interventionen 443 10.4.3 Soziokulturelle Ansätze 446 Zusammenfassung 447 Kapitel 11 Persönlichkeitsstörungen 449 11.1 Klinische Merkmale von Persönlichkeitsstörungen 450 11.2 Probleme bei der Erforschung von Persönlichkeitsstörungen 452 11.2.1 Probleme bei der Diagnose von Persönlichkeitsstörungen 452 11.2.2 Probleme bei der Erforschung der Ursachen von Persönlichkeitsstörungen 453 11.3 Kategorien von Persönlichkeitsstörungen 455 11.3.1 Paranoide Persönlichkeitsstörung 455 11.3.2 Schizoide Persönlichkeitsstörung 457 11.3.3 Schizotypische Persönlichkeitsstörung 459 11.3.4 Histrionische Persönlichkeitsstörung 461 11.3.5 Narzisstische Persönlichkeitsstörung 463 11.3.6 Antisoziale Persönlichkeitsstörung 466 11.3.7 Borderline-Persönlichkeitsstörung 466 11.3.8 Vermeidend-selbstunsichere Persönlichkeitsstörung 470 11.3.9 Dependente Persönlichkeitsstörung 472 11.3.10 Zwanghafte Persönlichkeitsstörung 475 11.3.11 Provisorische Kategorien von Persönlichkeitsstörungen im DSM-IV-TR 476 11.3.12 Allgemeine soziokulturelle Bedingungen für Persönlichkeitsstörungen 477 11.4 Behandlungsformen und Therapieerfolge 477 11.4.1 Die Anpassung therapeutischer Techniken an bestimmte Persönlichkeitsstörungen 477 11.4.2 Die Behandlung der Borderline-Persönlichkeitsstörung 478 11.4.3 Die Behandlung anderer Persönlichkeitsstörungen 479 11.5 Antisoziale Persönlichkeitsstörung 480 11.5.1 „Psychopathie“ und antisoziale Persönlichkeitsstörung 480 11.5.2 Das klinische Erscheinungsbild bei antisozialer Persönlichkeitsstörung 481 11.5.3 Bedingungen bei antisozialer Persönlichkeitsstörung 481 11.5.4 Eine entwicklungsbezogene Sichtweise von antisozialer Persönlichkeitsstörung 482 11.5.5 Behandlungsformen und Therapieerfolge bei antisozialer Persönlichkeitsstörung 484 Zusammenfassung 488 Kapitel 12 Abhängigkeitsstörungen 491 12.1 Alkoholmissbrauch und Alkoholabhängigkeit 493 12.1.1 Prävalenz, Komorbidität und Demographie von Alkoholmissbrauch und Alkoholabhängigkeit 493 12.1.2 Das klinische Erscheinungsbild von Alkoholmissbrauch und Alkoholabhängigkeit 496 12.1.3 Biologische Faktoren bei Missbrauch und Abhängigkeit von Alkohol und anderen Substanzen 500 12.1.4 Psychosoziale Bedingungen für Alkoholmissbrauch und Alkoholabhängigkeit 503 12.1.5 Soziokulturelle Faktoren 508 12.1.6 Die Behandlung von Alkoholmissbrauch und Alkoholabhängigkeit 509 12.2 Drogenmissbrauch und Drogenabhängigkeit 517 12.2.1 Opium und seine Derivate (Narkotika) 517 12.2.2 Kokain und Amphetamine (Stimulanzien) 523 12.2.3 Barbiturate (Sedativa) 528 12.2.4 LSD und verwandte Substanzen (Halluzinogene) 529 12.2.5 Ecstasy 531 12.2.6 Marihuana 532 Zusammenfassung 537 Kapitel 13 Sexuelle Varianten, sexueller Missbrauch und sexuelle Funktionsstörungen 539 13.1 Soziokulturelle Einflüsse auf sexuelle Praktiken und Normen 541 13.1.1 Beispiel 1: Degenerations- und Abstinenztheorie 542 13.1.2 Beispiel 2: Ritualisierte Homosexualität in Melanesien 543 13.1.3 Beispiel 3: Homosexualität und die US-amerikanische Psychiatrie 543 13.2 Sexuelle Varianten und Geschlechtsidentitätsstörungen 547 13.2.1 Paraphilien 547 13.2.2 Bedingungen und Behandlungen von Paraphilien 555 13.2.3 Geschlechtsidentitätsstörungen 555 13.3 Sexualisierte Gewalt 558 13.3.1 Sexualisierte Gewalt gegen Kinder 558 13.3.2 Pädosexualität („Pädophilie“) 559 13.3.3 Inzest 561 13.3.4 Vergewaltigung 561 13.3.5 Behandlung und Rückfallquoten bei Sexualstraftätern 564 13.4 Sexuelle Funktionsstörungen 568 13.4.1 Störungen der sexuellen Appetenz 570 13.4.2 Störungen der sexuellen Erregung 571 13.4.3 Orgasmusstörungen 574 13.4.4 Störungen mit sexuell bedingten Schmerzen 576 Zusammenfassung 577 Kapitel 14 Schizophrenie und andere psychotische Störungen 579 14.1 Schizophrenie 580 14.1.1 Die Epidemiologie der Schizophrenie 581 14.1.2 Ursprünge des Konstrukts „Schizophrenie“ 582 14.2 Das klinische Zustandsbild der Schizophrenie 583 14.2.1 Wahnvorstellungen 583 14.2.2 Halluzinationen 584 14.2.3 Desorganisiertes Sprechen 585 14.2.4 Desorganisiertes und katatonisches Verhalten 586 14.2.5 Negativsymptome 586 14.3 Subtypen der Schizophrenie 588 14.3.1 Der paranoide Typus 588 14.3.2 Der desorganisierte Typus 589 14.3.3 Der katatone Typus 590 14.3.4 Der undifferenzierte Typus 591 14.3.5 Der residuale Typus 592 14.3.6 Andere psychotische Störungen 592 14.4 Was verursacht Schizophrenie? 595 14.4.1 Genetische Aspekte 595 14.4.2 Pränatale Einflüsse 603 14.4.3 Die Bedeutung von genetischer Ausstattung und Umweltbedingungen für die Entstehung von Schizophrenie: eine Synthese 604 14.4.4 Eine entwicklungsneurobiologische Perspektive 605 14.4.5 Hirnanatomische Aspekte 607 14.4.6 Neurokognition 615 14.4.7 Psychosoziale und kulturelle Aspekte 616 14.5 Behandlungsformen und Therapieerfolge 622 14.5.1 Pharmakologische Behandlungsansätze 623 14.5.2 Psychosoziale Behandlungsansätze 624 Zusammenfassung 630 Kapitel 15 Kognitive Störungen 633 15.1 Hirnorganische Schädigungen bei Erwachsenen 635 15.1.1 Probleme bei der Kategorisierung 635 15.1.2 Klinische Anzeichen von Hirnschädigungen 636 15.1.3 Diffuse versus fokale Läsionen 637 15.1.4 Die Interaktion zwischen neuropsychologischen Störungen und Psychopathologie 640 15.2 Delir 641 15.2.1 Behandlungsformen und Therapieerfolg 642 15.3 Demenz 642 15.3.1 Alzheimer-Krankheit 643 15.3.2 Demenz aufgrund einer HIV-Erkrankung 652 15.3.3 Vaskuläre Demenz 654 15.4 Amnestisches Syndrom 655 15.5 Störungen in der Folge von Schädel-Hirn-Traumata 656 15.5.1 Das klinische Zustandsbild 656 15.5.2 Behandlungsformen und Therapieerfolge 658 Zusammenfassung 661 Kapitel 16 Psychische Störungen im Kindes- und Jugendalter 663 16.1 Abweichendes Verhalten in unterschiedlichen Lebensabschnitten 664 16.1.1 Spezifische klinische Zustandsbilder im Kindes- und Jugendalter 665 16.1.2 Vulnerabilität für psychische Störungen bei jungen Kindern 665 16.1.3 Klassifikation psychischer Störungen im Kindes- und Jugendalter 665 16.2 Häufige psychische Störungen des Kindesalters 666 16.2.1 Aufmerksamkeitsdefizit-/Hyperaktivitätsstörung (Hyperkinetische Störungen) 666 16.2.2 Störungen des Sozialverhaltens 671 16.2.3 Angststörungen im Kindes- und Jugendalter 675 16.2.4 Depression im Kindesalter 680 16.2.5 Monosymptomale Störungen des Kindesalters: Störungen der Ausscheidung (Enuresis, Enkopresis), Schlafstörung mit Schlafwandeln und Ticstörungen 683 16.2.6 Tiefgreifende Entwicklungsstörungen 687 16.2.7 Autistische Störung 688 16.3 Lernstörungen und geistige Behinderung 693 16.3.1 Lernstörungen 693 16.3.2 Kausale Bedingungen bei Lernstörungen 695 16.3.3 Behandlungsformen und Therapieerfolge 696 16.3.4 Geistige Behinderung 696 16.3.5 Hirnpathologie und geistige Behinderung 698 16.3.6 Organisch bedingte geistige Behinderung 700 16.3.7 Behandlungsformen, Therapieerfolge und Prävention 705 16.4 Planung von Hilfsprogrammen für Kinder und Jugendliche 706 16.4.1 Relevante Aspekte bei der Behandlung von Kindern und Jugendlichen 706 16.4.2 Programme zum Schutz der Rechte von Kindern: Beispiele aus der USA 711 Zusammenfassung 715 Kapitel 17 Therapie 717 17.1 Grundlegende Aspekte der Psychotherapie 718 17.1.1 Warum begeben Menschen sich in psychotherapeutische Behandlung? 718 17.1.2 Wer bietet psychotherapeutische Dienstleistungen an? 720 17.1.3 Die therapeutische Beziehung 721 17.2 Evaluation des Therapieerfolgs 722 17.2.1 Die Objektivierung und Quantifizierung von Veränderungen 723 17.2.2 Verbesserung und Spontanremission bei psychischen Störungen 725 17.2.3 Kann Psychotherapie schädlich sein? 725 17.3 Welche therapeutischen Ansätze sollten angewendet werden? 726 17.3.1 Evidenzbasierte Behandlungen 726 17.3.2 Medikation durch Psychopharmaka oder Psychotherapie? 727 17.3.3 Kombinierte Behandlungen 728 17.4 Pharmakologische Behandlungsansätze 729 17.4.1 Antipsychotika 730 17.4.2 Antidepressiva 732 17.4.3 Anxiolytika (Angstlösende Medikamente) 737 17.4.4 Lithium und andere stimmungsstabilisierende Medikamente 738 17.4.5 Elektrokrampftherapie (EKT) 740 17.4.6 Neurochirurgie 743 17.5 Psychologische Behandlungsansätze 745 17.5.1 Verhaltenstherapie 745 17.5.2 Kognitive Verhaltenstherapie/Kognitiv-behaviorale Therapie 749 17.5.3 Humanistisch-erlebnisorientierte Therapien 752 17.5.4 Psychodynamische oder psychoanalytisch fundierte Psychotherapien 755 17.5.5 Paar- und Familientherapie 760 17.5.6 Eklektizismus und Integration 761 17.6 Psychotherapie und Gesellschaft 762 17.6.1 Gesellschaftliche Wertvorstellungen und Psychotherapie 762 17.6.2 Psychotherapie und kulturelle Unterschiede 763 Zusammenfassung 765 Kapitel 18 Aktuelle Entwicklungen, rechtliche und ethische Aspekte der Klinischen Psychologie 767 18.1 Die Perspektive „Prävention“ 768 18.1.1 Universelle Interventionen 768 18.1.2 Selektive Interventionen 770 18.1.3 Indizierte Interventionen 776 18.1.4 Die psychiatrische Klinik als therapeutische Gemeinschaft 776 18.1.5 Deinstitutionalisierung 778 18.2 Rechtliche und ethische Aspekte im Zusammenhang mit psychischen Störungen 780 18.2.1 Der Einweisungsprozess 782 18.2.2 Die Beurteilung der „Gefährlichkeit“ 783 18.2.3 Das Plädoyer auf Unzurechnungsfähigkeit 787 18.2.4 Ethische Leitlinien psychotherapeutischer Praxis 791 18.3 Maßnahmen zur Verbesserung der psychischen Gesundheit 792 18.3.1 Maßnahmen in Deutschland: Förderung durch die Bundeszentrale für gesundheitliche Aufklärung (BZgA), spez. Suchtprävention 792 18.3.2 Der Sozialpsychiatrische Dienst (SpDi) 793 18.3.3 Maßnahmen für psychische Gesundheit auf internationaler Ebene 794 18.4 Zukünftige Herausforderungen 795 18.4.1 Die Notwendigkeit effizienter Planung 795 18.4.2 Der Beitrag jedes Einzelnen 795 Zusammenfassung 799 Anhang 801 Anhang A: Glossar 803 Anhang B: Literaturverzeichnis 826 Anhang C: Stichwortverzeichnis 938 Anhang D: Bildnachweis 949 Weitere Titel aus der Reihe Pearson Studium |
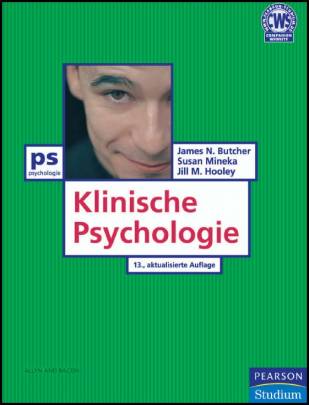
 Bei Amazon kaufen
Bei Amazon kaufen