|
|
|
Umschlagtext
Das Handbuch erschließt alle Werke und Aufsätze Immanuel Kants durch Referat und knappe Interpretation und gibt Einblick in die Bezüge Kants zu den philosophischen, wissenschaftlichen, religiösen, künstlerischen und politischen Tendenzen der Zeit. Eine nach Themengruppen geordnete Einführung in die Kant-Literatur seit dem deutschen Neukantianismus, Zeittafel und ausführliche Register machen das Handbuch zu einem philosophiehistorischen Nachschlagewerk. Die dritte Auflage bietet eine verbesserte Bibliographie der Kant-Literatur. Der Text ist eingehend durchgesehen, ein Anhang enthält Ergänzungen und ein ausführliches Nachwort.
Philosophie als Begründung methodischer Rationalität: Kants Werk bietet für fast alle philosophischen Richtungen der Gegenwart den letzten einheitlichen Bezugspunkt dieser europäischen Tradition. Rezension
In der hervorragenden Reihe der "Handbücher" des J.B. Metzler-Verlags Stuttgart liegt jetzt in bereits 3. Auflage als Paperback zum günstigen Preis von 24,95 € dieses Kant-Handbuch vor, das (knapp) in Leben und (umfassend) in Werk des großen Aufklärungs-Philosophen einführt. Das Handbuch erschließt alle Werke und Aufsätze Immanuel Kants durch Referat und knappe Interpretation und gibt Einblick in die Bezüge Kants zu den philosophischen, wissenschaftlichen, religiösen, künstlerischen und politischen Tendenzen der Zeit. - Immanuel Kant, der Königsberger Philosoph 1724-1804, gilt einerseits als Begründer jeder neuzeitlich-abendländischen Philosophie, seine Schriften als Grundlegung einer autonomen Ethik und rein vernünftigen Durchdringung des Weltgeschehens - ohne Kant keine neuzeitliche Philsophie und ohne Kant mithin auch kein Philosophie-Unterricht. Und jeder Oberstufen-Schüler wird mit dem kategorischen Imperativ konfrontiert, ob im Ethik- oder im Religionsunterricht, und der Vergleich mit der sog. Goldenen Regel in der Bergpredigt (Mt 7,12) wird erfolgen. - Andererseits gilt Kant, zumindestens Schülern, als weitgehend unverständlich; gefürchtet sind die Kantschen Satz-Würmer ... - Um so hilfreicher ist dieses Buch! Nach einer vergleichsweise kurzen Einführung in das Leben des Philosophen (das rein äußerlich so aufregend nicht war: Kant hat bekanntlich Königsberg nie verlassen) und die Epoche der Aufklärung werden die zentralen Schriften Kants auf je ca. 50 S. verständlich und komprimiert erläutert und auch in einen inneren Bezug gesetzt. So scheint ein Verstehen des Gesamtwerks des Immanuel Kant auf, das in dieser Form seinesgleichen sucht. Eine Zeittafel, ein Namen- und ein umfangreiches Sachregister vereinfachen den Umgang mit dem Handbuch ebenso wie jeweils umfangreich genannte Sekundärliteratur und die klare und durchgängig wissenschaftliche Diktion mit eindeutigen Abkürzungsverwendungen und Zitationsverweisen. Unbedingt empfehlenswert!
Thomas Bernhard für lehrerbibliothek.de Verlagsinfo
Leitfaden durch die Forschung seit dem Neukantianismus Sämtliche Werke und Aufsätze Kants im Überblick Anhang mit aktualisierter Bibliografie, Ergänzungen zum Inhalt und einem ausführlichen Nachwort Mit Zeittafel und ausführlichen Registern Gerd Irrlitz, Philosophiestudium 1953-57 in Leipzig, Promotion 1968, Habilitation 1977; Professor em. für philosophische Propädeutik und Geschichte der Philosophie an der Humboldt-Universität zu Berlin; zahlreiche Arbeiten zur Geschichte der Philosophie (Bacon, Descartes, Hegel, Geschichte der Ethik). Inhaltsverzeichnis
Inhaltsübersicht
Aus der Einleitung zur 2. Auflage XVII I Leben - Zeit - Weg des Denkens 1 II Die frühen naturphilosophischen und metaphysischen Schriften, spätere kleinere naturphilosophische Aufsätze, die Geographie-Vorlesung 67 III Die metaphysikkritischen Schriften der 60er Jahre 91 IV Kritik der reinen Vernunft I 117 V Kritik der reinen Vernunft II 181 VI Prolegomena zu einer jeden Metaphysik, die als Wissenschaft wird auftreten können 259 VII Grundlegung zur Metaphysik der Sitten 271 VIII Metaphysische Anfangsgründe der Naturwissenschaft 283 IX Kritik der praktischen Vernunft 299 X Kritik der Urteilskraft 331 XI Die Religion innerhalb der Grenzen der bloßen Vernunft 369 XII Aufsätze und Schriften der 80er und 90er Jahre 393 XIII Die Metaphysik der Sitten 435 XIV Akademie-Ausgabe, handschriftlicher Nachlaß (Reflexionen, die Manuskripte zur Preisschrift über die Fortschritte der Metaphysik und des sog. Opus postumum), Vorlesungen 465 XV Anhang und Register 489 Inhaltsverzeichnis Zitierweise und Abkürzungen XV Aus der Einleitung zur 2. Auflage XVII I Leben — Zeit — Weg des Denkens 1 Kants Leben 1 Königsberg 1 Geistiges Leben 1 Universität 3 Kants Herkunft 5 Schule, Studium 6 Dozent, Universitätsprofessor 7 Bild der Persönlichkeit 9 2 Kant in der Epoche der Aufklärung 12 Perfektibilitätsprinzip 15 Fortschrittsgedanke 17 Individuelle Selbstbestimmung und Gattungsfortschritt 17 Selbstdenken und allgemeine Menschenvernunft 19 Naturbegriff als vorausgehendes Modell kulturellen Selbstverständnisses. Kants Frage nach dem, was Naturwissenschaften nicht beantworten 20 »Natur« des Menschen. Idealistische Form der Gedankenentwicklung und praktischer Realismus bei Kant 22 Kants Kritik der naturalistischen Anthropologie 24 Die drei Kritiken als Selbstkritik der Aufklärung 25 Problem der Methode 26 Urteilsvermögen 27 Common sense 27 Kant zu den kulturellen Strömungen seiner Zeit 29 Literatur, Pädagogik 30 Rousseau 32 Spinoza-Streit 33 Aufklärung und Fortschrittsgang, idealistischer Geschichtsbegriff 35 3 Kants politische Auffassungen. Stellung zur Französischen Revolution 36 4 Die Religionsschrift und der Zusammenstoß mit dem preußischen Staat 41 5 Theoretische Perioden, Gruppierung der Werke 43 Entwicklungsgeschichtliche Auffassung der Kantschen Theorie 43 »Vorkritische« und »kritische« Periode 45 Die Dissertation von 1770 48 Auseinandersetzung mit Hume 49 Das Antinomienproblem 50 »Großes Licht« 1769 54 Zum geistigen Weg Kants 56 6 Kants Philosophiebegriff 57 Metaphysik als Naturanlage und als Wissenschaft 57 Systemprinzip 58 Intelligible und sensible Welt 60 Schulbegriff und Weltbegriff der Philosophie 61 Was kann ich wissen? Was soll ich tun? Was darf ich hoffen? 63 Gott, Freiheit und Unsterblichkeit 64 Horizont des Bewusstseins 64 Philosophie lernen oder Philosophieren lernen 65 II Die frühen naturphilosophischen und metaphysischen Schriften, spätere kleinere naturphilosophische Aufsätze, die Geographie-Vorlesung Kant und die Naturwissenschaften 67 Methodische Aspekte des Naturbegriffs im 18. Jh 73 Gedanken von der wahren Schätzung der lebendigen Kräfte (1747) 76 Allgemeine Naturgeschichte und Theorie des Himmels (1755) 79 Principiorum primorum cognitionis metaphysicae nova dilucidatio (1755) 82 Metaphysicae cum geometria junctae usus in philosophia naturali, cuius specimen I. continet monadologiam physicam (1756) 83 Meteorologie, physische Geographie, Rassentheorie 85 III Die metaphysikkritischen Schriften der 60er Jahre Die Themen und Probleme dieser Schriften 91 Neuer Lehrbegriff der Bewegung und Ruhe (1758) 94 Die falsche Spitzfindigkeit der vier syllogistischen Figuren (1762) 95 Der einzig mögliche Beweisgrund zu einer Demonstration des Daseins Gottes (1763) 95 Untersuchung über die Deutlichkeit der Grundsätze der natürlichen Theologie und Moral (1764) 98 Versuch den Begriff der negativen Größen in die Weltweisheit einzuführen (1763) 100 Beobachtungen über das Gefühl des Schönen und Erhabenen (1764) 103 Nachricht von der Einrichtung seiner Vorlesungen in dem Winterhalbenjahre 1765-1766 (1765) 105 Träume eines Geistersehers, erläutert durch Träume der Metaphysik (1766) 107 Von dem ersten Grunde des Unterschieds der Gegenden im Raume (1768) 110 De mundi sensibilis atque intelligibilis forma et principiis (1770) 112 IV Kritik der reinen Vernunft I (1781, 2. Aufl. 1787) 1 Propädeutik und System der Metaphysik, eine phaenomenologia generalis 117 Analytik der Begriffe statt Ontologie 117 Locke-Einfluss, Bezug auf Hume 118 Apriorismus als Konstitutionsvoraussetzung von Sachverhalten und als Bestimmung elementarer Gesetze praktischer Vernunft 119 Propädeutik in drei Kritiken, zweiflügelige Metaphysik der Natur und der Sitten 124 Gründe für die Trennung von »Kritik« und Metaphysik-Systematik 125 Phänomenologie, Kritik von Schein und Vorurteil 128 Metaphysik als spezielle Kategorienlehre 128 Der Methodentraktat Kritik der reinen Vernunft und die Methode der Newtonschen Naturwissenschaft 129 Ontologischer und transzendentaler Apriorismus. Die logische Funktion auf die Realisierung in den Wissenschaften angelegt 131 2 Die Gliederung der Kritik der reinen Vernunft 132 »Einige Dunkelheiten« 132 Elementar- und Methodenlehre 133 Analytik und Dialektik 134 Keine allgemeine Erkenntnistheorie. Die transzendentale Untersuchung 135 3 Das Grundproblem der Kritik der reinen Vernunft 136 »Das Schwerste, das jemals zum Behuf der Metaphysik unternommen werden konnte«. Synthesis a priori. 136 Natur- und Freiheitsbegriffe 138 Dichotomie von rezeptiver »Sinnlichkeit« und apriorischer Spontaneität; das dritte Element: produktive Einbildungskraft 139 Aufbauplan und theoretische Struktur des Werkes 139 4 Kants Sprache, Leitbegriffe der Kritik 143 Kants Sprache 143 Herkunft einiger Leitbegriffe 145 Einige Leitbegriffe und Grundprobleme 147 Kritik 147 transzendent - transzendental 150 a priori - a posteriori 153 Die »ursprüngliche Erwerbung« apriorischer Begriffe und die mit dem Apriorismus mitgesetzte Subjekt-Subjekt- und Subjekt-Objekt-Relation 157 Synthesis, analytische und synthetische Urteile 158 Subjekt überhaupt, transzendentale Apperzeption 164 Ding an sich - Erscheinung 165 5 Entstehung, erste und zweite Auflage des Werkes 172 V Kritik der reinen Vernunft II (1781, 2. Aufl. 1787) 1 Motto, Widmung, Vorreden und Einleitungen zur ersten und zweiten Auflage 181 2 Transzendentale Ästhetik 187 Die Problemstellung 187 Raum und Zeit bei Newton, Leibniz, Hume 189 Transzendentale Theorie des Raumes 192 Diskussion der Raumtheorie 193 Ästhetik und Logik, analytische Geometrie und Synthesis a priori 194 Transzendentale Theorie der Zeit 195 Idealität von Raum und Zeit und Synthesis a priori 197 Schlussbemerkung 197 3 Transzendentale Logik 198 Einleitung. Formale und transzendentale Logik 199 Analytik der Begriffe 201 Metaphysische Deduktion der reinen Verstandesbegriffe 201 Urteilstafel und Kategorientafel 204 Transzendentale Deduktion 207 Die Einheit des Selbstbewusstseins, die transzendentale Apperzeption 209 Verbindung von logisch-formaler und empirisch-materialer Bewusstseinsebene 211 Analytik der Grundsätze 212 Urteilskraft 214 Produktive Einbildungskraft 215 Schematismus der reinen Verstandesbegriffe 217 System der Grundsätze 220 Zwei Schlusskapitel der Analytik. Aufklärerische Kritik der Scheinformen gesellschaftlichen Bewusstseins 224 4 Transzendentale Dialektik 228 Verstand und Vernunft. Das Unbedingte und die Vernunftideen 228 Übergang von der theoretischen zur praktischen Objektivation. Die Vernunftideen 232 Dialektik der Vernunftideen, Irrtumstheorie 233 Dialektische Schlüsse der reinen Vernunft 234 Die Paralogismen der reinen Vernunft. Die Unsterblichkeit der Seele und die Kritik der rationalen Psychologie 235 Die vier Antinomien der kritiklosen Vernunft 237 Problemstellung 237 Leibniz als Vorbereiter der Kantschen Antinomik 240 Wissenschaftliche Problemlage 241 Gang der Darstellung, die kosmologischen Ideen, die vier Antinomien 243 Zur Interpretation 245 Die dritte Antinomie. Freiheit - Notwendigkeit 248 Der Gottesbegriff in der vierten Antinomie, rationale Theologie und Ideal der Vernunft 248 Die vierte Antinomie 248 Ideal der Vernunft 249 Kritik der Gottesbeweise. Ontologischer Gottesbeweis 250 Kosmologischer und physikotheologischer Gottesbeweis 251 5 Transzendentale Methodenlehre 253 VI Prolegomena zu einer jeden künftigen Metaphysik, die als Wissenschaft wird auftreten können (1783) Veranlassung der Schrift: die Aufnahme der Kritik der reinen Vernunft 259 Vorwort und Anhang 262 »Humisches Problem« 264 Die Gliederung 266 Die Transzendentalphilosophie im Wendepunkt der Aufklärungsphilosophie von Verfall und Wiedergeburt 267 Veränderter Aufbauplan und Akzentuierung der Synthesis a priori 267 VII Grundlegung zur Metaphysik der Sitten (1785) Das Entstehen der Schrift 271 Phänomenologisch-genetische Darstellungsmethode 272 Erster Abschnitt. Auflösung des Rousseau-Dilemmas 273 Zweiter Abschnitt. Empirismus-Kritik 276 Dritter Abschnitt. Kategorischer Imperativ. Faktum der Vernunft 277 VIII Metaphysische Anfangsgründe der Naturwissenschaft (1786) Metaphysik der Naturwissenschaften 283 Wissenschaftssystematik 286 Der Terminus »Natur« bei Kant 293 IX Kritik der praktischen Vernunft (1788) Entstehung, Verhältnis zur Kritik der reinen Vernunft 299 Aufbau der Schrift 308 Sittengesetz, objektive Bestimmung der Einheit des Willens 309 Der Gang der Darstellung 317 Elementarlehre. Analytik. Kategorischer Imperativ 317 Faktum der Vernunft, religiöse Tradition der Gesinnungsethik 318 Evidenz-Bewusstsein. Methodische Ebenen 320 Der Begriff moralisch-praktischer Vernunft als übergreifende Theorie der Vergesellschaftungsfelder 321 Empirismus-Kritik. 321 Der Gegenstand der reinen praktischen Vernunft 323 Die Typik der praktischen Urteilskraft 323 Dialektik der praktischen Vernunft 324 Postulate der praktischen Vernunft 326 Unsterblichkeit, Gottesbegriff, höchstes Gut 327 Methodenlehre 329 X Kritik der Urteilskraft (1790) Ein Prinzip a priori des Geschmacks und der Wissenschaften von der organischen Natur 331 Problem und Systemfunktion einer Kritik der Urteilskraft 334 Vorrede und Einleitung 338 Die Kategorie der Vermittlung 338 Die erste Einleitung. Technik der Natur 339 Nicht bestimmende, sondern regulative Urteilskraft 340 Teleologische Urteilskraft und Naturzweck 342 Intelligibles Substrat der Natur außer uns und in uns 343 Ästhetische Urteilskraft 345 Besonderheit des ästhetischen Apriori 345 Ästhetik als Theorie der Kunst-Rezeption durch Geschmacksurteile 346 Form und Materie des Kunstwerks 347 Kritik A. G. Baumgartens 348 Analytik der ästhetischen Urteilskraft 349 Das Erhabene 353 Deduktion des ästhetischen Urteils 355 Das künstlerische Genie 356 Dialektik der ästhetischen Urteilskraft. Antinomien in den drei Kritiken 356 Problem- und Systemgedanke in der Theorie der Urteilskraft. Ästhetische Urteilskraft und Moral 357 Sensus communis 359 Teleologische Urteilskraft 360 Methodenlehre 364 XI Die Religion innerhalb der Grenzen der bloßen Vernunft (1793) Die Problemstellung 369 Der Titel. Vernunftreligion und Kirchenglaube 374 Der Aufbau der Schrift 378 Erstes Stück. Von der Einwirkung des bösen Prinzips neben dem guten oder das radikale Böse in der menschlichen Natur 379 Zweites Stück. Von dem Kampf des guten Prinzips mit dem bösen um die Herrschaft über den Menschen 381 Drittes Stück. Der Sieg des guten Prinzips über das böse und die Gründung eines Reichs Gottes auf Erden 384 Viertes Stück. Vom Dienst und Afterdienst unter der Herrschaft des guten Prinzips oder von Religion und Pfaffentum 385 Ineinanderscheinen von religiös veranschaulichter Moral und moralisch reflektierter Religion 386 Deismus und Offenbarung. Quellen der Religionsschrift 387 Verhältnis von Moral und Religion 390 XII Aufsätze und Schriften der 80er und 90er Jahre 1 Themen. Gegner und Anhänger der Kantschen Theorie 393 2 Arbeiten zur Geschichtsphilosophie 396 Idee zu einer allgemeinen Geschichte in weltbürgerlicher Absicht (1784) 398 Rezensionen von 1. G. Herders Ideen zur Philosophie der Geschichte der Menschheit (1785) 400 Mutmaßlicher Anfang der Menschengeschichte (1786) 402 Über den Gebrauch teleologischer Prinzipien in der Philosophie (1788) 403 3 Arbeiten zu Themen der Zeit 404 Beantwortung der Frage: Was ist Aufklärung? (1784) 404 Von der Unrechtmäßigkeit des Büchernachdrucks (1785) 407 Was heißt: Sich im Denken orientieren? (1786) 407 Einige Bemerkungen zu L. H. Jakob's Prüfung der Mendelssohn'schen Morgenstunden (1786) 410 Über den Gemeinspruch: Das mag in der Theorie richtig sein, taugt aber nicht für die Praxis (1793) 410 Das Ende aller Dinge (1794) 412 Über ein vermeintes Recht aus Menschenliebe zu lügen (1797) 414 4 Abhandlungen zur Verteidigung der Transzendentalphilosophie 415 Über eine Entdeckung, nach der alle neue Kritik der reinen Vernunft durch eine ältere entbehrlich gemacht werden soll (1790) 415 Über das Mißlingen aller philosophischen Versuche in der Theodizee (1791) 416 Von einem neuerdings erhobenen vornehmen Ton in der Philosophie. Verkündigung nahen Abschlusses eines Tractats zum ewigen Frieden in der Philosophie (1796) 417 Über die Buchmacherei. Zwei Briefe an Herrn Friedrich Nicolai (1798) 418 5 Zum ewigen Frieden (1795) 419 6 Der Streit der Fakultäten (1798) 422 7 Anthropologie in pragmatischer Hinsicht (1798) 427 XIII Die Metaphysik der Sitten (1797) Frühes Projekt, spät vollendet 435 Eines der frühesten Projekte zur Kritik der Metaphysik 435 Stellung im Systemplan Kants. Rechtstheorie und Ethik der größten Zahl 437 Vorstufe der Sitten-Metaphysik in den rechts- und moralphilosophischen Vorlesungen 439 Das Vertragsprinzip als Voraussetzung des metaphysischen Apriorismus von Recht und Moral 442 Metaphysik der Sitten als Teil der Kulturphilosophie Kants. Dualismus und Wechselbezug von Recht und Moral 443 Metaphysik des Rechts 445 Das Rechtsverhältnis. Metaphysik der Sittlichkeit, nicht Naturrechtstheorie 445 Privatrecht 448 Staatsrecht 450 Strafrecht 452 Völkerrecht 453 Metaphysik der Tugendpflichten 454 Entsprechung von juridischer Versachlichung der Sozialisierungsakte und Formalismus der Gesinnungsethik 454 Metaphysik als Lösung des Begründungsproblems für Aufforderungssätze 456 Systematischer Ort der Metaphysik 457 Die Gliederung der Tugend-Metaphysik. Gesinnungsethik 458 Pflichtenkatalog 461 Intellektualismus und Sinnlichkeitskritik 462 Guter Wille und Gerichtshof-Modell. Das Dualismus-Problem 463 Methodenlehre 464 XIV Akademie-Ausgabe, handschriftlicher Nachlaß (Reflexionen, die Manuskripte zur Preisschrift über die Fortschritte der Metaphysik und des sog. Opus postumum), Vorlesungen 1 Die Akademie-Ausgabe 465 2 Handschriftlicher Nachlaß 468 Die Reflexionen 468 Die Manuskripte zur Preisschrift über die Fortschritte der Metaphysik 469 Die nachgelassenen Manuskripte zum geplanten Werk Übergang von den Metaphysischen Anfangsgründen der Naturwissenschaft zur Physik (sog. Opus postumum) 471 3 Die Vorlesungen 476 Vorlesungen über Logik (Bd. XXIV) 480 Vorlesungen über Anthropologie (Bd. XXV) 481 Vorlesungen über Moralphilosophie (Bd. XXVII) 483 Vorlesungen über Metaphysik und Rationaltheologie (Bd. XXVIII) 484 Vorlesung über Pädagogik (Bd. IX) 486 XV Anhang 489 1 Zeittafel 489 2 Nachwort zur 3. Auflage 492 3 Bibliographie 524 4 Namensregister 534 5 Sachregister 540 |
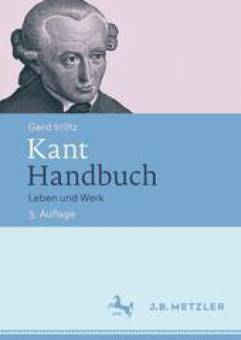
 Bei Amazon kaufen
Bei Amazon kaufen