|
|
|
Umschlagtext
Grundwissen Schulleitung ist das an Leitungsaufgaben ausgerichtete Handbuch für das Schulmanagement. Es beschreibt kompakt die entscheidenden und wesentlichen Aufgaben und Handlungsfelder der Schulleitung, die u.a. im Zusammenhang mit Führung, Personalentwicklung, Schulentwicklung und Qualitätsmanagement stehen.
Ausgewiesene Experten beschreiben einerseits das komplexe Aufgabenspektrum der Schulleitung und bieten andererseits praxisnahe Hilfen für gegenwärtige und zukünftige Schulleitungen an. Das Standardwerk für Schulleitungen gibt dem Leser in kurzen und anschaulichen Artikeln ein Grundlagenkompendium an die Hand, das neben theoretischem Hintergrundwissen, praktischer Erfahrungen und praxisorientierter Hilfe auch die internationalen Aspekte der einzelnen Themen mitberücksichtigt. Aus dem Inhalt: Schulentwicklung Personalführung und Personalentwicklung Qualitätsmanagement und Evaluation Schulmarketing Medienkompetenz in der Schule als Leitungsaufgabe Beratung Schule und Schulträger Schule und Recht Herausgeber: Prof. Dr. Raimund Pfundtner, FernUniversität Hagen. Leiter des ehemaligen weiterbildenden Studiums »Vorbereitung auf Leitungsaufgaben in Schulen – VorLAuf« Rezension
Schulen und insbesondere Schulleitungen haben veränderten gesellschaftlichen und kulturellen Bedingungen Rechnung zu tragen: Inklusion (vgl. hier S. 123ff), Gender (vgl. hier S.113ff), migrationsbedingte interkulturelle Veränderungen, ökologische Erfordernisse, verändertes soziales und kommunikatives Miteinander (z.B. Medien, vgl. hier S. 413ff), Teamfähigkeit (vgl. hier S. 187ff) u.v.a. Insofern haben sich Schulleitungsaufgaben in den vergangenen Jahren deutlich verändert und diversifiziert. Schulleitung wird immer mehr zum Schulmanagement. Dieser Entwicklung kommt dieses Handbuch "Grundwissen Schulleitung" umfassend nach, indem es alle Aspekte traditioneller und innovativer Schulleitungsaufgaben umfassend thematisiert; es beschreibt kompakt die entscheidenden und wesentlichen Aufgaben und Handlungsfelder der Schulleitung, die u.a. im Zusammenhang mit Führung, Personalentwicklung, Schulentwicklung und Qualitätsmanagement stehen.
Dieter Bach, lehrerbibliothek.de Verlagsinfo
Interessenten: Schulleitungen, Personen der Schulaufsicht und Schulverwaltung, der Bildungsplanung, der Lehrer- und Schulleiterfort- und -weiterbildung, pädagogische Führungskräfte und Schulleitungen in spe Inhaltsverzeichnis
Vorwort XV
I Schul- und Unterrichtsentwicklung 1 RAINER BROCKMEYER 1 Schule, Schulsystem und Schulentwicklung 3 1.1 Stand der Schulentwicklung in 16 Ländern 3 1.2 Struktur des Schulwesens 4 1.3 Lernprozesse - innere Schulorganisation 5 1.4 Örtliches und regionales Schulangebot 5 1.5 Schulaufsicht und Schulverwaltung 5 1.6 Schwerpunkte und Schubkräfte der weiteren Entwicklung 6 1.7 Bildung für das Leben in einer offenen, dynamischen und pluralen Gesellschaft 7 1.8 Anforderungsprofile 8 1.9 Schule als innovative Schule in einem innovativen Schulsystem 9 1.10 Besondere Entwicklungsschwerpunkte nach PISA 11 1.11 Systemanalyse und Systementwicklung 11 1.12 Systemische und systematische Entwicklung 12 1.13 Standards und Kompetenzen 12 1.14 Zusammenfassung 13 HEINZ S. ROSENBUSCH, JULIA WARWAS 2 Schulleitung als Profession 14 2.1 Kennzeichen und Rahmenbedingungen professionellen Handelns 14 2.2 Historische Entwicklungslinien der Genese von Schulleitung in Deutschland 16 2.3 Berufsqualifizierung des Leitungspersonals - Stand in Deutschland und vergleichender Blick nach England 18 2.4 Ein organisationspädagogisches Konzept als Beitrag zur Professionalisierung von Schulleitung in Deutschland 21 2.5 Resümee 23 KARL-OSWALD BAUER 3 Schule leiten mit dem Schulprogramm? 25 3.1 Ziele des Schulprogramms 25 3.2 Forschungsergebnisse zur Schulprogrammarbeit 26 3.3 Forschungsergebnisse zu Schulunterschieden aus einer Evaluationsstudie 31 3.4 Hinweise zur Optimierung 34 ARMIN LOHMANN 4 Was verbirgt sich hinter der Qualitätsverantwortung der Schulleiterinnen und Schulleiter? 37 4.1 Aufräumen mit dem Irrtum, Schulen seien von außen steuerbar 37 4.2 Neu Steuerungseinflüsse: Die Effektivität von Schulleiterinnen und Schulleitern 40 4.3 Was brauchen die Schulen zur Qualitätsentwicklung? 45 4.4 Reflexion und Rechenschaft 46 4.5 Welche Kompetenzen benötigen Schulleiterinnen und Schulleiter zur Qualitätsgestaltung? 48 4.6 Führung - ein schwieriger Begriff 50 4.7 Die Führungsverantwortung im Qualitätsentwicklungsprozess 51 JÖRG THIELE 5 Schulsportentwicklung als Gestaltungsaufgabe von Schulleitungen 56 5.1 Bewegung, Spiel und Sport in der Schule 56 5.2 Schulentwicklung und Schulsportentwicklung 57 5.3 Schulsportentwicklung als Gestaltungsaufgabe der Schulleitung 60 5.4 Fazit 62 KARL-OSWALD BAUER 6 Unterrichtsentwicklung — eine Leitungsaufgabe? 64 6.1 Begriffsklärung 64 6.2 Ansätze der Unterrichtsentwicklung 65 6.3 Theoriegeleitetes Vorgehen - Unterrichtsqualität und Evaluation 68 6.4 Funktionen der Unterrichtsentwicklung und Rolle der Schulleitung 71 6.5 Hauptziele der Unterrichtentwicklung: Kompetenz und Glück 73 6.6 Wirksamkeit von Unterricht im Licht der empirischen Forschung 74 6.7 Unterrichtsentwicklungsforschung, professionelles Selbst der Lehrpersonen und Kompetenzförderung 75 ROLF V. LÜDE 7 Den Wandel der Organisation Schule selbst gestalten: Grundfragen der Organisationsentwicklung 79 7.1 Zum Wandel von Schulen und zur Veränderung von Management-Prinzipien 79 7.2 Die Selbstverantwortung der schulischen Organisationen 84 7.3 Organisationsentwicklung als Strategie der Veränderung 86 ARMIN LOHMANN 8 Wie selbstständig soll Schule sein? Wie eigenverantwortlich kann Schule sein? 95 8.1 Überall Reformbewegungen 95 8.2 Gute Schulen verlangen eine neue Systemarchitektur 99 8.3 Zum Selbstverständnis der selbstständigen und der eigenverantwortlichen Schule 104 8.4 Was kann die Eigenverantwortliche Schule leisten? 109 THEA STROOT 9 „Frauen in Schulleitungen": Managing Gender und Learning Diversity in Schulen 113 9.1 Frauen in Führungspositionen 114 9.2 Führung und Leitung der Institution Schule 116 9.3 „Managing Gender und Diversity": Neue Organisationsentwicklungsansätze 118 9.4 Vielfalt in der Schule managen: Learning Diversity 119 KLAUS KLEMM 10 Inklusion: Auftrag — Entwicklung — Problemzonen 123 10.1 Die UN-Konvention über die Rechte von Menschen mit Behinderungen als Treiber 123 10.2 Inklusion: Befunde der empirischen Schulforschung 124 10.3 Inklusion und Dddusion: Ein bildungsstatistischer Überblick 126 10.4 Problemfelder bei der weiteren Umsetzung 128 NORBERT WENNING 11 Heterogenität und Schulleitungshandeln 131 11.1 Heterogenität und Bildung - eine Frage der Wahrnehmung 132 11.2 Der Begriff Heterogenität - ein Verständnis 135 11.3 Schule und Heterogenität - Lage und Entwicklung 137 11.4 Schule und Heterogenität - Erfahrungen, Traditionen 140 11.5 Reaktionsmöglichkeiten - alternative Umgangsweisen 142 11.6 Zusammenfassung 146 II Personalführung und -entwicklung 149 WALTER NEUBAUER 1 Grundlagen der Personalführung und -entwicklung 151 1.1 Zielbereiche und Kriterien erfolgreicher Personalführung 151 1.2 Wichtige Aufgabenfelder der Personalführung 153 1.3 Lernende Organisation und Strategisches Management 155 CLAUS BUHREN 2 Personalentwicklung 158 2.1 Gründe für Personalentwicklung 159 2.2 Wer fordert Personalentwicklung? 160 2.3 Konzept und Grundbegriffe 162 WALTER NEUBAUER 3 Personalbeurteilung 166 3.1 Zweck 166 3.2 Beurteilungskriterien 167 3.3 Beurteilungsfehler 168 3.4 Güte des Messinstruments 169 3.5 Praktische Durchführung 169 BERND GASCH 4 Gespräche mit Mitarbeitern, Eltern und sonstigen Partnern 174 4.1 Einleitung 174 4.2 Folgerungen aus einer allgemeinen Kommunikationstheorie 175 4.3 Typen von Mitarbeitergesprächen 177 4.4 Gesprächsvarianten und -alternativen 183 4.5 Metakommunikation 185 GUY KEMPFERT 5 Teamentwicklung — ein alter Hut? 187 5.1 Begriff der Schulentwicklung 187 5.2 Voraussetzungen 189 5.3 Teams for Tasks - Ein Beispiel aus der Praxis 190 5.4 Rolle der Schulleitung 193 STEPHAN GERHARD HUBER 6 Qualifizierung von Schulleiterinnen und Schuleitern — Ausdifferenzierung der Curricula der Führungskräfteentwicklung 194 6.1 Internationale Trends 194 6.2 Entwicklungen in den deutschsprachigen Ländern 200 6.3 Entwicklungen an Hochschulen 202 6.4 Entwicklungen auf regionaler Ebene am Beispiel des Netzwerks Erfurter Schulen 203 6.5 Multiple Lernanlässe 203 6.6 Qualitätsmerkmale von Maßnahmen der Führungskräfteentwicklung 205 BERNHARD ROSEMANN 7 Führungstheorien 210 7.1 Führen oder Leiten? 210 7.2 Grundfragen der Führungsforschung 210 WOLFGANG MUTZECK (ÜBERARBEITET VON KERSTIN POPP UND ANDREAS METHNER) 8 Umgang mit Konflikten 216 8.1 Definition und Beschreibung von Konflikten 216 8.2 Konfliktkompetenzen 217 8.3 Innere Konflikte 218 8.4 Äußere Konflikte 224 8.5 Konfliktlösung durch Mediation 228 III Qualitätsmanagement 233 HANS-DIETER ZOLLONDZ 1 Grundlagen Qualitätsmanagement 235 1.1 Zum Grundlagenverständnis im Qualitätsmanagement 235 1.2 Zur Charakteristik des Qualitätsmanagements 235 1.3 Module von QM-Systemen 237 1.4 Zum Verständnis von Qualität 237 1.5 Kernbegriffe des Qualitätsmanagements 239 1.6 Die Instrumentalebene des Qualitätsmanagements 240 1.7 Die Implementierung des Qualitätsmanagements 242 1.8 Neuere Entwicklungen im Qualitätsmanagement 242 1.9 Zum Branchenbezug des Qualitätsmanagements 244 CLAUS BUHREN 2 Qualitätsentwicklung und Evaluation 246 2.1 Was ist Qualität? 246 2.2 Qualitätsindikatoren 247 2.3 Evaluation der Prozess- und Outputverfahren 247 2.4 Was ist Evaluation? 249 2.5 Ertrag und Nutzen von Evaluation in Schulen 250 2.6 Zentrale Ziele von Evaluation 252 2.7 Ebenen der Evaluation 253 2.8 Beteiligte - Rollen, der Beteiligten 253 YVETTE E. HOFMANN 3 Controlling an Schulen: Aufgaben und Instrumente 255 3.1 Controlling als Handlungsfeld des Qualitätsmanagements 255 3.2 Kennzeichnung eines koordinationsorientierten Schul-Controlling 256 3.3 Einsatzbereiche und spezifische Aufgaben des Schul-Controlling 257 3.4 Ausblick 261 HANS-DIETER ZOLLONDZ 4 Qualitätsmanagement: Konzepte, Modelle und Systeme 263 4.1 Zum Modell-, System- und Konzeptverständnis im Qualitätsmanagement 263 4.2 Konzepte des Qualitätsmanagents 264 4.3 Modelle und Systeme des Qualitätsmanagements 266 4.4 Total-Qualitätsmanagement-Systeme - Das Beispiel des EFQM-Modells als Basis des European Quality Award 272 4.5 Konsequenzen für den Schulbereich 276 STEPHAN GERHARD HUBER 5 Steuergruppen — Unterstützung im Schul(entwicklungs)management 278 5.1 Steuergruppen - ein Phänomen der deutschsprachigen Länder? 278 5.2 „Schulentwicklungsmanagement" und Schulmanagement 279 5.3 Handlungsfelder von Steuergruppen im Schulmanagement 280 5.4 Was kann die Schulleitung tun? 283 5.5 Steuergruppenarbeit in verschiedenen Spannungsfeldern 284 5.6 Fragen der Machbarkeit und Gelingensbedingungen 286 5.7 Stand der Forschung: theoretische Verortung und empirische Forschung 288 5.8 Fazit und Ausblick 291 IV Schule und Partner 295 CLAUDIA SOLZBACHER 1 Qualitätsentwicklung durch Bildungsnetzwerke und Regionale Bildungslandschaften 297 1.1 Zu den Begriffen: Kooperation, Bildungsnetzwerke, regionale Bildungslandschaften 298 1.2 Aufgaben der Schule 299 1.3 Schultheorie als Mehrebenentheorie: Kooperation setzt Autonomie voraus 306 HELMUT E. KLEIN 2 Schule und Wirtschaft: Gemeinsame Ziele, gemeinsames Handeln 313 2.1 Begründung der Qualifikationsfunktion und des Lebensweltbezugs von Schule zur Vorbereitung auf die Berufs- und Arbeitswelt 313 2.2 Schulische Grundbildung als Mindeststandard der Ausbildungsreife 315 2.3 ökonomische Bildung ist Allgemeinbildung 316 2.4 Berufsorientierung als Leitprinzip 317 2.5 Partnerschaft von Schule und Wirtschaft 319 2.6 Good Practice: Beispiele gelungener Kooperationen 321 KLAUS HEBBORN 3 Schule und Schulträger 326 3.1 Historische und rechtliche Grundlagen kommunaler Schulträgerschaft 326 3.2 Aktuelle Entwicklungen und ihre Auswirkungen auf die Schulträgerschaft der Kommunen 329 3.3 Erweiterte Schulträgerschaft konkret: Unterstützung und Dienstleistungen für die Schulen 331 3.4 Zusammenarbeit von Schulträger und Schulleitung 333 3.5 Perspektiven künftiger Entwicklung 334 KARL-HEINZ BRAUN 4 Kooperation von Schule, Elternhaus und Kinder- und Jugendhilfe 340 4.1 Strukturelle Notwendigkeiten der Zusammenarbeit von Schule, Elternhaus und Kinder- und Jugendhilfe 340 4.2 Ausgewählte Aufgabenfelder der Kooperation der Schule mit den Eltern und der Kinder- und Jugendhilfe 344 4.3 Schlussbemerkung 355 LARS OBERHAUS 5 Kreativitätsförderung. Zur Entwicklung und Entfaltung kreativitätsfördernder Gruppenprozesse im schulischen Kontext 356 5.1 Kreativität - Ein schillerndes und vieldeutiges Phänomen 356 5.2 Erforschung von Kreativität 357 5.3 Phasen kreativer Prozesse 358 5.4 Kreative Persönlichkeitsmerkmale 359 5.5 Kreativität in der Institution Schule 359 5.6 Kreativitätstechniken (für die Schule) 360 5.7 Kreativität für Führungskräfte 362 5.8 Kreativitätsförderung durch künstlerisches Gestalten 363 V Schulmarketing 367 ENJA RIEGEL 1 Öffentlichkeitsarbeit Oder: Der Zusammenhang von innerer und äußerer Öffentlichkeit 369 1.1 Bedingungen und Voraussetzungen guter Öffentlichkeitsarbeit 369 1.2 Das Beispiel der „Helene-Lange-Schule" 370 1.3 Was heißt „intensive Öffentlichkeitsarbeits innen"? 371 1.4 Öffentlichkeitsarbeit nach außen 375 GERHARD REGENTHAL 2 Schulmarketing mit Corporate Identity 381 2.1 Warum Schulmarketing mit Corporate Identity? 381 2.2 Identität = Branding = Profilierung 383 2.3 Unterscheidung der begrifflichen Vielfalt 386 2.4 Konzepte zum Erscheinungsbild und Design einer Schule 389 2.5 Anwendung des Corporate-Design-Konzeptes 392 WOLFGANG BÖTTCHER/FRANK MEETZ 3 Schulen und ihre Drittmittel 395 3.1 Grundversorgung und Extras 395 3.2 Budgetierung von Finanzmitteln als Kernelement selbstständiger Schulen 396 3.3 Fundraising, Sponsoring, Werbung, Mäzenatentum, Marktaktivtäten - Möglichkeiten der Drittmitteleinwerbung für Schulen 397 3.4 Rechtliche Aspekte: Eine Problemskizze für die Schulpraxis 399 3.5 Daten zum Fundraising: eine Flaute 402 3.6 Fundraising im kontext des schulischen Ressourcenmanagements 405 3.7 Praxistipps 406 3.8 Problemskizze: Fundraising jenseits der Einzelschule 409 VI Medienkompetenz in der Schule 413 HORST DICHANZ 1 Medienkompetenz — Werkzeug und Ziel aktueller Schulentwicklung 415 1.1 Konzept und Begriff der Kompetenz - die bildungstheoretische Ebene 415 1.2 Medienkompetenz - die schulisch-organisatorische Ebene 417 1.3 Medienkompetenz - die individuelle Ebene 419 1.4 Medienkompetenz - die unterrichtliche Ebene 420 1.5 Medienkompetenz mit und im Internet 423 GERHARD H. DUISMANN/HELMUT MESCHENMOSER 2 Schulleitung und Computer — Entwicklung eines schulischen Medienbildungskonzepts 426 2.1 Unterrichtsentwicklung, Schulentwicklung und Schulleitung 426 2.2 Vorgaben für die Medienarbeit an allgemeinbildenden Schulen 427 2.3 Ziele der Medienbildungskonzepte - Kompetenzaneignung 429 2.4 Kommunikative Kompetenz als übergeordnete Fähigkeit 430 2.5 Medienbildungskonzept und Aufgaben der Schulleitung 433 ANDREAS BREITER 3 Medienintegration als Teil der Schulentwicklung — Herausforderungen für die Schulleitung 436 3.1 Bedeutung digitaler Medien für die Schulentwicklung 436 3.2 Informationsmanagement in Schulen 437 3.3 IT-Management und IT-Planung 439 3.4 Konsequenzen 442 VII Beratung im Schulsystem und in der Schulverwaltung 445 JÖRG SCHLEE 1 Merkmale und Funktionen von Beratung 447 1.1 Beratung als Aufgabe von Schulleitung und Schulverwaltung 447 1.2 Grundstruktur von Beratungsgesprächen 448 1.3 Qualitative Ansprüche an Beratungen 449 1.4 Beeinträchtigende Faktoren im Raum der Schule 450 1.5 Merkmale unterschiedlicher Beratungsformen 452 1.6 Abschließende Einschätzungen 454 JÖRG SCHLEE 2 Praxis der Kollegialen Beratung 456 2.1 Was ist kollegiale Beratung? 456 2.2 Rotering-Steinberg: Strukturierte Fallbesprechung oder Kollegiale Supervision 456 2.3 Tietze: Kollegiale Beratung 457 2.4 Andersen: Das Reflektierende Team 458 2.5 Schlee: Kollegiale Beratung und Supervision 459 2.6 Mutzeck: Kooperative Beratung 459 2.7 Bewertende Stellungnahme 460 2.8 Bedenken und Warnung 461 WOLFGANG MUTZECK (ÜBERARBEITET VON ANDREAS METHNER) 3 Kooperative Beratung 463 3.1 Theoretische Grundlagen 464 3.2 Methoden, Formen und Einsatzgebiete der Kooperativen Beratung 469 WILFRIED SCHUBARTH/WOLFGANG MELZER 4 Schulische Gewaltprävention und -intervention 475 4.1 Zentrale Untersuchungsergebnisse zu Gewalt an Schulen 475 4.2 Empfehlungen für die schulische Gewaltprävention und -intervention 477 4.3 Schulische Präventions- und Interventionsprogramme 481 4.4 Resümee: Gewaltprävention durch Schulentwicklung 487 VIII Schule und Recht 491 BERNHARD BAYER 1 Rechtsstellung der Schulleitung 493 1.1 Wandlungen der Aufgaben und Befugnisse von Schulleitungen 493 1.2 Die Schule als zentrale Handlungseinheit 495 1.3 Informationsrecht und Informationspflicht des Schulleiters 500 1.4 Principal-Agent-Problem in der Schule 500 1.5 Hierarchieverantwortung der Schulleitung 501 1.6 Dienstvorgesetzteneigenschaft der Schulleitung 501 1.7 Weisungsbefugnisse der Schulleitung gegenüber dem lehrenden Personal 503 1.8 Personalaktenführung 503 1.9 Hausrecht der Schulleitung 503 1.10 Schulleitung und Schulaufsicht 505 1.11 Vertretung der Schule nach außen 505 WOLFGANG BOTT 2 Beamte und Schulleiter 510 2.1 Einleitung 510 2.2 Grundbegriffe 510 2.3 Beamtenverhältnis 511 2.4 Rechtsstellung des Beamten 514 2.5 Rechtsschutz 522 2.6 Lehrkräfte im Tarifbeschäftigtenverhältnis 525 2.7 Rolle des Schulleiters 525 2.8 Schlussbemerkung 530 BERNHARD BAYER 3 Schulaufsicht 531 3.1 Die staatsrechtliche Ausgestaltung der Schulaufsicht 531 3.2 Rechtsaufsicht und Fachaufsicht 533 3.3 Reformen der Schulaufsicht: Beratung statt ‚regulativer' Aufsicht 533 3.4 ,Öffentlichkeit`, Bürgergesellschaft` und Schule 535 3.5 Autonomie - eine begriffliche Klärung 536 BERNHARD BAYER 4 Rechtliche Grundlagen und Legitimation der Schulpflicht 539 4.1 Die Entsprechung von Bildungsrecht und Bildungspflicht 540 4.2 Schulsystem, Demokratie und ‚Integration' 540 BERNHARD BAYER 5 Rechtsfragen der Leistungsbewertung und des Prüfungsrechts im Schulwesen 553 5.1 Rechtliche Grundsätze der Leistungsbewertung 553 5.2 Die Obliegenheiten des Prüflings 554 5.3 Beurteilungsspielraum bei fachlich-pädagogischen Bewertungen 555 5.4 Weisungsrecht des Schulleiters bei Notengebung durch Lehrer? 557 5.5 Rechtsschutz im Prüfungsrecht 557 5.6 Notengebung und Schulaufsicht 558 5.7 Pädagogische Freiheit des Lehrers in der Notengebung? 559 5.8 Kopfnoten - Die Einbeziehung des Ethischen in Zeugnisse 561 BERNHARD BAYER 6 Aufsichtspflicht und Unfallversicherung 564 6.1 Gestaltung und Umfang der Aufsicht 564 6.2 Gesetzliche Unfallversicherung 564 BERNHARD BAYER 7 Erziehungs- und Ordnungsmaßnahmen im Schulverhältnis 571 7.1 Erziehungsmaßnahmen 573 7.2 Ordnungsmaßnahmen 574 7.3 Verwaltungsverfahren und Verwaltungsgerichtsverfahren 574 7.4 Rechtsschuß und Vollziehbarkeit 575 7.5 Aussageverweigerungsrecht? 576 7.6 Sachverhaltsermittlung von Amts wegen 577 7.7 Der Grundsatz der Verhältnismäßigkeit 579 7.8 Verwaltungsgerichtliche Überprüfung des Grundsatzes der Verhältnismäßigkeit 583 7.9 Neue Wege: Erziehungsvereinbarungen und ,Schuluniformen` 584 BERNHARD BAYER 8 Das verfassungsrechtliche Elternrecht 588 8.1 Kooperation von Schule und Eltern 588 8.2 Kritik am Elternrecht 589 8.3 Die Frage der ,staatlichen Bewirtschaftung des Begabungspotentials' 590 8.4 Die Reichweite der staatlichen Schulhoheit in die familiäre Erziehung 591 8.5 Befugnisse und Grenzen des Elternrechts im Schulwesen: Informationsrechte 592 8.6 Ganztagsschule und Elternrecht 594 8.7 Bemerkungen zum elterlichen Sorgerecht 595 8.8 Der Status der Erziehungsberechtigten im Schulrecht 596 BERNHARD BAYER 9 Dienstunfälle von Lehrern: Tatbestand und Rechtsfolgen 600 9.1 Voraussetzungen des Vorliegens eines Dienstunfalls 600 9.2 Ersatz von Sachschäden 608 9.3 Ansprüche nach Dienstunfällen 609 Zu den Autoren 611 |
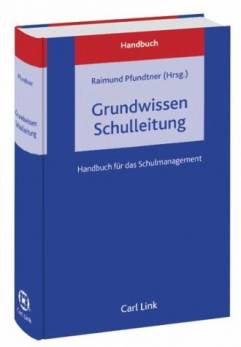
 Bei Amazon kaufen
Bei Amazon kaufen