|
|
|
Umschlagtext
"Leseförderung" ist ein Sammelbegriff für ganz unterschiedliche Verfahren, um die Lesemenge, die Bereitschaft zum Lesen oder die Lernfähigkeit aus Texten bei Kindern und Jugendlichen zu steigern.
In der vorliegenden Neubearbeitung der "Grundlagen der Lesedidaktik" werden die verschiedenen Methoden und Ansätze der Leseförderung für die Klassenstufen 2-10 - praxisorientiert dargestellt, - im Blick auf die jeweiligen Zielgruppen analysiert, - auf Kompetenzen und die Bildungsstandards bezogen, - in ihrer Wirksamkeit bewertet und - systematisierend auf ihr gemeinsames Ziel, die Steigerung von Lesekompetenz, bezogen. Damit ist beabsichtigt, Lehrerinnen und Lehrern sowohl das nötige Grundlagenwissen der Lesedidaktik als auch Anwendungskriterien für das schulische Handeln an die Hand zu geben, mit deren Hilfe lesedidaktisch fundierter Unterricht in Deutsch und in den Sachfächern geplant werden kann. Schulen sollen auf diese Weise darin unterstützt werden, Lesedidaktik zu einer Querschnittsaufgabe aller Fächer und der Schulkultur zu machen. Der Band richtet sich vordringlich an Lehrerinnen und Lehrer im Fach Deutsch und in den verschiedenen textbasierten Sachfächern, auch an Lehramtsstudierende und Refrendar(innen). Darüber hinaus leistet er für das Feld der außerschulischen Leseförderung einen systematischen Überblick über die aktuelle Lesedidaktik und die praktischen Handlungsoptionen für unterschiedliche Zielgruppen. Prof. Dr. Cornelia Rosebrock war bis zum 2023 an der Goethe-Universität, Frankfurt/Main. an der Professur "Neuere Deutsche Literaturwissenschaft". Ihre Forschungs- und Arbeitsschwerpunkte waren: Lesesozialisation / Literarische Sozialisation; Literarisches Lernen; Leseforschung; Leseförderung Dr. Daniel Nix war von 2004 bis 2008 Wissenschaftlicher Mitarbeiter im Forschungsprojekt „Leseflüssigkeit" an der Frankfurter Goethe-Universität. Nach erfolgreichem Abschluss seines Referendariats ist er Studiendirektor an einem hessischen Gymnasium. Er engagiert sich neben dem Deutsch- und Politikunterricht in der Schulleitung und ist bundesweit in der Lehrerfortbildung, Schwerpunkt Leseförderung, tätig. Rezension
In mittlerweile bereits 10. aktualisierter und abermals erweitzerter Auflage ist dieses Standardwerk zur Lesedidaktik nochmals gewachsen. Leseförderung ist seit den großen Schulleistungsstudien zu Beginn des Jahrhunderts ein zentrales didaktisches Thema. Lesen ist von zentraler Bedeutung für Schullaufbahn und Bildungskarriere; Lesen ist heute das elementare Medium des Lernens. Traditionell aber wird in Deutschland Lesen weniger im Kontext von Lernen und Wissenserwerb gesehen als vielmehr im Kontext von Belesenheit im Sinne der Schönen Literatur. Leseförderung wird deshalb auch weithin als Verlockung zur (Buch-)Lektüre verstanden, aber Leseförderung und Lesedidaktik sind weitaus mehr und sehr viel differenzierter, - wie dieses Buch anschaulich und praxisnah vermittelt. "Leseförderung" ist ein Sammelbegriff für ganz unterschiedliche Verfahren, um die Lesemenge, die Bereitschaft zum Lesen oder die Lernfähigkeit aus Texten bei Kindern und Jugendlichen zu steigern. In der vorliegenden Neubearbeitung der "Grundlagen der Lesedidaktik" werden die verschiedenen Methoden und Ansätze der Leseförderung für die Klassenstufen 2-10 praxisorientiert dargestellt.
Dieter Bach, lehrerbibliothek.de Verlagsinfo
Schlagworte: außerschulische Förderung, Bildungsstandards, Kompetenzorientierung, Lehrkräftefortbildung, Lesedidaktik, Leseförderung, Lesekompetenz, Schulkultur, Unterrichtspraxis, Zielgruppenorientierung Inhaltsverzeichnis
1 Einleitung 7
2 Ein Modell von Lesekompetenz aus didaktischer Perspektive 13 2.1 Wozu ein theoretischer Hintergrund? 13 2.2 Die Prozessebene: Kognitive Anforderungen des Leseakts 16 2.3 Die Subjektebene: Lektüre und Persönlichkeit 20 2.4 Die soziale Ebene: Lesen in Handlungszusammenhängen 24 3 Lautleseverfahren 27 3.1 Was versteht man unter Lautleseverfahren? 27 3.2 Für welche Schüler:innen sind Lautleseverfahren angebracht? 27 3.3 Was ist Leseflüssigkeit? Wie hängt sie mit dem Textverstehen zusammen? 30 3.4 Wie kann man Leseflüssigkeit diagnostizieren? 34 3.5 Wie man Leseflüssigkeit fördern kann: Lautleseverfahren 39 3.6 Lautleseverfahren auf Wortebene 49 3.7 Geeignete Texte für Lautleseverfahren 51 3.8 Effektivität der Lautleseverfahren 52 4 Vielleseverfahren 55 4.1 Was versteht man unter Vielleseverfahren? 55 4.2 Für welche Schüler:innen sind Vielleseverfahren angebracht? 57 4.3 Wie hängt die Lesemenge mit dem Textverstehen zusammen? 59 4.4 Die Wirksamkeit von Vielleseverfahren 64 4.5 Lesesozialisation: Ein Exkurs zum Verlauf der Aneignung von Lesekompetenz 73 5 Lesestrategien 81 5.1 Was versteht man unter Lesestrategien? 81 5.2 Für welche Schüler:innen ist die Vermittlung von Lesestrategien angebracht? 82 5.3 Wie können Lesestrategien gelehrt und gelernt werden? 88 5.3.1 Verankerung von Lesetechniken im deklarativen Wissensbestand 89 5.3.2 Lesetechniken anwenden und üben 92 5.3.3 Selbstregulierter Umgang mit Lesetechniken 93 5.4 Welche Vermittlungslogiken gibt es für den Unterricht? 94 5.4.1 Lesestrategieprogramme 94 5.4.2 Kooperative Verfahren 97 5.4.3 Grafische Strukturierungen 100 5.5 Herausforderungen bei der Strategievermittlung 102 6 Sachtextlektüre: Lernen in Wissensdomänen 105 6.1 Was sind Sachtexte? 105 6.2 Fachspezifik der Inhalte und der Textstruktur 107 6.2.1 Vorwissensstrukturen 108 6.2.2 Leserseitiges Engagement 111 6.2.3 Muster der Textorganisation 116 6.3 Bilder in Lehrtexten: Hilfe und Problem 122 7 Digitales Lesen 125 7.1 Was versteht man unter digitalem Lesen? 125 7.2 Bildschirmlesen 130 7.3 Online-Lesen 136 7.4 Wie kann man digitales Lesen fördern? 141 7.4.1 Bildschirmlesen fördern 142 7.4.2 Online-Lesen fördern 144 7.4.3 Deep Reading entwickeln 148 7.5 Exkurs: Lesen mit Künstlicher Intelligenz 149 8 Leseanimation 153 8.1 Was versteht man unter Leseanimation? 153 8.2 Für welche Schüler:innen sind leseanimierende Verfahren angebracht? 154 8.3 Leseanimation und Lesemotivation 156 8.4 Lesemotivation unterstützen 161 8.5 Leseanimation mit Kinder- und Jugendliteratur 164 8.6 Welche Verfahren der Leseanimation gibt es? 167 8.6.1 Leseförderung im Rahmen des Deutschunterrichts 170 8.6.2 Fächerübergreifende Leseförderprojekte 173 8.6.3 Verfahren über die Schule hinaus 175 9 Literarische Lesekultur entwickeln 179 9.1 Kinderliteratur in der literarischen Sozialisation 179 9.2 Lesehaltungen 181 9.3 Anforderungen literarischer Texte auf der Prozessebene 185 9.4 Potentiale literarischen Lesens auf der Subjekt- und auf der sozialen Ebene 189 9.5 Lesedidaktik und literarisches Lernen 191 10 Zur praktischen Integration der Verfahren 197 10.1 Leseförderung als isolierte Maßnahme 197 10.2 Lesedidaktisch ausgerichtete Unterrichtsprojekte im Rahmen des Regelunterrichts 198 10.3 Schulinternes Lesecurriculum 200 Literatur 205 |
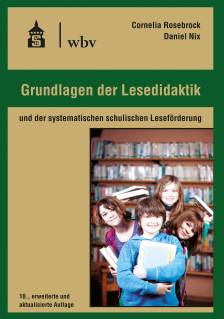
 Bei Amazon kaufen
Bei Amazon kaufen