|
|
|
Umschlagtext
Im Gregorianischen Choral hat sich seit dem 4. Jahrhundert das intensive Ringen betender Menschen um ihre Gotteserfahrung und ihr Gottesbild niedergeschlagen. Für das intime „Du“ ist darin genauso Platz wie für das unfassliche und unergründliche Geheimnis, vor dem menschliche Worte verstummen müssen.Hier erweist der Gregorianische Choral seine wahre Qualität als Quelle und Inspiration aller christlichen Musik weit überkonfessionelle Grenzen hinweg. Darüber hinaus ist er bis heute Impulsgeber für Bühnen-, Chor-, Orchester- und Orgelwerke.
Stefan Klöckner beschreibt kundig und spannend Entstehung,Formen, Verschriftung, Geschichte und Rezeption des Gregorianischen Chorals von den Anfängen bis heute. Die Betrachtung ausgewählter Gesänge beeindruckt außerdem aufgrund der spirituellen Durchdringung der gesungenen biblischen Botschaftund belegt eindringlich, dass diese Melodien mehr sind als Behübschungen eines antiquierten Kultes. Die Beispiele zeugen von einer Aktualität der Aussage und der unbändigen Kraft des Fragens und Sagens, des Trauerns und Jubelns, des Fluchens und Segnens, womit sie auch heute eine Herausforderung für alle bieten, die Gottesdienste gestalten und feiern. Mit vielen Abbildungen und Notenbeispielen sowie einem Glossar und ausgewählten Zitaten. Kirchenmusikdirektor Prof. Dr. theol. Stefan Klöckner: Ausbildung als Gesangslehrer an der Folkwang Hochschule in Essen, Studium der Katholischen Theologie und Musikwissenschaft in Wien, Münster und Tübingen. Seit 1999 Inhaber der Professur für Gregorianik und Liturgik (seit 2009 Musikwissenchaft/Gregorianik und Geschichte der Kirchenmusik) an der Folkwang Universität der Künste Essen; Leiter der "Münsterschwarzacher Choralkurse". 2012 rief er die deutschlandweit erste Hochschulausbildung im Fach Gregorianik ins Leben. www.stefan-kloeckner.com Rezension
Stefan Klöckner, Inhaber des Lehrstuhls für Gregorianik und Geschichte der Kirchenmusik an der Folkwang Universität der Künste (Essen), zieht in dieser Monographie mit klarer Feder eine beeindruckende musikalische Rezeptionslinie: Er verfolgt den roten Faden des Gregorianischen Chorals vom Entstehungsprozess im Mittelalter bis in neueste Zeit. Dabei gelingt es ihm hervorragend, die Geschichte des Chorals mit der Rezeption zu verknüpfen, indem er zu Beginn die begrifflichen Grundlagen (v.a. Kap. II-IV) schafft und die Modellhaftigkeit darlegt, danach die Entstehung eines Chorals schildert (Kap. V), eingehende Analysen an Beispielen vornimmt (Kap. VI) und schließlich (Kap. VII-VIII) das Fortwirken dieser durch und durch europäischen Musiktradition von der Verarbeitung gregorianischer Melodien in Renaissancekompositionen bis hin in die französische Orgelmusik des 20. Jahrhunderts (Tournemire, Langlais u.a.) beschreibt. Gregorianische Melodien inspirieren bekanntlich bis heute namhafte Komponisten und Improvisatoren, sehr häufig, aber nicht nur auf der Orgel.
Das abschließende Wort des Autors ist sehr persönlicher Natur und gibt den Blick frei auf ein gediegenes, in Jahrzehnten gewachsenes Gottesdienstverständnls. Für den Schulunterricht kann besonders das Kapitel über die Entstehung eines gregorianischen Gesangs (Kap. V) empfohlen werden: Hier schreitet der Leser durch eine imaginäre Werkstatt mit drei Räumen. Im ersten Raum werden die Texte kompiliert, im zweiten erhält die ausgewählte (oder bisweilen auch recht bunt zusammengewürfelte) Textpassage eine Melodie innerhalb der gregorianischen Tonarten. Im dritten Raum wird dem entstandenen Wort-Ton-Geflecht schließlich mithilfe der nuancenreichen Neumen eine rhythmische Gestalt gegeben. Mindestens dieses Kapitel ist für Oberstufenkurse oder als Brückenlektüre zum Musikstudium wärmstens als grundlegende Einführung in die Gregorianik zu empfehlen. Abbildungen aus wichtigen Choralhandschriften sowie Noten- und Neumenbeispiele unterstützen in allen Kapiteln die flüssigen und gut lesbaren Texte. Die umfangreiche und auf den ersten Blick vielleicht abschreckend wirkende Terminologie der Gregorianik wird durch das Glossar (von A wie "adiastematisch" über O wie "Oktoechos" bis Z wie "Zweites Vatikanisches Konzil") sowie die Neumentabelle (S.250-256) lückenlos erschlossen. Klöckner spart in dieser lesenswerten Monographie nicht mit Details, überfrachtet die Darlegungen aber auch nicht unnötig, so dass ein ansprechendes und empfehlenswertes Buch entstanden ist, das sowohl als Einführung in diesen speziellen Zweig der Musikgeschichte wie auch als vertiefende Studie gelesen werden kann. Johannes Groß, www.lehrerbibliothek.de Verlagsinfo
Im Gregorianischen Choral hat sich seit dem 4. Jahrhundert das intensive Ringen betender Menschen um ihre Gotteserfahrung und ihr Gottesbild niedergeschlagen. Für das intime „Du“ ist darin genauso Platz wie für das unfassliche und unergründliche Geheimnis, vor dem menschliche Worte verstummen müssen.Hier erweist der Gregorianische Choral seine wahre Qualität als Quelle und Inspiration aller christlichen Musik weit überkonfessionelle Grenzen hinweg. Darüber hinaus ist er bis heute Impulsgeber für Bühnen-, Chor-, Orchester- und Orgelwerke. Stefan Klöckner beschreibt kundig und spannend Entstehung,Formen, Verschriftung, Geschichte und Rezeption des Gregorianischen Chorals von den Anfängen bis heute. Die Betrachtung ausgewählter Gesänge beeindruckt außerdem aufgrund der spirituellen Durchdringung der gesungenen biblischen Botschaftund belegt eindringlich, dass diese Melodien mehr sind als Behübschungen eines antiquierten Kultes. Die Beispiele zeugen von einer Aktualität der Aussage und der unbändigen Kraft des Fragens und Sagens, des Trauerns und Jubelns, des Fluchens und Segnens, womit sie auch heute eine Herausforderung für alle bieten, die Gottesdienste gestalten und feiern. Inhaltsverzeichnis
Vorwort zur Reihe bibel & musik
Vorwort des Autors I. Einführung Die anderen Konfessionen Der Versuch einer Definition Gregorianischer Choral in der Musikgeschichte Spirituelle Aktualität: Nachruf oder Weckruf? II. Formen des Gregorianischen Chorals Hymnen Antiphonale und responsoriale Gesänge Weitere Gesänge des Stundengebets Responsoriale Gesänge Das Proprium missae Das Ordinarium missae Tropen III. Die Entstehung des Gregorianischen Chorals Ein Bild - eine Legende: Papst Gregor und die Taube Die Entstehung des Gregorianischen Choras und die karolingische "Renovatio" Der musikalische Austausch zwischen Rom und Franken Ein Blick in die damalige Praxis: Die Institutio canonicorum der Synode von Aachen (816) IV. Verschriftung des Gregorianischen Chorals Gesprochenes und geschriebenes Wort Die Niederschrift der Texte Erste Handschriften Ein Paradigmenwechsel: Diastematische Notationen V. Wie ein gregorianischer Gesang entsteht - ein Gang durch eine imaginäre Werkstatt mit drei Räumen Die Kompilation der Texte Die gregorianischen Tonarten - oder: Warum es nicht egal ist, welcher Text mit welcher Melodie erklingt Die rhythmische Gestalt des erklingenden Wortes VI. Betrachtung einiger Stücke aus dem gregorianischen Repertoire Communio "Cum invocarem te" Introitus "Salus populi" Communio "Et si coram hominibus" Communio "Vidimus stellam" Communio "Videns Dominus" Communio "Dominus Iesus" VII. Gregorianischer Choral - Paradigma kirchenmusikalischer Reformen im 14. und 16./17. Jahrhundert VIII. Gregorianischer Choral als Zitat "Mêmes textes - mêmes mélodies" Inhaltliche Brücken Gregorianische Melodien als Grundlage von geistlichen Kompositionen in Renaissance und Barock Gregorianische Melodien in Kompositionen des 19. und des 20. Jahrhunderts IX. Ein persönliches Wort zum Schluss "Man bräuchte nur..." Was zählt, ist Qualität Das "erklingende Wort" und das Gottesbild Anmerkungen Anhang Glossar Neumentabelle Bildnachweis |
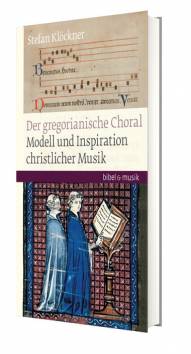
 Bei Amazon kaufen
Bei Amazon kaufen