|
|
|
Umschlagtext
Gnostisches Denken ist aktuell, auf ihm beruhen zahlreiche spirituelle Strömungen der Gegenwart. Die historische Gnosis am Beginn unserer Zeitrechnung war eine revolutionäre Bewegung, die sich erstmals der Erfahrung der Einsamkeit des Menschen im Kosmos stellte.
Das Buch von Hans Jonas ist ein Standardwerk, das die Grundbegriffe definiert und die Vielfalt religiöser Phänomene anschaulich beschreibt. Der Begriff >Gnosis< faßt im einzelnen sehr unterschiedliche religiöse Bewegungen zusammen. Sie alle eint ihre Ablehnung orthodoxer Glaubensmhalte. Entstanden am Ende der Antike, stellte die Gnosis im hellenistischen Umbruch der Kulturen eine machtvolle revolutionäre Bewegung dar, die keineswegs nur Eingeweihten vorbehalten war und deren Unterstrom vom frühen Mittelalter bis in die neueste Zeit anhält. Die Gnosis-Forschung, die in den letzten Jahren eine Konjunktur erlebte, hat mit Hans Jonas begonnen. Er hat sie aus der speziellen Theologie- und Kirchengeschichte herausgelöst und als kulturhistorische, religionsphilosophi-sche und -psychologische Erscheinung gedeutet. Der entscheidende Grundzug gnostischen Denkens besteht m einem radikalen Dualismus, in der strikten Trennung von Gott und Welt und von Mensch und Welt. Die Gottheit des Gnostikers ist absolut außerweltlich, ihr Wesen ist dem des Universums fremd, das sie weder geschaffen hat noch regiert und zu dem sie die vollkommene Antithese bildet. Diese Welt ist das Werk niederer Mächte, die den wahren Gott nicht kennen. Jonas beschreibt die Entdeckungsgeschichte der Quellen aus Qumran und Nag Hammadi, er erläutert ausführlich die Symbole des gnostischen Weltverständnisses - und ihre poetische Qualität: der fremde Gott, das fremde Leben, Verbannung, Exil, Licht und Finsternis, Geworfensein, Betäubung, Schlaf, Trunkenheit, Erweckungsrufe. Grundsignatur der gnostischen Religion ist die beängstigende Entdeckung der Einsamkeit und Entfremdung des Menschen im Kosmos. Mit dieser Erfahrung war die Vernunftgewißheit der Antike, die den Logos erfunden hatte, erschüttert. Doch das Erschrecken vor der kosmischen Fremdheit führte zu einem neuen Verständnis des Menschen, zur Forderung nach Mitmenschlichkeit und der Sehnsucht nach Erlösung. Diese »Emanzipation der Seele vom Weltzwang« (Peter Sloterdijk) unterscheidet die ernsthafte Gnosis von modischen und kommerziellen Erscheinungen der Gegenwart. In diesem Buch, erstmals 1958 m englischer Sprache erschienen, seitdem immer wieder überarbeitet und aktualisiert, hat Hans Jonas seine Forschungen für ein breiteres Publikum zusammengefaßt zu einer Wesensanalyse und Kritik der Gnosis, die bis heute maßgeblich geblieben ist. Für die deutsche Ausgabe wurde der Text revidiert, mit Anmerkungen und einer umfassenden Bibliographie versehen; ein Nachwort skizziert die jüngste Forschung sowie Jonas' religionsphilosophischen Ansatz. Von Hans Jonas (1903-1992) erschienen im Insel Verlag: Das Prinzip Verantwortung, 1979; Macht oder Ohnmacht der Subjektivität, 1981; Technik, Medizin und Ethik, 1985; Philosophische Untersuchungen und metaphysische Vermutungen, 1992; Das Prinzip Leben. Ansätze zu einer philosophischen Biologie, 1994; im Suhrkamp Verlag u. a.: Der Gottesbegriff nach Auschwitz, 1987; Materie, Geist und Schöpfung, 1988. - 1987 erhielt Hans Jonas den Friedenspreis des deutschen Buchhandels. Christian Wiese, Dr. phil., ist Wissenschaftlicher Mitarbeiter des Salomon-Ludwig-Stein-heim-Insütuts für deutsch-jüdische Geschichte. Rezension
Der Philosoph Hans Jonas, bekannt geworden besonders durch sein "Prinzip Verantwortung", hat sich nicht nur mit der Ethik beschäftigt, als einer der letzten großen Universal-Gelehrten des 20. Jhdts. hat er auch dieses Buch zur Gnosis vorgelegt, das als ein Standardwerk zur Thematik gilt. In verständlicher Weise verfasst, verdeutlicht es die Grundanliegen und Grundauffassungen dieser antiken religiös-philosophischen Weltanschauung, erläutert die Hauptlehre der Gnosis und deren Bild- und Symbolsprache und geht dann differenziert auf verschiedene gnostische Systeme ein (Simon Magus, Marcion, Velentian etc.), bevor der Bezug zur griechichen Klassik und zur Philosophie unserer (Post-)Moderne ausgebreitet wird. Ein Klassiker!
Jens Walter, lehrerbibliothek.de Verlagsinfo
Hans Jonas Biographisches 1903 Am 10. Mai wird Hans Jonas als Sohn des Textilfabrikanten Gustav Jonas und von Rosa Horowitz, der Tochter des Krefelder Oberrabbiners Jakob Horowitz, in Mönchengladbach geboren. 1916 Tod des jüngeren Bruders Ludwig. Bar-Mizwa. 1918 Novemberrevolution. Zuwendung zum Zionismus und zum Unwillen des Vaters Mitglied eines zionistischen Zirkels in Mönchengladbach. 1921 Abitur. Im Sommersemester Aufnahme des Studiums der Philosophie und Kunstgeschichte an der Universität Freiburg bei Edmund Husserl, Martin Heidegger und Jonas Cohn. Begegnung mit Karl Löwith. Mitglied der zionistischen Studentenbewegung IVRIA. 1921 Im Wintersemester Umzug nach Berlin. Bis 1923 Studium der Philosophie an der Friedrich-Wilhelms-Universität Berlin (u.a. bei Eduard Spranger, Ernst Troeltsch, Hugo Gressmann, Ernst Sellin und Eduard Meyer) und der Judaistik an der Hochschule für die Wissenschaft des Judentums (u.a. bei Julius Guttmann, Harry Torczyner und Eduard Baneth). Freundschaft mit Leo Strauss und Günther Stern (Anders). Engagement in der zionistischen Verbindung Makkabäa und im Kartell Jüdischer Verbindungen (KJV). 1923 März bis Oktober landwirtschaftliche Ausbildung (Hachschara) in Wolfenbüttel als Vorbereitung für die Auswanderung nach Palästina. Beschluß der Fortsetzung des Studiums in Deutschland. Studienjahr 1923/24 in Freiburg. 1924 Zum Wintersemester Wechsel an die Universität Marburg. Studium bei Martin Heidegger und Rudolf Bultmann. Beginn der Freundschaft mit Hannah Arendt. Beide bilden gemeinsam u.a. mit Gerhard Nebel, Karl Löwith, Hans-Georg Gadamer, Gerhard Krüger und Günther Stern den Kreis von Philosophiestudenten um Heidegger. Beginn der Beschäftigung mit der Gnosis. Nach der Entscheidung zur Promotion zwischenzeitlich Studien in Heidelberg, Bonn und Frankfurt am Main. 1928 Rückkehr nach Marburg. Promotion bei Martin Heidegger mit der Arbeit "Der Begriff der Gnosis". Wintersemester 1928/29 Studium an der Pariser Sorbonne. 1929 Beginn der Liebesbeziehung zu Gertrud Fischer. 1930 Augustin und das paulinische Freiheitsproblem. Ein philosophischer Beitrag zur Genesis der christlich-abendländischen Freiheitsidee. Bis 1933 Privatstudien in Köln, Frankfurt am Main und Heidelberg. Dort Zugehörigkeit zum Kreis um den Soziologen Karl Mannheim. Freundschaft mit Dolf Sternberger. Plan einer Habilitation und Vorbereitung auf die Tätigkeit als Privatdozent. 1933 "Machtergreifung" Hitlers. Angesichts des antijüdischen Boykotts beschließt Jonas, Deutschland zu verlassen. Ende August Emigration nach London und Arbeit an der Publikation seines Gnosis-Werks. Reisen nach Holland, in die Schweiz und nach Paris zu Hannah Arendt und Günther Anders. 1934 Bei Vandenhoeck & Ruprecht in Göttingen erscheint Gnosis und spätantiker Geist. Erster Teil: Die mythologische Gnosis. 1935 Zu Pessach Ankunft in Palästina. Beginn der Freundschaft mit Gershom Scholem, Hans Lewy, Hans-Jakob Polotsky, George Lichtheim und Shmuel Sambursky. Gründung des Pilegesch-Kreises. 1936 Zu Pessach Besuch der Eltern in Jerusalem. Beginn der arabischen Aufstände gegen das zionistische Siedlungsprogramm. Jonas tritt freiwillig der Selbstverteidigungsorganisation Hagana bei. 1937 Zu Purim erste Begegnung mit Lore Weiner. Vom Herbst an Aufenthalt auf der Insel Rhodos und Arbeit am 2. Teil des Gnosisbuchs. 1938 Im Januar Nachricht vom Tod des Vaters. Rückkehr nach Jerusalem. Nach dem Novemberpogrom überläßt Rosa Jonas ihrem in Dachau inhaftierten Sohn Georg ihr Einwanderungszertifikat für Palästina. Die Verschärfung der Begrenzung jüdischer Einwanderung durch die Briten 1939 verhindert die Ausreise der Mutter aus Deutschland. Lehraufträge an der Hebräischen Universität. Nach dem Tode Edmund Husserls hält Jonas dort die akademische Gedenkrede. 1939 Unmittelbar nach Ausbruch des Krieges am 1. September formuliert Jonas den Kriegsaufruf Unsere Teilnahme an diesem Kriege. Ein Wort an jüdische Männer und meldet sich freiwillig bei der britischen Armee. 1940 Ausbildung im englischen Übungslager Sarafant. Mitglied der First Palestine Anti-Aircraft Battery der britischen Armee. In der Folgezeit Einsätze in Haifa gegen Luftangriffe aus Damaskus und Beirut. 1942 Deportation der Mutter ins Ghetto Lodz, später nach Auschwitz, wo sie ermordet wird. 1943 Heirat mit Lore Weiner in Haifa 1944 Jonas wird Mitglied der neu gebildeten Jewish Brigade Group. Ausbildung u.a. in Alexandria. Von dort aus bis zum Ende des Krieges Einsatz in Süditalien. In dieser Zeit "Lehrbriefe" über seinen philosophischen Neuansatz an seine Frau. 1945 Im Juli zieht Jonas mit seiner Einheit durch Deutschland. Stationierung in Venlo und Wiedersehen mit Mönchengladbach. Erst hier erfährt Jonas von der Ermordung seiner Mutter. Reisen nach Göttingen, Marburg und Heidelberg. Wiederbegegnung mit Karl Jaspers und Rudolf Bultmann. Im November Rückkehr nach Palästina. 1946 Wohnung im arabischen Dorf Issawyje. Dozent an der Hebräischen Universität Jerusalem und Lehraufträge am English Council of Higher Studies. 1948 Unabhängigkeitserklärung des Staates Israel und Ausbruch des Krieges. Umzug nach Jerusalem in die Alfasi-Straße. Jonas wird als Artillerieoffizier der israelischen Armee zum Dienst herangezogen. Tod von Lores Bruder Franz bei Dschenin. Geburt der Tochter Ayalah. 1949 Beurlaubung von der Armee. Übersiedlung nach Kanada als Fellow der Lady-Davis-Foundation an der McGill University Montreal. Philosophische Lehrtätigkeit am dortigen Dawson College. 1950/51 Zunächst Gastprofessor, später Associate Professor für Philosophie am Carleton College in Ottawa. Geburt des Sohnes Jonathan. Freundschaft mit Ludwig von Bertallanfy. In dieser Zeit Reisen nach New York, Chicago und Cincinnati. Wiederbegegnung mit Hannah Arendt, Günther Anders und Karl Löwith. 1952 Ablehnung der Berufung als Philosophieprofessor an die Hebräische Universität Jerusalem. Auseinandersetzung mit Gershom Scholem über seinen "Verrat am Zionismus". Erste Europareise zum Internationalen Kongreß für Philosophie in Brüssel. Abstecher nach München und Wiederbegegnung mit Gertrud Fischer. Ablehnung eines Rufes an die Universität Kiel. 1954 Gnosis und spätantiker Geist. Teil II, 1: Von der Mythologie zur mystischen Philosophie. 1955 Geburt der Tochter Gabrielle. Berufung als Professor an die New School for Social Research in New York (wo Jonas bis 1976 lehrt; in diese Zeit fallen Gastprofessuren u.a. an der Princeton University, der Columbia University und der University of Chicago). Niederlassung in New Rochelle, Freundschaft mit Kurt und Nelly Friedrichs und mit Wilhelm und Trude Magnus. In New York Zugehörigkeit zum Freundeskreis um Hannah Arendt und Heinrich Blücher, u.a. mit Adolph Lowe, Aron Gurwitsch und Paul Tillich. 1958 The Gnostic Religion: The Message of the Alien God and the Beginnings of Christianity. Akademischer Festvortrag an der New School über "The Practical Uses of Theory". Beginn der Auseinandersetzung mit der modernen Technik. 1959/60 Jonas verbringt sein Sabbatical in München. Vortragsreisen in Deutschland. 1961 Ingersoll Lecture an der School of Divinity der Harvard University über "Immortality and the Modern Temper". 1963 Zerwürfnis mit Hannah Arendt wegen ihres Buches über den Eichmann-Prozeß in Jerusalem - bis zur Versöhnung vergehen beinahe zwei Jahre. 1964 Jonas' Vortrag über "Heidegger and Theology" an der Drew University in New Jersey macht Furore. Vortragsreise nach Deutschland. Erst 1969 kommt es zu einer kurzen persönlichen Begegnung mit Heidegger in Zürich. 1966 The Phenomenon of Life. Toward a Philosophical Biology. 1967 "Philosophische Reflexionen über Experimente mit menschlichen Subjekten" vor der American Academy of Arts and Sciences in Boston. Übergang zu konkreten bio- und medizinethischen Themen wie Hirntod und Organtransplantation. 1969 Founding Fellow am interdisziplinären Hastings Center-on-Hudson. 1973 Organismus und Freiheit. Ansätze zu einer philosophischen Biologie. 1974 Philosophical Essays. From Ancient Creed to Technical Man. 1976 Rede auf der Gedenkfeier für Rudolf Bultmann in Marburg. Emeritierung. 1978 On Faith, Reason and Responsibility: Six Essays. 1979 Das Prinzip Verantwortung. Versuch einer Ethik für die technologische Zivilisation wird zu einem überwältigenden Erfolg in Deutschland. 1982/83 Eric-Voegelin-Gastprofessur an der Ludwig-Maximilans-Universität München 1984 Verleihung des Leopold-Lukas-Preises der Evangelisch-Theologischen Fakultät der Eberhard-Karls-Universität Tübingen. Preisrede über Der Gottesbegriff nach Auschwitz. Eine jüdische Stimme. 1985 Technik, Medizin und Ethik. Zur Praxis des Prinzips Verantwortung. 1987 Verleihung des Friedenspreises des Deutschen Buchhandels, Rede über "Technik, Freiheit und Pflicht". Empfang des Großen Bundesverdienstkreuzes der Bundesrepublik Deutschland und der Ehrenbürgerwürde der Stadt Mönchengladbach. 1988 Materie, Geist und Schöpfung. Kosmologischer Befund und kosmogonische Vermutung. 1991 Ehrendoktorwürde der Universität Konstanz 1992 Ehrendoktorwürde der Freien Universität Berlin 1992 Philosophische Untersuchungen und metaphysische Vermutungen 1993 Philosophie. Rückschau und Vorschau am Ende des Jahrhunderts. Am 30. Januar Entgegennahme des Premio Nonino in Urbino, Italien. Am 5. Februar stirbt Hans Jonas in New Rochelle bei New York. Er ist im jüdischen Teil des ökumenischen Friedhofs von Hastings im Staate New York begraben. Inhaltsverzeichnis
Vorwort 11
Vorwort zur zweiten Auflage 19 Bemerkung anläßlich der dritten Auflage (1970) 20 1 Einleitung - Ost und West im Hellenismus 23 Die Rolle des Westens 24 Die griechische Kultur am Vorabend der Eroberungen Alexanders 25 Kosmopolitismus und die neue griechische Kolonisation 27 Die Hellenisierung des Ostens 29 Der späte Hellenismus - Wandel von einer weltlichen zu einer religiösen Kultur 31 Die vier Stadien der griechischen Kultur 32 Die Rolle des Ostens 33 Der Osten am Vorabend der Eroberungen Alexanders 35 Der Osten unter dem Hellenismus 41 Das Wieder-Auftauchen des Ostens 47 Erster Teil Gnostische Literatur - Hauptlehren, symbolische Sprache 53 2 Die Bedeutung von Gnosis und der Umfang der gnostischen Bewegung 55 Das geistige Klima der Epoche 55 Die Bezeichnung Gnosis 56 Der Ursprung der Gnosis 57 Die Eigenart des gnostischen »Wissens« 59 Überblick über die Quellen 63 Sekundäre oder indirekte Quellen 63 Primäre oder direkte Quellen 65 Abriß gnostischer Hauptlehren 69 Theologie 69 Kosmologie 70 Anthropologie 71 Eschatologie 72 Sittlichkeit 73 3 Gnostische Bildwelt und symbolische Sprache 75 Das »Fremde« 76 »Jenseits«, »Außerhalb«, »diese« Welt und »jene« Welt 78 »Welten« und »Äonen« 79 Das Weltgehäuse und das »Wohnen« 82 »Licht« und »Finsternis«, »Leben« und »Tod« 84 »Mischung«, »Zersplitterung«, »Einheit« und »Vielheit« 86 »Fall«, »Sinken«, »Gefangennahme« 90 Verlorenheit, Angst, Heimweh 93 Betäubung, Schlaf, Trunkenheit 96 Der Lärm der Welt 102 Der »Ruf von außerhalb« 103 Der »fremde Mann« 104 Der Inhalt des Rufes 109 Die Antwort auf den Ruf 115 Gnostische Allegorie 120 Eva und die Schlange 122 Kain und der Schöpfer 125 Prometheus und Zeus 126 Anhang: Glossar mandäischer Begriffe 128 Zweiter Teil Gnostische Systeme 131 4 Simon Magus 135 5 Das »Lied von der Perle« 144 Der Text 145 Kommentar 148 Schlange, Meer, Ägypten 148 Das unreine Gewand 151 Der Brief 152 Der Sieg über die Schlange und der Aufstieg 153 Das himmlische Gewand und das Abbild 155 Das transzendente Selbst 156 Die Perle 158 6 Die Engel, die die Welt erschufen - Das Evangelium des Marcion 164 Die Engel, die die Welt machten 166 Das Evangelium des Marcion 171 Marcions Sonderstellung im gnostischen Denken 171 Erlösung nach Marcion 173 Die zwei Götter 175 »Die frei geschenkte Gnade« 178 Marcions asketische Moral 179 Marcion und die Schrift 181 7 Der Poimandres des Hermes Trismegistos 183 Der Text 184 Kommentar 189 Der Ursprung des Göttlichen Menschen 190 Der Abstieg des Menschen und die Planetenseele 192 Die Einheit von Mensch und Natur - das Motiv des Narziß 197 Der Aufstieg der Seele 201 Die Ur-Anfänge 206 8 Die Valentinianische Spekulation 212 Das spekulative Prinzip des Valentinianischen Systems 212 Das System 219 Die Entwicklung des Pleroma 219 Die Krisis im Pleroma 220 Die Folgen der Krisis und die Funktion des »Horos« 221 Die Wiederherstellung des Pleroma 223 Die Ereignisse außerhalb des Pleroma 225 Die Leiden der unteren Sophia 226 Die Entstehung der Materie 227 Die Ableitung der einzelnen Elemente 229 Der Demiurg und die Weltschöpfung 229 Erlösung 234 Anhang I 237 Die Stellung des Feuers unter den Elementen 237 Anhang II 239 Das System des Apokryphen des Johannes 239 9 Schöpfung, Weltgeschichte und Erlösung nach Mani 248 Manis Methode und seine Berufung 248 Das System 252 Die Urprinzipien 252 Der Angriff der Finsternis 255 Die Friedfertigkeit der Lichtwelt 257 Die erste Schöpfung - der Ur-Mensch 258 Die Niederlage des Ur-Menschen 260 Das Opfer und die Vermischung der Seele 261 Die »zweite Schöpfung«, der »lebendige Geist« und die Befreiung des Ur-Menschen 264 Die Erschaffung des Makrokosmos 266 Die »dritte Schöpfung« - der »Gesandte« 267 Der Ursprung der Pflanzen und Tiere 268 Die Erschaffung Adams und Evas 269 Die Sendung des Licht-Jesus - der Jesus patibilis 271 Praktische Folgerungen - Manis asketische Ethik 274 Die Lehre von den letzten Dingen 276 Zusammenfassung - zwei Typen des Dualismus in der gnostischen Spekulation 279 Dritter Teil Gnosis und klassisches Denken 283 10 Der Kosmos gemäß griechischer und gnostischer Bewertung 287 Die Idee des »Kosmos« und des Menschen Ort darin 287 Der griechische Standpunkt 287 Kosmosfrömmigkeit als Rückzugsposition 294 Die gnostische Umwertung 296 Die griechische Reaktion 301 Das Schicksal und die Sterne 303 Formen der siderischen Frömmigkeit in der Antike 303 Die gnostische Umwertung 309 Die griechische Reaktion - das brüderliche Verhältnis von Mensch und Sternen 312 Die akosmische Brüderschaft der Erlösung 314 11 Tugend und Seele in der griechischen und in der gnostischen Lehre 316 Die Idee der Tugend - ihr Fehlen in der Gnosis 316 Gnostische Ethik 321 Nihilismus und Libertinismus 321 Askese, Selbstverleugnung und neue »Tugend« 327 Arete und die christlichen »Tugenden« 330 Tugend bei Philo Judäus 331 Gnostische Psychologie 334 Die dämonologische Interpretation der Innenwelt 334 Die Seele als etwas Weibliches 337 Ekstatische Erleuchtung 338 Schluß - der unbekannte Gott 342 12 Die neuesten Entdeckungen auf dem Gebiet der Gnosis 345 Bemerkungen zur Nag Hammadi-Bibliothek 346 Die Hypostasis der Archonten (Cod. II. 4) 357 Die Schrift vom Ursprung der Welt (Cod. II. 5) 358 Das Evangelium der Wahrheit (EV - Cod. I. 2) 365 Nachtrag 376 13 Epilog - Gnostizismus, Existentialismus und Nihilismus 377 »Revolte wider die Weltflucht« Nachwort von Christian Wiese 401 »Wissenschaft als persönliches Erlebnis« 401 »Existentialistische Lesung der Gnosis« 406 »Unendlichkeit der Deutbarkeit« 411 »Weltabenteuer Gottes« und »Weiterwohnlichkeit der Welt« 418 »Ein Bekenntnis des Faszinosums« 426 Anmerkungen 431 Bibliographie 485 Namenregister 527 Sachregister 533 |
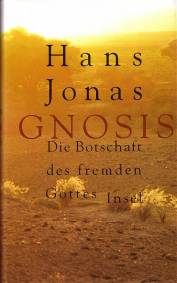
 Bei Amazon kaufen
Bei Amazon kaufen