|
|
|
Umschlagtext
Franz Overbeck (1837-1905) war Professor für Neues Testament und Alte Kirchengeschichte an der Universität Basel. In seinen Studien zur Geschichte und Literatur des frühen Christentums hat er wichtige Einsichten über die Funktion von Kanonisierungsprozessen und Ansätze zu literatursoziologischen Methoden formuliert. Der Historiker Overbeck war ein skeptischer und zugleich sensibler und distanzierter Beobachter der verschiedenen geistigen und politischen Strömungen des 19. Jahrhunderts. Er steht an einer Bruchstelle europäischen Denkens. Mit Nüchternheit und Präzision beschreibt er die Problematik des Christentums in der Moderne. Seine Kritik moderner Theologie und insbesondere aller religiös sich begründenden Selbstlegitimationen des Bismarck-Reiches - hauptsächlich durch problematische Veröffentlichungen aus dem Nachlaß bekanntgemacht - wurden zunächst aus dem Blickwinkel seiner Freundschaft mit Friedrich Nietzsche gesehen. Später hat sich vor allem Karl Barth auf ihn als Wegbereiter der »Dialektischen Theologie« berufen. Auch die Namen von Walter Benjamin, Karl Löwith, Jacob Taubes und anderen weisen auf eine (noch ungeschriebene) Wirkungs- und Rezeptionsgeschichte. Nicht zuletzt für die gegenwärtige Diskussion über Geschichte, Mythos und (Post-)Moderne ist die Beschäftigung mit den Gedanken dieses »antimodernen Modernisten« wichtig. Die Ausgabe macht wichtige Schriften neu zugänglich. Sie erschließt in originalgetreuer Edition ausgewählte Texte des Nachlasses und ermöglicht eine kritisch nachprüfbare Rezeption. Die zunehmende Unvereinbarkeit von öffentlichem Ansehen und persönlicher Überzeugung drängte Overbeck nach der Emeritierung (Frühjahr 1897) zum Versuch, sein Verhältnis zur christlichen Theologie offenzulegen - nicht nur um seine 27jährige Wirksamkeit als Professor der Theologie zu rechtfertigen, sondern auch um den Ertrag lebenslanger Vorarbeiten zu einer umfassenden »profanen Kirchengeschichte« erklärter-massen nicht mehr als Theologe publizieren zu können. Im Dezember 1897 hat er »tagebuchartige« Aufzeichnungen begonnen, die er bis kurz vor seinem Tod fortführte. 1899 suchte er seinen Standpunkt aus einer Selbstbiographie heraus zu erklären, die er allerdings nach der Darstellung seiner ersten Studienjahre nicht weiterführte. Diese schon 1941 von Eberhard Vischer als »Selbstbekenntnisse« veröffentlichten Texte, das bisher unpublizierte »Tagebuchartige« sowie weitere selbstbiographische Aufzeichnungen aus den Jahren 1897-1905 werden hier ediert.
Gliederung von Werke und Nachlaß Band 1: Schriften bis 1873 (erschienen) Band 2: Schriften bis 1880 (erschienen) Band 3: Schriften bis 1898 und Rezensionen Band 4: Kirchenlexicon Texte. Ausgewählte Artikel A-I (erschienen) Band 5: Kirchenlexicon Texte. Ausgewählte Artikel J-Z (erschienen) Band 6/1: Kirchenlexicon Materialien. Christentum und Kultur (erschienen) Band 6/2: Kirchenlexicon Materialien. Gesamtinventar (erschienen) Band 7/1: Autobiographisches. »Mich selbst betreffend« Band 7/2: Autobiographisches. »Meine Freunde Treitschke, Nietzsche und Rohde« (erschienen) Band 8: Briefauswahl Band 9: Vorlesungen (Auswahl) Rezension
Franz Overbeck (*1837 in Sankt Petersburg; † 1905 in Basel) war ein evangelischer Theologe und Kirchenhistoriker, dessen Bedeutung sich auch in seiner Freundschaft mit Nietzsche, Treitschke und Rohde zeigt. Band 7 der Franz Overbeck "Werke und Nachlaß" bietet in zwei Teilbänden eben diese biographischen Aspekte Overbecks, des Radikalkritikers des Christentums und Freunds Nietzsches, in Selbstzeugnissen dar: Band 7/1 ediert wissenschaftlich die Aufzeichnungen "Mich selbst betreffend" sowie das bisher unpublizierte `Tagebuchartige` und weitere selbstbiographische Aufzeichnungen aus den Jahren 1897 bis 1905. Der Historiker Overbeck war ein skeptischer und zugleich sensibler und distanzierter Beobachter der verschiedenen geistigen und politischen Strömungen des 19. Jahrhunderts. Er steht an einer Bruchstelle europäischen Denkens. Mit Nüchternheit und Präzision beschreibt er die Problematik des Christentums in der Moderne ebenso wie seine Kritik moderner Theologie und insbesondere aller religiös sich begründenden Selbstlegitimationen des Bismarck-Reiches. Insofern bietet sich in diesem Band ein interessanter Blick auf das Ende des 19. Jhdts.
Jens Walter, lehrerbibliothek.de Verlagsinfo
Radikalkritiker des Christentums und Freund Nietzsches in Selbstzeugnissen Wegbereiter der Dialektischen Theologie Band 7/1: Die Aufzeichnungen "Mich selbst betreffend" aus den Jahren 1897 bis 1905, thematisch ergänzende Anhänge Franz Overbeck war einer der großen Denker des 19. Jahrhunderts. Sein Einfluss auf Nietzsche, Barth, Löwith, Benjamin, Taubes und viele andere ist unbestritten. `Werke und Nachlaß` erschließt erstmals Overbecks Gesamtwerk und stellt den Theologen und Historiker vor als einen skeptischen und zugleich sensiblen und distanzierten Beobachter der verschiedenen geistigen und politischen Strömungen des 19. Jahrhunderts. Nicht zuletzt für die gegenwärtige Diskussion über Geschichte, Mythos und (Post-) Moderne ist die Beschäftigung mit den Gedanken dieses "antimodernen Modernisten" wichtig. Band 7/1 umfassen die als `Selbstbekenntnisse` veröffentlichten Texte, das bisher unpublizierte `Tagebuchartige` und weitere selbstbiographische Aufzeichnungen aus den Jahren 1897 bis 1905. Die Anhänge umfassen thematisch zugehörige Artikel aus dem Kirchenlexikon, Aufzeichnungen im Zusammenhang mit der Veröffentlichung der "zweiten Christlichkeit", Overbecks Briefwechsel mit James Donaldson und seine briefliche Auseinandersetzung mit Carl Albrecht Bernoulli über die weitere Verwendung seines Nachlasses. Bandherausgeber Barbara von Reibnitz und Marianne Stauffacher-Schaub Marianne Stauffacher-Schaub (Basel), dpl. Naturwissenschaftlerin der ETH Zürich, bis 1996 Redaktionsassistentin der Werke- und Nachlaß-Ausgabe Franz Overbeck, Verlagsmitarbeiterin Mathias Stauffacher (Basel), Dr. phil., Mittelaltergermanist, Generalsekretär der Rektorenkonferenz der Schweizer Universitäten. Pressestimmen "Overbeck wird durch diese Ausgabe von Werken und Nachlaß vom Außenseiter und Geheimtip zum Klassiker und Theologiekritiker." Zeitschrift für Religions- und Geistesgeschichte "...der vorliegende Band ist gewohnt sorgfältig gemacht und wird durch eine Zeittafel, zwei Bibliographien und ein Register leicht erschlossen." Theologische Zeitschrift Inhaltsverzeichnis
Franz Overbeck
Werke und Nachlaß 7/1 Autobiographisches »Mich selbst betreffend« © 2002 Verlag J. B. Metzler (www.metzlerverlag.de) 3-476-00969-6 Franz Overbeck, Werke und Nachlaß Franz Overbeck Werke und Nachlaß Editionskommission Prof. Dr. theol. Ekkehard W. Stegemann (Basel), Präsident Prof. Dr. theol. Rudolf Brändle (Basel) Prof. Dr. phil. Hubert Cancik (Tübingen) Dr. Hildegard Cancik-Lindemaier (Tübingen) Dr. phil. Bernd Lutz (Stuttgart) Prof. Dr. phil. Karl Pestalozzi (Basel) Dr. theol. Niklaus Peter (Basel) Dr. phil. Barbara von Reibnitz (Basel/Berlin) Prof. Dr. theol. Martin Anton Schmidt (Basel) Dr. phil. Mathias Stauffacher (Basel) Marianne Stauffacher-Schaub (Basel) Inhaltsübersicht Einleitung VII Arbeitsplan 1 Zu meiner Basler Professur 1870–97 9 Zur Selbstbiographie 37 Tagebuchartiges 51 Selbstbiographische Aufzeichnungen 159 Weitere Aufzeichnungen Franz Overbeck selbst betreffend 231 Anhang: Ergänzende Texte zu den Aufzeichnungen »Mich selbst betreffend« 253 I. Aus dem Kirchenlexicon 255 II. Zur 2. Auflage der »Christlichkeit unserer heutigen Theologie« 280 III. Briefwechsel mit James Donaldson 1899 und 1903–1905 286 IV. »Privatim uns beide betreffend«– Bernoulli und Overbeck März/April 1902 311 Zeittafel 343 Abkürzungen 356 Verzeichnis der von Franz Overbeck selbst publizierten Schriften 358 Verzeichnis der Publikationen aus Franz Overbecks Nachlass 360 Bibliographie der von Franz Overbeck zitierten Literatur 361 Bibliographie der im Kommentar verwendeten Literatur 369 Zu den Abbildungen 371 Register 373 Leseprobe: Einleitung Mit einer ausführlichen Einleitung soll nicht nur der Zugang zu einem komplexen Bestand von Aufzeichnungen aus dem Overbeck-Nachlass erschlossen, sondern auch an vier chronologisch und thematisch abgegrenzten Textgruppen gezeigt werden, wie sehr es bei der Arbeit mit nachgelassenen Aufzeichnungen von Franz Overbeck darauf ankommt, den gesamten Kontext und vielfältige Querverbindungen zu berücksichtigen. Das 1. Kapitel zur »Auseinandersetzung mit mir selbst« sowie »über meine Basler Professur und die Art, wie ich sie geführt« zeigt die Entwicklung und Interdependenz differenzierter Formen der Selbstreflexion – von Overbecks ersten Betrachtungen zu seinem Wirken als Theologe über die Aufzeichnungen um die Jahreswende 1897/98 bis zu seiner Rückkehr zur »regelmässigen Arbeit« Mitte Januar 1898. Im 2. Kapitel über Overbecks Erfahrungen mit »persönlicheren Confessionen « bei der Arbeit an einer »Selbstbiographie als Theologe« (1899) werden Vorüberlegungen und Kommentare zu den »Selbstbiographischen Aufzeichnungen« im Kontext gleichzeitig entstandener Notizen, besonders aber die verstreut eingeschobenen tagebuchartigen Bemerkungen in ihrem Verhältnis zu Eintragungen im Heft »Tagebuchartiges « betrachtet. Ein kleiner Exkurs gilt erst seit kurzer Zeit bekannten Dokumenten aus Overbecks Göttinger Studienjahren. Zu zwei entscheidenden, aus den edierten Texten nicht nachvollziehbaren Phasen der Verständigung mit Bernoulli »über die ihm mit meinen Papieren anzuvertrauenden Aufgaben« (1902) und »über die Zukunft meiner Nietzschebriefe« (1904) ergänzen das 3. Kapitel und der Anhang IV die wesentlichen Partien aus dem Briefwechsel. Die umfangreichen Zitate könne auch veranschaulichen, dass komplementär zu den bereits ediert vorliegenden Briefwechseln mit Nietzsche, Rohde und Köselitz derjenige mit Carl Albrecht Bernoulli, der Overbecks letzte Jahre wohl am vollständigsten dokumentiert, ebenfalls integral veröffentlicht werden sollte. Das eher biographisch ausgerichtete 4. Kapitel setzt dort ein, wo Ende Januar 1905 die Aufzeichnungen im Heft »Tagebuchartiges« endeten, und versucht, Overbecks letzte Arbeiten am »Kirchenlexicon«, VIII Einleitung Selbstreflexionen, Briefe und Gespräche »mit befreundeter Seele« anhand der im gesamten Nachlass auffindbaren Zeugnisse darzustellen. Im Mittelpunkt stehen die Arbeitsbesprechungen mit Bernoulli im März und April 1905, auf die Overbeck lange hingearbeitet hat und die im Briefwechsel wie in seinen letzten Zusätzen zu diversen Aufzeichnungen immer wieder erwähnt sind. Schliesslich kommentiert ein eigenes Kapitel zusammenfassend Anlage und Textauswahl dieses Bandes. 1. »Auseinandersetzung mit mir selbst« sowie »über meine Basler Professur und die Art, wie ich sie geführt« (1897 bis 1898) Ende März 1897, in den letzten Tagen vor dem offiziellen Zeitpunkt seiner Emeritierung, hat Overbeck im »Arbeitsplan« unter dem Stichwort »Persönliches« sehr präzise eine Fragestellung umrissen, die ihn vom folgenden Winter an intensiv beschäftigte und bis zu seinem Tode nie mehr ganz losliess: »Meine gelehrte Laufbahn. Wie ich zur Religion gestanden, wie zur Theologie gekommen. Wie ich mein Amt in Basel aufgefasst und verwaltet und damit zu einem Ende kommen musste. Meine Freunde Treitschke, Nietzsche u. Rohde.«1 Vom Übergang in die neue Lebensphase schrieb er sechs Wochen später an Köselitz: »Ich bin also am 1. Apr. in den ersehnten ›Ruhestand‹ getreten, und dass ich über die Wünschbarkeit dieser Veränderung anderen Sinnes geworden wäre werden Sie nicht annehmen. Nur dass ich am Schluss des Wintersemesters, das ich bis dahin in recht erfreulichem Wohlsein zugebracht, also im Augenblick des Uebergangs in mein ›neues‹ Leben – das nur leider in Wahrheit der Rest eines alten ist – wieder einen rechten Stoss erlitt, der mich ein paar Wochen tief herabstimmte und zu Gedanken darüber veranlasste in wiefern sich überhaupt noch eine Veränderung mit mir verlohne . . .«. Inzwischen habe er »diese gedrückten Tage leidlich überwunden«, so dass er »auch schon mitten in den Arbeiten stecke, die ich mir zur Ausfüllung der selbstgeschaffenen Musse fürs Nächste aus dem aufgelaufenen Vorrath hervorgeholt habe. Es ist vor Allem eine Umarbeitung und Ausführung meines Programms über die Anfänge der Kirchengeschichtsschreibung. «2 1 A 268d, p. 1 (unten S. 3). 2 O. an H. K., 10. Mai 1897 (OKB, S. 433f.). Einleitung IX Kaum zufällig hat sich Overbeck in den ersten Wochen seines Ruhestandes neben der Facharbeit mit biographischen Darstellungen beschäftigt: Zusammen mit Ida las er den zweiten Band der Lebensgeschichte von Albrecht Ritschl3, und als sie im Mai 1897 am dritten Band von Baechtolds Keller-Biographie waren, berichtete er Köselitz, »wie entzückt ich davon bin. Es kommt mir in meiner zeitigen Stimmung vor, als sei ich auf das Ideal einer erholenden Abendlectüre damit gerathen . . .«4. 1.1. Erste Betrachtungen zu Overbecks Selbstverständnis als Theologe – noch im »Kirchenlexicon« und in Notizen »Zur Vorrede« (März bis Herbst 1897) Während er in den letzten Jahren auch im »Kirchenlexicon« oft festhielt, an welchem Tag der betreffende Artikel oder Nachtrag geschrieben wurde, scheint Overbeck bis zum Dezember 1898 nur drei KL-Eintragungen explizit als solche datiert zu haben5: Im Juni 1897 bezog er sich auf die bereits erwähnte Ritschl-Lektüre6, und die beiden anderen Texte gelten seinem Selbstverständnis als Theologe, als Lehrer der Theologie und als Schriftsteller. Obwohl diese bereits in OWN 5 ediert sind, sollen sie hier neben einer bisher nicht veröffentlichten Notiz als früheste Ansätze Overbecks zur Selbstreflexion ausführlich zitiert werden. 3 OKB, S. 435f.; Albrecht Ritschls Leben dargestellt von O. R., 2 Bde., Freiburg und Leipzig, 1892 und 1896; vgl. die KL-Notate zu dieser Lektüre OWN 5,353–359. 4 OKB, S. 435; J. B.: Gottfried Kellers Leben. Seine Briefe und Tagebücher, Bd. 3, Berlin 1897 (Ida O. hatte den Band zu Weihnachten 1896 erhalten, vgl. OKB, S. 432). Zu O.s früherer Keller-Lektüre vgl. K. P.: »Stille Grundtrauer«. Franz Overbecks Lektüre des »Grünen Heinrich «, in: Religion in Basel (FS Ulrich Gäbler), hg. von Th. Kuhn und M. Sallmann, Basel 2001, S. 69–72. 5 Weitere fünf Datierungen – vgl. OWN 4,469.560; OWN 5,24.405; ausserdem »Benedictiner (Regel) Vermischtes« in A 218 – beziehen sich nicht auf den Zeitpunkt der Eintragung, sondern jeweils auf eine zurückliegende Lektüre oder Begegnung. Ab Dezember 1898 (vgl. OWN 4,447.574) sind die KLArtikel häufiger datiert. 6 Vgl. OWN 5,405 X Einleitung Nr. 5 im Artikel »Theologie (Allgemeines)« beginnt mit der Aussage: »Es liegt mir nicht im Geringsten daran mit irgend Jemand über Gott und göttliche Dinge in Streit zu gerathen. Ich gebe denn auch gern zu, dass ich eben darum zum Theologen nicht brauchbar bin und nehme dageg. in Anspruch nur das Zugeständniss des Rechts meinerseits die Theologie nicht zu mögen«. Gegenüber seinem Basler Kollegen Mezger7 habe er zu behaupten, »dass eine Theologie, die keinen Anspruch darauf erhebt, die christl. Religion theoret. vertheidigen zu können gar keine ist«. Die Eigenart seines Interesses an der Theologie – vor allem daran, »zu erkennen, wie sie überh. aufkommen konnte« – führt Overbeck zur Frage: »Wie konnte ich aber dabei je Theologe werden? Ich bin es thatsächl. geworden, nur unter dem Einfluss eines Ideals, von dessen Unhaltbarkeit mich Leben und Lernen überzeugten – des rationalist. Ideals des aufgeklärten Menschenwohlthäters«. Anders als »bei den Genien der Menschht« gelte für ihn »der Maasstab gewöhnlicher Menschen, bei dem man mindestens ebenso sehr ist was man geworden als was man gewesen ist. So schreibe ich am 1. Mai 1897. unter den mancherlei Gedanken, die mich zu überlegen bewegen, warum ich vor einem Monat aufgehört habe Lehrer der Theologie zu sein und mich vollständig auf das Eigenthum meiner Privattheologie zurückgezogen habe. Unläugbar bin ich so unter meinen Schülern derjenige, der am meisten bei mir gelernt hat«, und die »immer mehr drückende Einsicht der Geringfügigkeit dessen, was ich meinen theolog. Schülern sein konnte, hat mich nicht aus meinem subject. Interesse an der Theologie, der KG. vor Allem, hinausgedrängt, aber aus jedem öffentlichen, meine Schüler bindenden Betrieb derselben. Ich bleibe theologischer Schriftsteller soweit meine Kräfte noch zureichen und mich jemand lesen will, vom Katheder braucht mich Niemand mehr zu hören. Gemeinhin gilt ›Wem Gott ein Amt giebt, giebt er auch Verstand‹. Als Lehrer der Theologie habe ich wenigstens in eigenthümlicher Buchstäblichkeit erfahren, dass Gott es auch anders macht. Ich bin darüber für mich selbst in Zweifel darüber gerathen, dass ich überh. einen Amtsverstand habe. «8 Auf diesen fünfeinhalb KL-Seiten finden wir, noch in Overbecks eigener Form, Anregungen aus seiner Lektüre lexikalisch zu verarbeiten, in nuce bereits ausgeführt, was er dann vom Winter 1897/98 an immer und immer wieder neu hinterfragt hat. 7 P. M.: Christlicher Gottesglaube und Offenbarungsglaube. Antrittsvorlesung. Basel 1896. 8 OWN 5,472–474; die letzten Sätze variiert O.s undatierte Notiz A 268a,14 (unten S. 237). Einleitung XI Nicht im »Kirchenlexicon«, sondern auf Makulaturblättern, wie er sie jeweils für Entwürfe zu wissenschaftlichen Manuskripten verwendete, ist Overbeck im Oktober 1897 auf das Stichwort »theologischer Schriftsteller« zurückgekommen. In der letzten von drei Notizen »Zur Vorrede« für die Neubearbeitung seines Universitätsprogramms von 18929 rückt anstelle von Eusebius oder Harnack unvermittelt der Verfasser selbst ins Zentrum: »Ich muss in der Vorrede um allen unliebsamen Erfahrgen, die ich mit meiner scheinbar theolog. Schriftstellerei gemacht zuvorzukommen feststellen: Ich bin nie Theologe gewesen, jedenfalls ist in meinen Schriften nichts für Theologen bestimmt. Sie haben mich denn auch nie verstanden und das habe ich ihnen nicht einmal übel zu nehmen. Ich bitte sie vielmehr um Entschuldigung, wenn sie bei mir zu wenig finden für ihre Zwecke und sie interessirendes, was sie interessirt, interessirt mich eben gar nicht. Haben sie sich in rechter Weise damit abgefunden, so wird sich wohl auch von selbst die rechte Vorsicht in der Beurtheilung meiner Arbeiten einstellen. Meine Person mögen sie nur aus dem Spiele lassen, sie gehen dabei unvermeidlicher Weise von ganz verkehrten Ansprüchen an mich aus und können sich nur blamiren. Sachlich natürlich denke ich nicht daran mich ihrer Strenge zu entziehen. Aber bei ihrem Urtheil sachli. zu bleiben haben sie in meinem Falle besondere Ursache.« Erst am Schluss dieses Abschnitts, wo Overbeck als Gegenbeispiel zur »möglichst object. Beobachtg« anführte, wie von Schubert ihm »Durchdrückg liebgewordener Theorien« vorgeworfen habe10, erweist sich auch dieser unerwartete Exkurs als zumindest indirekte Reaktion auf einen Anstoss aus der Lektüre. Am 9. oder 10. November 1897 schrieb Overbeck zwar nochmals im »Kirchenlexicon«, aber nur noch formal als Artikel zum Lemma »Unsterblichkeit (Individuelle) Begründung« und ganz ohne Bezug auf Gehörtes oder Gelesenes: »1. Ich werde auf dieser Erde nicht fertig, nicht in mir selbst, noch mit dem was ich aus mir heraussetzen kann – das ist gewiss und ist auch das beweglichste Argument, das es für jeden Menschen zum Glauben an seine individuelle Fortdauer giebt. Aber wie weit soll er darauf bauen? Soll ich meinen, dass ich zu allen kleinen und 9 »Zur Vorrede (Oct. 1897)«, 2 Bl. in A 202, bisher nicht veröffentlicht. – Zum zweiten der in Ov II, S. 96 aufgeführten Entwürfe vgl. unten S. XVII und OWN 3. 10 H.S.: Rez. F. Overbeck: AKg. In: Theol. Litteraturzeitung Jg. 19, Nr. 3, 3. Feb. 1894, Sp. 76–79. XII Einleitung grossen Aufgaben, die ich in meinem Beruf noch gern erfüllte und erfüllen zu können mit geringerer oder grösserer Deutlichkeit und Zuversicht absehe, noch auf unabsehbare Zeit zu rechnen habe?« Was er z. B. gegen Harnack noch zu beweisen gedenke, »das werden doch auch andere für mich thun können, ja die stärkste Zuversicht, die ich dabei zu mir habe, ruht auf der intimen Ueberzeugung, dass die Sache bald einmal auch ohne mich besorgt werden wird. Ich weiss aber unzählige ganz unverhältnissmässig interessantere und wichtigere Probleme der KG., die ich mit Nutzen anfassen könnte.« Bevor er sich dann Konsequenzen aus der Einsicht überlegte, »dass ich zur Zeit – in meinem in 8 Tagen vollendeten 60. Jahre – nur noch verschwindend weniges von dem, was ich im Sinne habe oder nur haben könnte, fertig bringe, wenn überh. etwas . . .«, notierte Overbeck in einer Anmerkung zu den denkbaren wissenschaftlichen Arbeiten: »Auch noch ganz Anderes: Wie viel hätte ich noch über meine Freunde Treitschke und zumal Nietzsche zu sagen und sagte es gerne, und hier sehe ich keinen Stellvertreter ab. Von mir selbst bleibt vollends Ungesagtes nach mir zurück . . .«11 Dass Overbeck dann in der kurzen Nr. 2 vom Charakter »vorstehender Betrachtg « aus zum Schlussgedanken kam, er wolle »doch jetzt im Alter nicht mehr wissen, als mir und Anderen gut ist«12, bestätigt nur, dass dieser ganze KL-Artikel sowohl inhaltlich wie nach seiner Gedankenführung bereits zum Typus der Aufzeichnungen »Mich selbst betreffend « gehört. Noch im Kontext und auch formal in der Art seiner wissenschaftlichen Notizen exponierte Overbeck mit den hier zitierten Texten bereits wesentliche Themen seiner kommenden Versuche, über sich selbst, seine Beziehung zu den Freunden und sein theologisches Amt Rechenschaft abzulegen. Darauf bezieht sich wohl auch seine Bemerkung vom 25. Februar 1899, mit dem Gedanken an selbstbiographische Aufzeichnungen habe er »einmal schon vom Tage an, da ich mein hiesiges theologisches Lehramt niederlegte (Frühj. 1897), nur zu spielen, und zwar selten und nur sehr zerstreut zu spielen, kaum aufgehört«13. 11 OWN 5,608–609. 12 OWN 5,610. 13 SbA p. 2, unten S. 162. Einleitung XIII 1.2. Selbstverteidigung auf einem »stillen Blatte« – der Übergang zu einer neuen Form persönlicher Aufzeichnungen (Mitte Dezember 1897) In der Sonntagsbeilage der Allgemeinen Schweizer Zeitung vom 5. Dezember 1897 fand Overbeck in einer kurzen Rezension Albert Bruckners zur neuen Publikation von Carl Albrecht Bernoulli14 seine »Christlichkeit « von 1873 auf die Behauptung reduziert, »der Geistliche brauche sich in seiner Amtswirksamkeit in keiner Weise durch seine wissenschaftliche Ueberzeugung beeinflussen zu lassen; er habe einfach das zu lehren, von dem er wisse, daß es dem Glauben seiner Kirche entspreche «. Zwar dachte er sofort daran, dies in einer Replik richtigzustellen, liess es dann jedoch bleiben, weil er von der »ziemlich vollkommenen Arglosigkeit« des Verfassers überzeugt war, dessen Lizentiatsarbeit und Dissertation er mit betreut hatte.15 Aber im Kontext dieser Aussage von Bruckner empfand es Overbeck umso mehr als indirekten Angriff auf seine eigene Lehrtätigkeit, dass in derselben Sonntagsbeilage ein anderer ehemaliger Hörer, Albert Barth, von Treitschke rühmend hervorhob, er habe den Studenten nie »seine Hauptweisheit für noch zu publizierende Bücher« vorenthalten und in seinem Kolleg immer alles gesagt, »was ihm als Wahrheit erschien«16. Nur in der zufälligen Koinzidenz konnte diese Aussage eine tiefe persönliche Erschütterung und letztlich Overbecks intensive Auseinandersetzung mit seinem Wirken als Lehrer der Theologie auslösen. 14 A. B.: Rez. C. A. B.: Die wissenschaftliche und die kirchliche Methode in der Theologie. Ein encyclopädischer Versuch. Freiburg i. B. 1897. In: Allgemeine Schweizer Zeitung, Sonntags-Beilage Nr. 50 vom 5. Dez. 1897, S. 200. 15 Vgl. KL »Bruckner (A.)«, unten S. 262. 16 A. B.: Rez. T. S.: Heinrich von Treitschkes Lehr- und Wanderjahre 1834–1866, München und Leipzig 1896. 2. Teil. In: Allgemeine Schweizer Zeitung, Sonntags-Beilage Nr. 50 vom 5. Dez. 1897, S. 198–199. Der volle Wortlaut macht noch deutlicher, weshalb O. von der zitierten Stelle so betroffen war: »So wurde er mit ganzer Seele der Lehrer seiner Schüler und hat darum von den ersten Tagen seiner Docentenlaufbahn bis in sein letztes Semester hinein nie leeren Bänken predigen müssen, sondern hat stets eine große Zahl aufrichtig begeisterter Zuhörerschaft vor sich gehabt, denn man hatte stets das unbedingte Vertrauen zu ihm, daß er nicht seine Hauptweisheit für noch zu publizierende Bücher hinter dem Berge halte und den Studenten nur die Abfälle zukommen lasse. In jedem Kolleg hatte man den ganzen Menschen und bekam ohne Umschweife und weise Zurückhaltung das, was ihm als Wahrheit erschien. . . .« (a.a.O. S. 198). XIV Einleitung Nicht in seiner gewohnten Art – weder mit einer Replik noch im »Kirchenlexicon« wie bei Bruckner – hat sich Overbeck gegen Barths implizite »Verdächtigung meiner Aufrichtigkeit« verwahrt, »die Möglichkeit vollkommen und ohne Groll gegen den Missverstehenden anerkennend, dass ich so gröblich missverstanden sein könnte«: Seine Rechtfertigung formulierte er zunächst auf einem »stillen Blatte« im grösseren Format, dessen Titel »Zu meiner Wirksamkeit als Lehrer der Theologie in Basel 1870–1897« verrät, dass er sich nun grundsätzlich mit der schon mehrmals angesprochenen Problematik befassen wollte17. Schon auf der dritten Seite hat Overbeck aber diesen ersten Versuch abgebrochen und auf p. 4 mit Datum vom 15. Dezember, aber ohne neue Überschrift, nochmals anders eingesetzt, diesmal direkt bei seinem »Schriftchen« von 1873 (ChT2). Ohne den Zeitungsartikel von Barth überhaupt noch zu erwähnen, kommt diese zweite Fassung unverzüglich zu jenem Dilemma, das Overbeck zunächst bis Mitte Januar 1898 fast ausschliesslich beschäftigt und später immer wieder umgetrieben hat: »Ich habe nicht gelehrt, was ich glaubte, d.h. was ich wollte, sondern was ich für zweckmässig, d.h. für meine sogen. Pflicht hielt.« Mit seiner »Christlichkeit« habe er »vor nunmehr bald 25 Jahren zunächst nur mir selber zu helfen gedacht. . . . Niemand sollte mich noch für das ansehen, wofür ich jedenfalls nicht angesehen sein wollte, nämlich für einen Vertheidiger des Christenthums.«18 Mit diesem neuen Ansatz hatte Overbeck offenbar den richtigen Einstieg gefunden, denn er kopierte zumindest das, was auf der durchgestrichenen vierten Seite noch erhalten ist, praktisch wörtlich als Anfang einer neuen Aufzeichnung »Basler Professur 1870 – 97«19, der ersten umfassenden Analyse von Absicht und Wirkung seiner »Christlichkeit« von 1873 und seiner Lehrtätigkeit in Basel. Vermutlich noch am gleichen 15. Dezember 1897 unterbrach Overbeck diese rückblickenden Reflexionen, die ähnlich auch in weiteren Texten bis zu ChT2 immer wieder auftauchen, um in einem Einschub zu definieren, was er »möglichst treu und ausschliesslich beschreiben« wolle: Er lasse z. B. »die Frage ganz ausser Betracht: wie war ich überhaupt dazu gekommen Theolog zu werden, wie mit der Theologie auch wieder so auseinandergekommen? «. Ebensowenig könne er auf die Hintergründe seiner 17 In A 267b, unten S. 11–13. 18 Zitiert nach p. 4 des Ms. in A 268b (vgl. unten die textkrit. Anm. S. 11 zu Z. 7 und S. 14 zu Z. 13). 19 In A 267a, unten S. 13–20. Einleitung XV Berufung nach Basel oder auf die persönlichen Einflüsse eingehen, die seine Gedanken und Entschlüsse in der Periode um 1873 bestimmt hätten, insbesondere seine »continuirlichsten, nämlich täglichen Beziehungen zu Nietzsche, der in allem was mich anging, seit ich ihm wirklich näher gekommen war, überhaupt magna um nicht zu sagen maxima pars fuit«. Zu all diesen Fragen, »über die, da ich allein über sie etwas weiss, ich auch insbesondere etwas zu sagen hätte«, schweige er, um »so zu sagen nur eine einzelne Ecke der Landschaft meiner Gedanken zu beschreiben – es muss mir hier, wo ich zu mir selbst rede, gestattet sein, mich so preciös auszudrücken, überhaupt mir alle nur wünschenswerthe Freiheit zu nehmen, deren ich zur Deutlichkeit bedarf «. Dann setzte er seine Analyse der mit ChT2 verfolgten Absichten sowie (am 18. und 20. Dezember) seines Verhaltens gegenüber den Studierenden fort20. Diese beiden Manuskripte sind nicht nur die frühesten Aufzeichnungen in einer neuen Form, die Overbeck von da an sehr häufig verwendet hat, sondern zeigen auch exemplarisch, wie er allgemeiner angelegte und weiterführende Erörterungen von seiner unmittelbaren und expliziten Reaktion auf Gelesenes abgrenzte. Den zweiten, am 15. Dezember begonnenen Text hat er selber stets als Ausgangspunkt der schriftlichen Auseinandersetzung mit sich selbst und seiner Lehrtätigkeit bezeichnet. Was ihn im Dezember 1897 so sehr erschüttert und diese Selbstreflexionen ausgelöst hat, erwähnte Overbeck zwar nie mehr, doch hat er jene auf Barth’s Artikel bezogene Vorstufe auch bei späterer Durchsicht seiner Papiere nicht vernichtet, sondern weiter aufbewahrt. 1.3. »Tagebuchartiges« und thematisch verwandte Aufzeichnungen bis Ende Dezember 1897 Über ein neues Manuskript hat Overbeck am 24. Dezember 1897 den zunächst überraschenden Titel »Tagebuchartiges« gesetzt, diesen aber mit »(denn ein eigentl. Tagebuch soll hier nicht geführt werden)« sofort wieder relativiert. Tatsächlich beginnt diese Aufzeichnung wie ein 20 Unten S. 17–20. – Wie viel vom ursprünglichen Text die am 20. Dez. auf einem separaten Blatt (p. 9b) notierte Variante zu p. 8–9 (vgl. S. 18, Anm. zu Z. 25) ersetzen oder ob allenfalls der ganze Rest der ersten Fassung wegfallen sollte, bleibt unklar, weil p. 9〈a〉 oben nichts mehr durchgestrichen ist. XVI Einleitung Tagebuch: »Nach einer sehr guten Nacht – dgl. ich einige Wochen nicht gehabt und die mich in Hinsicht auf neuerdings quälend dringlich gewordene Besorgnisse über meine Gesundheit u. ihren Bestand beunruhigen, beschliesse ich, die seit dem 15ten an die Hand genommene Auseinandersetzung über meine Basler Professur und die Art, wie ich sie geführt, bei Seite zu legen und die Arbeit an meinem Eusebius wieder aufzunehmen.« Doch sogleich erweist sich das in doppelter Weise als Trugschluss, weil Overbeck nun nicht etwa mit weiteren Tagebuchnotizen weiterfuhr, sondern daran ging, in einer neuen Erörterung über mehrere Heftseiten hinweg seine »Facharbeit« und die »Auseinandersetzung mit mir selbst« gegeneinander abzuwägen, und erst auf der vierten Seite auf seinen Entschluss zurückkam: »Ich gebe also den ganzen Gedanken auf und damit was ich etwa über meine immerhin 27 Jahre meines Lebens ausfüllende Laufbahn als Professor der Theologie zu sagen habe, dem natürlichen Zusammenhg, den die Sache in einer Darstellung meines Lebens überhaupt findet, zurück.«21 Zwei Tage darauf hat Overbeck ein weiteres Mal neu eingesetzt und in einer separaten Betrachtung »Zu meiner Lebensbeschreibung« seine einleitende Aussage, er »gehe an selbstbiographische Aufzeichnungen nicht ohne jede Selbstüberwindung«, ausführlich und oft repetitiv mit der Geringfügigkeit seiner Talente und Leistungen, aber auch mit seiner »Gleichgültigkeit gegen die Meinung Anderer« begründet22. Dann liess er auch diesen ersten Text im Umschlag »Zur Selbstbiographie« vorerst liegen, befasste sich am 30. Dezember auf drei Blättern im KLFormat, aber ohne Stichwort oder Überschrift23, erneut eingehend mit seiner Talentlosigkeit und seinen geringen wissenschaftlichen Erfolgen, und bedachte dann, wie aussichtslos es ohnedies sei, »dem Traum, in den ich im Frühjahr in der ersten Freude über die erlangte Freiheit verfiel, nachzuleben. Wie ich zu spät zur freien Arbeit komme so auch zu spät zur Beschäftigung mit mir selbst. Obwohl ich in ausserordentl. Maasse bei meinen Arbeiten darauf aus war, sie als mein persönlichstes Eigenthum zu beherrschen und eine andere Sorge im Grunde dabei nicht gehabt habe, ist diess auffallender Weise in mir stets von äusserst geringer Neigung begleitet gewesen in mich selbst Einkehr zu halten. Das hat nun zur Folge gehabt, dass ich zur Zeit solchen Stössen ausgesetzt bin, wie dem am 15. d. M. erlittenen, bei welchem ich die Feder 21 TbA, p. 1–4 (unten S. 53–55). 22 In A 267d (unten S. 39–42). 23 268a,1a-c (unten S. 42–44). Einleitung XVII zu meinem Eusebiusaufsatz . . . niederlegte, um an selbstbiographische Aufzeichnungen zu denken. Ich machte schon in wenigen Tagen die Erfahrung, dass ich damit nur in kürzester Zeit den kleinen Rest von Kräften aufreibe, der mir noch überh. bleibt, mit fast sicherer Aussicht auf einen für mich unannehmbaren, jedenf auf einen ganz problemat. Erfolg.« Nach einem Exkurs über die Gefahren der Selbstbetrachtung in der Jugend und im Alter erschien ihm der Vorteil einer »zweckmässigen Reduction des Stoffes . . . mehr als aufgewogen durch das Bedenken der durch sie erhöhten Willkür und Freiht des Betrachtens. So halte ich denn schon jetzt den ganzen Gedanken nur in sehr stark reducirter Form fest, und denke an eine Ausführung nur noch in einer durch die stärksten Cautelen gegen Verirrg geschützten Form.« Ebenfalls in den letzten Dezembertagen dürften drei undatierte Aufzeichnungen zur Thematik »Basler Professur« entstanden sein, die ebenfalls ohne Überschrift auf Zettel im KL-Format notiert sind: Ein längerer Text gilt Overbecks Verhältnis zur Theologie24, die zweite Notiz variiert die stereotype Einschätzung, was für seine Mitwelt »bei meiner Wirksamkeit herausgekommen ist«, sei »hervorragend nur durch seine Dürftigkeit«25, und auf einem weiteren Zettel begründete Overbeck, diesmal aus seiner Kindheit heraus, dass seine Laufbahn als Theologe »zuletzt auf einem jugendlichen Missverständnis« und »dem flachsten philanthropischen Pfarrerideal« beruhe26. Mit allen diesen Aufzeichnungen entsprach Overbeck keineswegs dem am 24. Dezember im Heft »Tagebuchartiges« gleich im ersten Satz festgehaltenen Entschluss, die Auseinandersetzung über seine Basler Professur »bei Seite zu legen und die Arbeit an meinem Eusebius wieder aufzunehmen.« Am 31. Dezember vergegenwärtigte er sich unter dem Titel »Zur Arbeit über Anfänge der KGeschichtsschreibung«27, was er seit seiner Emeritierung in der Auseinandersetzung mit der neueren Fachliteratur erreicht habe. Auch hier ging er von soeben Gelesenem aus, diesmal einer Stelle in Mongre´s »Sant’ Ilario«, den er gerade Bernoulli zur Lektüre empfohlen hatte28. In diesem zweiten Entwurf zur 24 In A 267b (unten S. 20–22). 25 A 268a,25 (unten S. 23). 26 A 268a,23 (unten S. 22–23); vgl. dazu die oben S. X zitierte KL-Stelle vom 1. Mai 1897 (OWN 5,474). 27 In A 202, in einem von O. mit der Aufschrift »Zur Vorrede der Umarbeitung meines Programms von 1892« versehenen Umschlag; 4 Bl./8 S., datiert »31. Dec. 97« (p. 1) und »3. Jan. 98.« (p. 5); Ov II, S. 96–100 und OWN 3. 28 Vgl. TbA, p. 9 (unten S. 61). Weitere Titel aus der Reihe Franz Overbeck - Werke und Nachlaß |
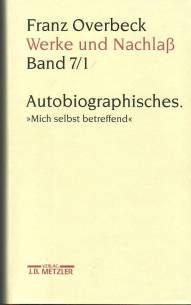
 Bei Amazon kaufen
Bei Amazon kaufen