|
|
|
Umschlagtext
Umfassende Einführung in die Filmanalyse unter zeichentheoretischer Perspektive.
Filmsemiotik – Eine Einführung in die Analyse audiovisueller Formate Dieser Band führt in die Grundlagen semiotischer Filmanalyse ein, indem er sowohl ein breites Begriffssinventar zur theoretischen Untermauerung als auch die praktische Anwendbarkeit und den Nutzen eines filmsemiotischen Handwerkszeugs vorführt. Filme werden als Produkte ästhetischer Kommunikation verstanden, die Bedeutung transportieren. Das Buch geht der Frage nach, wie es ein Film macht, eine bestimmte Bedeutung zu konstruieren und wie diese Bedeutung decodiert werden kann. Dabei geht die Einführung auf Grundlagen der Bedeutungskonstituierung, Parameter der Darstellungsweise, die Konstruktion filmischer Wirklichkeiten (dabei auch auf die Relevanz von Film und Musik) und das filmische Erzählen ein. Rezension
Die Arbeit mit Filmen wird auch in der Schule immer bedeutsamer. Dieser informative Band führt in die Filmanalyse aus spezifischer Sicht der Semiotik ein, bietet eine umfassende Einführung zum Filmverstehen und ist damit Teil der Mediensemiotik, die sich zwischen Literatur-, Bild-, Medien- und Musikwissenschaft, Buchwissenschaft, Ethnologie, Kommunikationswissenschaft und Soziologie, den Philologien und Kulturwissenschaften sowie den Geschichtswissenschaften verortet. Medien sind nach zeichentheoretischer Auffassung Kommunikationsmittel zur Herstellung, Verbreitung und Verarbeitung von Zeichen. Mediale Zeichen ermöglichen demnach die Verständigung über kulturelle Werte und Normen, z.B. transportieren Bedeutungen, - wie? Das zeigt dieser Band auf! Medien beeinflussen somit massiv die Einstellungen und Mentalitäten von Gesellschaften.
Dieter Bach, lehrerbibliothek.de Verlagsinfo
Band 3 der Schriften zur Kultur- und Mediensemiotik, herausgegeben von Martin Nies Aus dem Inhalt: Filmsemiotische Grundlagen | Parameter der Darstellungsweise (Bild, Schnitt Montage) | Filmische Wirklichkeit (Raum, Körper, Musik) | Filmisches Erzählen (Narration und Dramaturgie) | Anwendungsbereiche der Filmanalyse Inhaltsverzeichnis
1. Filmsemiotische Grundlagen
1.1 Filmsemiotik und Medienkontext 14 1.1.1 Drei Dimensionen von Medien 14 Technische Dimension 14 Institutionelle Dimension 14 Semiotische Dimension 17 Wechselwirkungen 17 1.1.2 Mediengeschichte und Medientheorie 19 Skizze der technischen Entwicklung 19 Die institutioneile Dimension des Films in seinen Anfängen 20 Theorien und Reflexionen über Film 22 1.2 Filmanalyse/Analyse audiovisueller Formate 24 Zum Zeichenbegriff 25 Film als sekundäres, modellbildendes System 26 Film als Text und Textgrenze 27 Bedeutung vs. Rezeption 29 Medienkompetenz 31 1.3 Filmische Bedeutung 32 1.3.1 Grundlagen und Grundbegriffe 33 Dargestelltes, Darstellungsweise, Interaktion und Nacheinander 33 Kohärenzannahme 34 Discours/Histoire 35 Die Einstellung 35 Diegese 35 Filmische Semantik 36 1.3.2 Denotation und Erkennen 36 Denotative Bedeutungskomponente 36 Interpretation und Kohärenz 38 1.3.3 Interaktion der Informationskanäle 40 1.4 Allgemeine Prinzipien der Bedeutungskonstituierung 43 1.4.1 Paradigmatische Bedeutungskomponente 43 1.4.2 Sekundär semantische Verfahren 45 1. Semantische Relationen 45 2. Paradigmenbildung 49 3. Tropen/Uneigentlichkeit 52 1.4.3 Kulturelles Wissen 61 Historizität und Kulturalität 62 Kulturelle Bedeutungskomponente 62 Kulturelles Wissen 63 Denksystem 65 Prämissen der Einbeziehung 65 Nullpositionen 66 2. Parameter der Darstellungsweise 2.1 Darstellungsmittel als Zeichensysteme 72 Wahl als grundlegendes Prinzip der Bedeutungsgenerierung 73 Kinematographische Bedeutungskomponente 74 Kontextualität 76 Potenzialität 77 2.2 Bildstrukturen 77 2.2.1 Farbton, Helligkeit, Sättigung 78 Bedeutungsprädispositionen 79 Kontraste und Äquivalenzen 81 Abweichung 82 Beispiele 83 2.2.2 Räumliche Relationen 88 Distanz/Entfernung 88 Bezug zu einem unbeteiligten Dritten 90 Ausrichtung 92 Beispiele 92 2.2.3 Kompositorische Aspekte räumlicher Relationen 98 Geraden/Ungeraden 98 Vertikalen/Horizontalen/Diagonalen 98 Symmetrien/Asymmetrien 99 Bildfeldsymmetrien/Goldene Schnitte/Drittelteilungen 100 Wiederholungen/Muster 101 Beispiele 102 2.2.4 Schärfentiefe/Tiefenschärfe 106 2.3 Parameter der Einstellung 111 2.3.1 Einstellungsgrößen 111 Bezugsgröße 111 Bezeichnungen 113 Funktionalität 116 2.3.2 Einstellungslänge 119 Länge und Relevanz 119 Ein Beispiel 120 2.4 Einstellungsperspektiven 123 2.4.1 Höhen-Relationen 124 Beschreibungsdimensionen und Begriffe 124 Beispiele 124 2.4.2 Seiten-Relationen 128 Bedeutungsdisposition 128 Ei« ßeispie/ 130 2.4.3 Horizontal-Relationen 133 Beschreibung 133 Ei« Beispiel 134 2.4.4 Bildfeld-Positionen 135 Beschreibungsdimension und Semantisierbarkeit 135 Beispiele 136 2.5 Kamerabewegung 139 Kamerafahrten und Drehen der Kamera 139 Zoom 140 Relation zur Szenerie 140 Apparative Dimension 141 Bedeutung der Kamerabewegung 142 Beispiele 143 2.6 Schnitt und Montage 146 2.6.1 Einstellungskonjunktion und Schnittfrequenz 147 Einstellungskonjunktion 147 Schnittfrequenz 149 2.6.2 Montage und Diskontinuität 152 Segmentierung/Diskontinuität 153 Diskontinuität und Kohärenzmechanismen 154 2.6.3 Grundlegende Syntagmen 155 Szene 155 Dialemma 156 Alternierende Montage 156 Deskriptives Syntagma 157 3. Filmische Wirklichkeit 3.1 Filmischer Raum 162 3.1.1 Konstruktionen filmischer Wirklichkeiten 163 Mediale Realität 163 Mediale Repräsentation 165 3.1.2 Räumliche Qualitäten 167 Bildraum 168 Architekturraum 169 Filmraum 169 Filmischer Raum und Diegese 170 Filmischer Raum und Weltordnung 172 3.2 Figur und Körper 173 3.2.1 Figuren 173 Figurenkonfiguration 173 Figurenkonstellation 174 Merkmalszuweisung und Figurensemantik 174 Figurenkonzeption 177 3.2.2 Der Körper im Film 178 Körper und Semiotik 179 Körper und Film 180 Filmischer Körper 181 3.2.3 Körper und Bedeutungsgenerierung 182 Der Körper als Zeichensystem 183 Starimage 183 Der Körper als Zeichen 183 3.3 Die Ordnung der dargestellten Welt 185 3.3.1 Semantische Räume 185 Semantik und Raum 186 Raumsemantik und Figur 187 Topografie und Topologie 188 Grenzen 189 Abstrakt semantische Räume/zugrundeliegende Ordnungen 190 3.3.2 Extremräume/Extrempunkte 191 3.3.3 Etablierung von Ordnungen 194 Geschehen vs. Handlung 194 Grenzsetzungen 196 Establishing Shot 196 3.4 Filmische Argumentation 202 3.4.1 Sukzession und Bedeutung 202 Syntagmatische Bedeutungskomponente 202 Inszenierung von Verbindungen - der Match Cut 205 3.4.2 Semantisch-argumentative Syntagmen 209 Vergleich - die Parallelmontage 209 Paradigmenbildung - das thematisch begrenzte Syntagma 214 3.4.3 Filmische Zeichen 215 Semiotische Bedeutungskomponente 216 Destinationspunkte 219 3.5 Referenzialität 221 3.5.1 Semantische Referenz: Paradigmenvermittlung 224 Ideologie 225 3.5.2 Filmische Welten und außerfilmische Realität 225 Authentizitätssignale 227 Textsorten 228 3.5.3 Referenzielle Bedeutungskomponente 229 3.5.4 Selbstreferenzialität 238 3.6 Film und Musik 250 3.6.1 Musik als Zeichensystem 250 3.6.2 Terminologie der Musiktheorie 253 Melodieverlauf 253 Harmonik 254 Rhythmus und Tempo 256 Dynamik und Artikulation 257 Instrumentierung 258 Musikgenre/Genre 258 3.6.3 Das Verhältnis der musikalischen Ebene zum Bild 259 3.6.4 Bedeutungsgenerierung durch Musik 261 1. Dramaturgischer Einsatz von Musik 262 2. Spannungsgenerativer Einsatz von Musik 265 3. Emotionaler Einsatz von Musik 268 4. Konzeptioneller Einsatz von Musik 271 3.6.5 Musik mit Text 275 3.6.6 Musik und Handlung - das Beispiel SERENADE (D 1937) 279 4. Filmisches Erzählen 4.1 Grundlagen filmischer Narration 286 4.1.1 Dimensionen des Erzählens 287 1. Erzählmittel/Discours 287 2. Vermittlung-Point of View 289 3. Handlung/Narrative Struktur 290 4. Dramaturgie 292 4.1.2 Konventionen des Erzählens 294 Der Kontrakt 294 Achsensprung und Jump Cut 296 4.1.3 Inkorporierung des Zuschauers 297 1. Identifikation/Sympathielenkung/Komplizenschaft 297 2. Involvierung über Informationsvergabe 299 3. Dramaturgische Zeichen 305 4.2 Point of View - die filmische Erzählsituation 309 4.2.1 Erzählinstanzen und Vermittlung 309 Situierung der Vermittlung 309 Auditiver und visueller Kanal 311 Wahrnehmung und Informationsvermittlung 313 Kommunikationsakte 316 4.2.2 Strukturierung des Wahrnehmungsstandortes 318 Branigans Theorie des POV-Shot 318 Wahrnehmungslevel 320 4.2.3 Point of View und 4.3 Handlung/Narrative Strukturen 327 4.3.1 Temporale Strukturen 327 Die Ellipse 328 4.3.2 Handlung als Grenzüberschreitung 334 Der Begriff der Grenzüberschreitung 335 Lotmans Grenzüberschreitungstheorie 335 Ereignis und Held 336 Ereignistypen 337 Beginn der Ereignishafiigkeit 339 Perspektivierung und bedingte Ereignisse 340 4.3.3 Handlungsverlauf 341 Ereignistilgung und Konsistenzprinzip 342 Hierarchisierung von Ereignissen 343 Das Weiterführen von Handlung 344 Das Beuteholerschema 347 Narrative Struktur und ideologische Textschicht 348 4.3.4 Die Extrempunktregel 349 4.4 Grenzen/Grenzüberschreitungen und Filmische Welten 352 4.4.1 Figurationen von Grenzen 353 4.4.2 Typen von Grenzen und Grenzüberschreitungen 355 1. Topograßsche Grenze/Diegetische Grenzüberschreitung 356 2. Die Grenze als Transformation des Discours 356 3. Semantische Grenze/Grenzüberschreitung als Ereignis 357 4. Inszenierte Grenze/Grenzüberschreitung 358 5. Grenze der Diegese/Metadiegetische Grenzüberschreitung 360 4.4.3 Formatierungen filmischer Welten: Genres 361 4.5 Dramaturgie 366 4.5.1 Begriffe und Grundlagen 366 1. Zentrale Frage/Prämisse/These 366 2. Die Theorie des Dramas nach Aristoteles 369 3. Gattungen und Genres 374 4.5.2 Strukturelemente 375 1. Die Struktur der drei Akte 375 2. Verbindung von Figuren und Handlung 377 3. Interaktion von Zeit, Raum und Entwicklung 380 4.5.3. Das Modell der Archetypen/Die Heldenreise 382 1.Grundlagen des Modells 383 2. Die dramaturgische Funktion von Räumen 388 3. Der Entwicklungsbogen 390 5. Anwendungsbereiche der Filmanalyse 5.1 Heuristik 394 5.2 Methodische Vorgehensweise 398 Textadäquatheit 398 Kontextadäquatheit 399 Interpretationsadäquatheit 400 5.3 Filmanalyse im kulturwissenschaftlichen Kontext 400 Der Film und seine Kultur 401 Filmübergreifende Systeme 403 Anhang Filmografie 406 Abbildungsverzeichnis 409 Die Autorinnen und Autoren 411 Weitere Titel aus der Reihe Schriften zur Kultur- und Mediensemiotik |
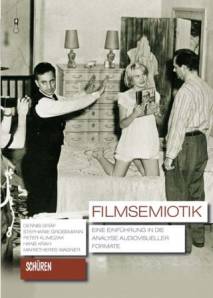
 Bei Amazon kaufen
Bei Amazon kaufen