|
|
|
Umschlagtext
Siehe Informationstext.
Rezension
Dass Ästhetik zu einem guten Leben, zur Freiheit des Menschen beitragen kann, ist der Grundgedanke in Friedrich Schillers Briefen „Über die ästhetische Erziehung des Menschen“(1795). Aber nicht nur bei diesem Vertreter Weimarer Klassiker finden sich in seiner ästhetischen Theorie ethische Praktiken, sondern auch zum Beispiel bei Johann Wolfgang von Goethe in seinem Roman „Wilhelm Meisters Lehrjahre“ sowie bei Philosophen und Literaten der Aufklärung wie Shaftesbury, Alexander Gottlieb Baumgarten, Gotthold Ephraim Lessing, Johann Christoph Gottsched oder Christoph Martin Wieland. Davon zeugen die Beiträge des Projekts „ETHOS. Ethische Praktiken in ästhetischen Theorien des 18. Jahrhunderts“, die auf der Abschlusstagung vom 31.3. bis zum 2.4.2022 an der Universität Zürich präsentiert wurden. Veröffentlicht liegen diese in dem Band „Ethische Praktiken in ästhetischen Theorien des 18. Jahrhunderts“ vor, der als Sonderheft 24 der „Zeitschrift für Ästhetik und Allgemeine Kunstwissenschaft“(ZÄK) im Felix Meiner Verlag erschien. Herausgeber:innen des in vier Kapitel klar gegliederten Buches sind Frauke Berndt, Johannes Hees-Pelikan, Marius Reisener und Carolin Rocks.
Die Beiträge des ZÄK-Sonderheftes stammen primär von Germanist:innen und Literaturwissenschaftler:innen. In diesen zeigen die Wissenschaftler:innen in ihren Fachbeiträgen auf, welche Vielfalt von ethischen Praktiken in Ästhetiken im 18. Jahrhundert thematisiert wurde. Dadurch wird das Verhältnis von Poetik, Ästhetik und Ethik sehr gut erschlossen. Lehrkräfte der Fächer Deutsch, Philosophie und Ethik werden durch das vorliegende Sonderheft motiviert, sich in ihrem Fachunterricht oder in einem fächerübergreifenden Projekt problemorientiert mit dem Verhältnis von Ästhetik und Ethik auseinanderzusetzen. Dazu bietet sich beispielsweise die unterrichtliche Beschäftigung mit Lessings Drama „Miss Sara Sampson“ oder mit Schillers Ästhetik-Briefen an. Fazit: Der Forschungsband „Ethische Praktiken in ästhetischen Theorien des 18. Jahrhunderts“ beleuchtet differenziert das Verhältnis von Ästhetik und Ethik in der Zeit von der Frühaufklärung bis zur Weimarer Klassik. Dr. Marcel Remme, für lehrerbibliothek.de Verlagsinfo
Ein gutes Leben: Das beschäftigt die Denkenden im langen 18. Jahrhundert wie keine andere Frage. Dass dieses Problem nicht nur von der hohen Warte der Vernunft aus angegangenen werden kann, ist allen Beteiligten klar. Deshalb geht es mit dem guten Leben vor allem um die ethischen Praktiken im Alltag, die das Miteinander der Menschen bestimmen. Diese Alltagspraktiken sind Gegenstand einer philosophischen Debatte, die im Spannungsfeld von Ethik und Ästhetik geführt wird. Die Praktiken führen aber vor allem immer wieder zur Literatur und zur Kunst, in denen ethische Praktiken erprobt und reflektiert werden und deshalb genau dort beobachtet werden. Ein gutes Leben beweist sich deshalb nicht in Vorsätzen und Prinzipien, sondern in Handlungen. Inhaltsverzeichnis
Frauke Berndt, Johannes Hees-Pelikan, Marius Reisener und Carolin Rocks: Einleitung – Ethische Praktiken in ästhetischen Theorien des 18. Jahrhunderts 7
URTEIL – KRITIK – ADRESSE 29 Rüdiger Campe: Ethik und Ethos – Shaftesburys Characteristics of Men, Manners, Opinions, Times29 Evelyn Dueck: »Alle unser Wissen muß praktisch seyn« – Meiers Philosophische Sittenlehre und ihre Grundlegung in einer Theorie des sinnlichen Menschen 47 Carolin Rocks und Sebastian Meixner: Fehlerlese – Praktiken der Kritik in Gottscheds Poetik 63 Frauke Berndt: Praktiken des Heldengedichts – Baumgartens Interventionen in Klopstocks Messias im Kollegium über die Ästhetik 83 Kathia Kohler: Schöne Geisterjagd – Die Diskurspraktik des Spottens in Groschs Regeln der Satyre aus ihren Gründen hergeleitet 107 Ralf Simon: »Autorhandlung« – Hamann und Jean Paul über Herder 127 ERZIEHUNG – BEZIEHUNG – ANZIEHUNG 145 Daniel Fulda: Praktiken der Aufklärung in der Romandiskussion bei Thomasius – Eine Literaturtheorie stellt sich in den Dienst der politischen Klugheit 145 Peter Wittemann: Literatur und Luxus – Praktiken erziehenden Erzählens in Wielands Goldnem Spiegel 167 Marius Reisener: Romanpraktiken – Blanckenburgs Versuch über den Roman 183 Stefan Matuschek: Praktiken der Höflichkeit – Schillers Briefe Über die ästhetische Erziehung des Menschen 201 Christian Metz: Geistesgegenwärtigkeit – Hölderlins epistemische Praxis des Ethos 215 Gabriel Trop: Praktiken der Anziehung 235 FORMEN – MEDIEN – DINGE 259 Stephan Kammer: Praktiken des Epigramms – Scaliger, Lessing, Goethe 259 Elisabeth Décultot: Was heißt empfinden? – Zur Funktion der Kunst in Du Bos’ und Sulzers Ästhetik 279 Roland Spalinger: »Prüfe-Stein« – Praktiken der Freundschaft in Baumgartens Ethica philosophica und Philosophischen Brieffen von Aletheophilus 297 Luca Alexander Arens: Anerkennungspraktiken in Lessings Kriegsdramen 317 Cornelia Pierstorff: Stoff – Textile Praktiken in Sophie von La Roches Pomona 333 AFFEKT – KÖRPER – RESONANZ 349 Nicola Gess: Bewunderung, Verwunderung, Erstaunen? – Praktiken des Staunens in der Tragödientheorie der Frühaufklärung und in Lessings Philotas 349 Johannes Hees-Pelikan: Genderpraktiken – Zur Praxeologie des Mitleids am Beispiel von Lessings Miß Sara Sampson 367 Alexander Honold: Gefühls-Transport – Ethik und Ästhetik in literarisch reflektierten Praktiken der Schauspielkunst 383 Britta Herrmann: Information und Plastisierung – Anthropo-Praktiken der Kunst und Literatur um 1800 399 Boris Previšic: Akustische Praktiken in der alkäischen Ode der Aufklärung 417 Fritz Breithaupt: Von der Schwierigkeit auf andere zu hören – Rezeptivität als Praxis in Wilhelm Meisters Lehrjahre 437 |
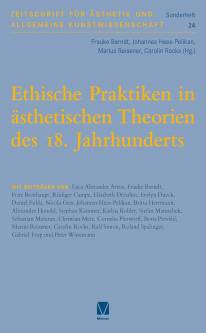
 Bei Amazon kaufen
Bei Amazon kaufen