|
|
|
Umschlagtext
Die neue Arbeitswelt ist von zunehmender Unsicherheit geprägt. Diskontinuierliche Beschäftigungsverhältnisse sind weiter auf dem Vormarsch. Für die Beschäftigten in der Wissensökonomie sind damit höhere Freiheitsgrade verbunden, aber auch neue Belastungen – bis hin zum Burnout. Zudem sind Jobnomaden, Freelancer und Zeitarbeitende oft von betrieblicher Gesundheitsförderung ausgeschlossen. Wie und von wem können diese Gruppen bei der Gesundheitsprävention unterstützt werden?
Der Band beleuchtet diese Fragen aus verschiedenen sozialwissenschaftlichen Perspektiven und unterfüttert die Argumentation mit empirischen Erkenntnissen. Rezension
Zwar brüstet sich die Bundesregierung zum Jahreswechsel 2010/2011 damit, die Arbeitslosenzahl wieder auf die 3 Mio.-Marke abgesenkt und als beste Wirtschaftsnation aus der Wirtschafts- und Bankenkrise heraus gestartet zu sein, - Faktum ist aber auch, dass sich der Arbeitsmarkt in einem enormen Wandlungsprozess befindet und dass viele Beschäftigungsverhältnisse eben nur halbe, minimale oder Teilzeit-Beschäftigungsverhältnisse sind, so dass schnell aus einem "Arbeitsplatz" zwei werden und sich so natürlich Statistiken "schönen" lassen (deshalb vertraut Rezensent nur den Statistiken, die er selbst gefälscht hat ...). Hinzu kommt ein weiterer gravierender Wandel am Arbeitsmarkt: die deutliche Zunahme sog. prekärer Beschäftigungsformen, gern auch mit dem euphemistischen Amerikanismus des Freelancers umschrieben ... Beschäftigungsformen ohne soziale Absicherung. Das hat auch auf die Gesundheit der Arbeitsnehmer elementare Auswirkungen, wie sie in diesem Band beschrieben werden mit den Stichworten: Arbeitsbelastungen, Unsicherheit, Burnout, Ressourcen, Prävention - unter dem treffenden Titel "Erschöpfende Arbeit".
Oliver Neumann, lehrerbibliothek.de Verlagsinfo
Schlagworte: Prekäre Beschäftigungsformen, Arbeitsbelastungen, Unsicherheit, Burnout, Ressourcen, Prävention, Gesundheitsförderung, Freelancer Adressaten: Soziologie, Gesundheitswissenschaft, Sozialpsychologie, Arbeitswissenschaft Heiner Keupp (Prof. Dr.) war bis 2009 Professor für Sozial- und Gemeindepsychologie an der Ludwig-Maximilians-Universität München. Er ist Projektleiter im Münchner Teil des BMBF-Projekts »pragdis«, hat diverse Gastprofessuren inne und war Vorsitzender der Kommission zum 13. Kinder- und Jugendbericht der Bundesregierung. Helga Dill (Dipl.-Soz.) ist wissenschaftliche Mitarbeiterin im Projekt »pragdis« an der Ludwig-Maximilians-Universität München und am IPP München. Sie beforscht, begleitet und berät seit vielen Jahren Einrichtungen, Projekte und Programme im Bereich der psychosozialen Versorgung. WWW: pragdis WWW: IPP München WWW: LMU München Inhaltsverzeichnis
Vorwort: Erschöpfende Arbeit – Gesundheit und Prävention in der flexiblen Arbeitswelt
Heiner Keupp, Helga Dill 7 Unterstützung für Wissensarbeiter – Geleitwort Volker Schütte 19 Prävention in der Wissensökonomie – eine neue Herausforderung für die Arbeitsforschung Rüdiger Klatt, Hartmut Neuendorff 21 Das erschöpfte Selbst – Umgang mit psychischen Belastungen Heiner Keupp 41 Zunahme der psychischen Erkrankungen bei Beschäftigten Statistische Ergebnisse und Präventionsansätze der Krankenkassen Erika Zoike 61 Neue Anforderungen an die Arbeitswelt – neue Anforderungen an das Subjekt Fritz Böhle 77 Psychische Belastung durch neue Organisations- und Steuerungsformen. Befunde aus dem Projekt PARGEMA Wolfgang Dunkel, Nick Kratzer, Wolfgang Menz 97 Belastungen, Beanspruchungen und Ressourcen in der IT-Arbeit Befragung von Beschäftigten und Freelancern der IT- und Medienbranche Dagmar Siebecke, Annika Lisakowski 119 Entgrenzt statt entfremdet – Arbeit ohne Ende? Ergebnisse der qualitativen retrospektiven Fallstudien im Projekt pragdis Helga Dill, Florian Straus 143 Prävention in diskontinuierlichen Erwerbsverläufen: Wer trägt die Verantwortung? Kurt-Georg Ciesinger 169 Betriebliche Gesundheitsförderung in der Wissensökonomie – Zwischen „halbierter Modernisierung“ und nachhaltiger Arbeitsqualität Guido Becke 187 Autorinnen und Autoren 219 Leseprobe: Vorwort: Erschöpfende Arbeit – Gesundheit und Prävention in der flexiblen Arbeitswelt HEINER KEUPP, HELGA DILL Die Entwicklung hin zu einem globalen Kapitalismus hat die Lebensund Arbeitsbedingungen der Menschen grundlegend verändert. Diese Veränderungen betreffen nicht nur die äußere Welt, sondern haben erhebliche Konsequenzen auch für die psychischen Innenwelten. Die eingespielten Identitätsmuster und die durch sie gesicherten Normalitätsvorstellungen brechen zusammen. Diese aktuellen Erfahrungen mit der Demontage unserer stabilen Identitätsgehäuse könnte man mit der klassischen Formulierung aus dem Kommunistischen Manifest kaum besser ausdrücken. Die Rede ist da von der „ununterbrochene(n) Erschütterung aller gesellschaftlichen Zustände, die ewige Unsicherheit und Bewegung zeichnet die Bourgeoisieepoche vor allen anderen aus. Alle festen eingerosteten Verhältnisse mit ihrem Gefolge von altehrwürdigen Vorstellungen und Anschauungen werden aufgelöst, alle neu gebildeten veralten, ehe sie verknöchern können. Alles Ständische und Stehende verdampft, alles Heilige wird entweiht...“ (Marx und Engels 1966, S.29). Diese Veränderungsdynamik wird vor allem in der Arbeitswelt erfahrbar. Die viel beschworene „Erosion des Normalarbeitsverhältnisses“ kennzeichnet angesichts zunehmend entgrenzter Arbeit und hochflexibler, „grenzenloser” Unternehmen weite Teile des aktuellen Arbeitsmarktes. Sie drückt sich in einer wachsenden Heterogenität von 8 | ERSCHÖPFENDE ARBEIT Beschäftigungsformen und einer Entstandardisierung der Erwerbsbiografien aus. Die ehemals festen Koordinaten des deutschen Produktions- und Dienstleistungsregimes sind in Auflösung begriffen. Das teils noch fest gefügte System, in der Betriebsstätte, Belegschaft, Arbeitszeit und Arbeitsprozess noch in genau definierten Grenzen lagen, verliert an Bedeutung. Wenn die institutionellen Rahmenbedingungen immer weniger Kontinuität und Sicherheit garantieren, rückt die Frage ins Zentrum, was das für die Subjekte bedeutet. In den Sozialwissenschaften hat sich eine lebendige und teilweise kontroverse Debatte um eine theoretische Erfassung der Individualisierungsprozesse und -folgen entwickelt. Thematisiert wird vor allem die Subjekt-Struktur-Schnittstelle. Die industrielle Moderne hat für die Integration der Subjekte in gesellschaftliche Strukturen spezifische Grundmuster ausgebildet, die eine epochenspezifische Passung von sozialstrukturellen Anforderungen und individuell-biographischen Formen der Lebensführung und Identitätsentwicklung ermöglicht haben. Erwerbsbezogene Normalbiographien, geschlechtsspezifische Formen der Arbeitsteilung, soziale Sicherungssysteme oder Vergemeinschaftungszusammenhänge haben in der industriellen Moderne Lebensformen ermöglicht, die zumindest die normative Erwartung einer dauerhaften Subjekt-Struktur-Synchronisation begründet haben. Sie haben den Status von Basisprämissen gesellschaftlicher Reproduktion angenommen. Subjektspezifische soziale Integrationsleistungen – die sich in den Grundgefühlen von Vertrauen, Sicherheit, Zugehörigkeit und Kontinuität äußern – schienen über diese Grundmuster industriegesellschaftlicher Lebensformen garantiert. Die theoretische Figur der „Zweiten Moderne“ bzw. reflexiven Modernisierung ist von der Annahme eines durchgängigen Prozesses der Individualisierung geprägt, der vor allem in Bezug auf die genannte Subjekt-Struktur-Synchronisation zu nachhaltigen Veränderungen führt. Die gesellschaftlichen Passungsangebote verlieren an Prägekraft für individuelle Biographien und die alltägliche Lebensführung. Subjekte werden mit der wachsenden Notwendigkeit konfrontiert, für die eigene Lebensorganisation bedürfnisgerechte Muster selbstständig zu entwickeln. Auf die bislang als gültig betrachteten „Normalformtypisierungen“ als regulierende Prinzipien für die private und berufliche Lebenswelt ist kein Verlass mehr. Vorstellungen von Lebenssicherheit, von DILL/KEUPP: VORWORT | 9 eindeutiger und fester sozialer Verortung, von innerfamiliärer Arbeitsteilung oder von der identitätsstiftenden Qualität der Erwerbsarbeit werden in Zweifel gezogen. Individualisierung wird als „Vergesellschaftungsmodus“ thematisiert, der sich in seinem Deutungsmuster offensichtlich immer mehr in den Subjekten verortet hat und „Selbstkontrolle, Selbstverantwortung und Selbststeuerung akzentuiert“ (Wohlrab-Sahr 1997, S.28). Diese Konstrukte lassen sich durchaus als befreiende Dynamik individueller Lebensführung darstellen, aber sie haben zugleich die Konnotation der Verpflichtung zu Selbstverantwortung und sozialer Kontrolle. Manche Rezipienten haben die frühen Produkte vor allem von Ulrich Beck (1986) als „emphatische Individualisierung“ gelesen und sind durch manche Formulierung über die „Kinder der Freiheit“ dazu auch ermuntert worden; aber auch die ersten Theoriebausteine haben nie die Ambivalenzen oder auch die neuen Zwänge ausgespart. Seitdem der Begriff der Individualisierung Gegenstand der Theoriedebatten geworden ist, werden vermehrt die Folgen dieses Prozesses für Individuum und Gesellschaft kontrovers diskutiert. Dabei ist es durchaus bedeutsam, dass eine allein positive Konnotation des Begriffes, die nur auf die erfreulichen, weil befreienden Effekte des Freisetzungsprozesses aus überkommenen Bindungen und aus bis dato unhinterfragbaren Verpflichtungen, im strengen Sinne nicht vorliegt. Denn noch die eifrigsten Vertreter einer positiven Lesart weisen auf die Ambivalenzen des Individualisierungsprozesses für das einzelne Subjekt hin. Demgegenüber betonen die Vertreter einer negativen Lesart in erster Linie eine Verfallsperspektive im Hinblick auf das Verschwinden bisheriger sozialer Bindungen und bewegen sich letzten Endes in der Durkheimschen Tradition der Diagnose gesellschaftlicher Anomie. Demgegenüber ist die von Beck vertretene Lesart eine, welche die Ambivalenzen, Nebenfolgen und Brüche des Individualisierungsprozesses in den Mittelpunkt stellt. Von „ganz normal chaotischer Individualisierung“ (Beck 2007, S.582) ist dabei u.a. in Anlehnung an andere Zusammenhänge die Rede. Der Blick auf die Folgen für das einzelne Individuum und seine sozialen Zusammenhänge bedeutet indes nicht, dass die gesellschaftliche Seite der Individualisierung ausgeblendet wird, denn Individualisierung ist zuvorderst ein gesellschaftlicher Prozess, d. h. er wird insti10 | ERSCHÖPFENDE ARBEIT tutionell unterstützt, vorangetrieben und gefördert. Die Autonomie des Individuums als Ergebnis und Anforderung des Individualisierungsprozesses ist also auch vor diesem Hintergrund zu betrachten. Genauer, die Autonomiebehauptung des Subjekts steht in unmittelbarem Zusammenhang mit der Autonomiezuschreibung und -erwartung durch gesellschaftliche Institutionen. In dem Maße, wie dies der Fall ist, können wir von einer institutionalisierten Individualisierung sprechen. Es kommt weniger auf das Autonomiebedürfnis der Subjekte an, das man durchaus unterstellen darf, nein: Autonomie wird ihnen abverlangt, aufoktroyiert, abgefordert. Nicht immer, nicht überall, aber grundsätzlich haben viele Institutionen die Erwartung an die Subjekte, sich als individualisiertes Individuum zu definieren. Und natürlich ist dieses normative Programm auch schon in die Selbstbeschreibung der Subjekte integriert. Fest steht: Das Programm der Individualisierung ist zur affirmativen Selbstbeschreibung der Individuen geworden, zur Erklärungsformel des eigenen Soseins. Im Arbeitsbereich finden wir die Figur des „unternehmerischen Selbst“ (Bröckling 2007) als Ziel institutioneller Individualisierung mit der Doppelbotschaft von Autonomie und Kontrolle und der möglichen Konsequenz eines ermüdeten Selbst: Entwickle ein unternehmerisches Selbst und weise mir das nach! Im Arbeitskontext fällt uns aus der Perspektive sozialer Verortung auf, dass es hier nicht nur zu einer Verunklarung der Außen- sondern auch der Binnengrenzen kommt. Der hierarchische Aufbau, der in einem ersten Schritt möglicherweise durch eine Matrixstruktur überlagert wurde, wird nun zusätzlich unter einer Netzwerkperspektive betrachtet. Soziale Netze der Mitarbeiter werden aus der halbprivaten Sphäre geholt, Networking wird verbindlich und Teil der Beurteilung. Neue Arbeits- und Steuerungsformen setzen sich durch und verlangen neue Kompetenzen der Personen. Freelancer, diskontinuierlich Beschäftigte, Alleinunternehmer/innen benötigen dieses unternehmerische Selbst. Hans Pongratz und Günter Voß (2003) beobachten den Zwang zum unternehmerischen Umgang mit sich für die Sphäre der Erwerbsarbeit im Allgemeinen. Sie sehen den „Arbeitskraftunternehmer“ als neuen Leittypus der Erwerbsarbeit – passend zu Flexibilisierungs- und Entgrenzungsprozessen in allen Lebensbereichen. Die DILL/KEUPP: VORWORT | 11 Erwerbssphäre, der Betrieb waren lange durch vielfältige institutionelle Regelungen gegen Individualisierungsprozesse gefeit – sie haben das Selbst, wie es Fritz Böhle in seinem Beitrag zu diesem Buch zeigt, nicht durch die Tore eingelassen. Im Zuge von Globalisierung, weltweitem Wettbewerb und Deregulierung, haben sich neue Steuerungsformen durchgesetzt. Noch ist die Reichweite dieser Entgrenzungs- und Individualisierungprozesse nicht absehbar. Qualifizierte Tätigkeitsbereiche geraten aber immer mehr in den Sog von Selbstmanagement, Selbststeuerung, Selbstkontrolle u.ä. Die Deutung der durchgängigen Individualisierungsprozesse ist notwendigerweise in seinen widersprüchlichen Folgen für die Subjekte zu thematisieren. Das hat Jürgen Habermas (1998, S.126 f.) als „zweideutige Erfahrung“ benannt: „die Desintegration haltgebender, im Rückblick autoritärer Abhängigkeiten, die Freisetzung aus gleichermaßen orientierenden und schützenden wie präjuduzierenden und gefangen nehmenden Verhältnissen. Kurzum, die Entbindung aus einer stärker integrierten Lebenswelt entlässt die Einzelnen in die Ambivalenz wachsender Optionsspielräume.“ Zunehmend richtet sich die Aufmerksamkeit der sozialwissenschaftlichen Zeitdiagnose auf die problematischen Folgen der Individualisierungsprozesse im Kontext der kapitalistischen Globalisierung (vgl. Jensen & Westenholz 2004). So kann man bei Richard Sennett (2005) lesen: „Ich behaupte, dass diese Veränderungen den Menschen keine Freiheit gebracht haben. Warum? Weil die Menschen äußerst besorgt und beunruhigt sind im Hinblick auf ihr Schicksal unter den Bedingungen des „Wandels“. Was ihnen fehlt, ist ein mentaler und emotionaler Anker. Nachdem sich der alte soziale Kapitalismus aufgelöst hat, erzeugen die neuen Institutionen nur ein geringes Maß an Loyalität und Vertrauen, dafür aber ein hohes Maß an Angst vor Nutzlosigkeit.“ Die Anforderungen der veränderten und globalisierten (Arbeits-) welt bleiben nicht ohne Folgen für die Gesundheit der Personen. Klassische Gefährdungen und Risiken wie etwa Unfälle oder körperlich schwere Arbeiten verlieren Bedeutung. Psychische Belastungen und Erkrankungen – oft stressbedingt – sind dagegen auf dem Vormarsch. So hat 12 | ERSCHÖPFENDE ARBEIT beispielsweise die Zahl der Arbeitsunfähigkeitstage aufgrund psychischer Erkrankungen (Depressionen, Neurosen etc.) in den letzten zehn Jahren in Deutschland um rund 40% zugenommen. Alain Ehrenberg spricht von dem „erschöpften Selbst“, der Depression als der typischen Krankheit unserer Zeit. „Die Depression … ist die Krankheit einer Gesellschaft, deren Verhaltensnorm nicht mehr auf Schuld und Disziplin gründet, sondern auf Verantwortung und Initiative“ (Ehrenberg 2004). Burnout – früher symptomatisch für helfende und pflegende Berufe, für Erwerbstätige, die Gefühlsarbeit leisten – ist in viele Arbeitsbereiche vorgedrungen: der IT- und Kommunikationssektor ist überproportional betroffen. Lehrkräfte, Unternehmensberaterinnen und Unternehmensberater, Telefonistinnen und Telefonisten, Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter in Call-Centern, alle diese Sektoren tauchen heute in Statistiken auf, in denen es um Arbeitsunfähigkeitstage aufgrund psychischer Erkrankungen und Störungen, aufgrund von Erschöpfung geht. Die Organisationsform der Arbeit, die Steuerungsformen, aber auch Fragen, ob der Arbeitsplatz gesichert ist, ob die Aufträge fließen, spielen für das Auftreten von Erschöpfungssymptomen eine große Rolle. Aber welche Rolle spielt der Arbeitsinhalt? Kann Arbeit mit, am und für den Computer Erschöpfungszustände begünstigen? Das amerikanische Psychologenteam Gary Small und Gigi Vorgan (2008) hat in einer Studie Belege dafür gefunden, dass der Computer nicht nur soziale Kompetenzen beeinflusst, sondern das Gehirn neurologisch verändert. Frank Schirrmacher (2009) sieht das Netz an sich, den täglichen Umgang mit Information und Informationstechnologie als Ursache für Erschöpfung. Die skizzierten Entwicklungen wirken zunächst sehr hoffnungslos. Globalisierung, Individualisierung, Computerisierung – gibt es ein Entrinnen? Gibt es Strategien, die gesund erhalten, den gesellschaftlichen, technischen und wirtschaftlichen Entwicklungsprozessen zum Trotz? Der Medizinsoziologe Aaron Antonovsky (1997) bietet mit dem salutogenetischen Modell einen Ansatz für die Frage, was Menschen trotz widriger Lebensumstände, trotz Risiken und Belastungen gesund erhält. Antonovsky fragt nach den Ressourcen, auf die Personen zuDILL/ KEUPP: VORWORT | 13 greifen können, um mit diesen belastenden Alltagserfahrungen umgehen zu können. Eine zentrale Widerstandsressource ist der Kohärenzsinn. Als Kohärenzsinn wird ein positives Bild der eigenen Handlungsfähigkeit verstanden, die von dem Gefühl der Bewältigbarkeit von externen und internen Lebensbedingungen, der Gewissheit der Selbststeuerungsfähigkeit und der Gestaltbarkeit der Lebensbedingungen getragen ist. Der Kohärenzsinn ist durch das Bestreben charakterisiert, den Lebensbedingungen einen subjektiven Sinn zu geben und sie mit den eigenen Wünschen und Bedürfnissen in Einklang bringen zu können. Das Kohärenzgefühl repräsentiert auf der Subjektebene die Erfahrung, eine Passung zwischen der inneren und äußeren Realität geschafft zu haben. Umso weniger es gelingt, für sich Lebenssinn zu konstruieren, desto weniger besteht die Möglichkeit sich für oder gegen etwas zu engagieren und Ressourcen zur Realisierung spezifischer Ziele zu mobilisieren. Zu einer Gesundheitsförderung gehört damit die Förderung der Widerstandsressourcen, im Sinne der WHO-Definition von Gesundheit die Schaffung einer Lebenswelt, in der Individuen an Handlungsfähigkeit gewinnen können, in die Lage versetzt werden, mit Stressoren, mit erschöpfenden Lebensbedingungen umgehen zu können. Wer aber ist verantwortlich für die Förderung solcher Lebensbedingungen? Eine klassische Präventionsagentur der „alten“ Arbeitswelt ist der Betrieb. Betriebliche Prävention, betriebliches Gesundheitsmanagement richten sich an die Stammbelegschaft. Mit zunehmender Flexibilisierung und zunehmender Unsicherheit der Beschäftigungsverhältnisse wird betriebliche Gesundheitsvorsorge zunehmend randständig. Wird Prävention für diskontinuierlich Beschäftigte somit zu einem individuellen Projekt, geht es neben Selbstmanagement, Selbstorganisation und Selbstrationalisierung nun auch noch um Selbstprävention? Selbstverantwortung ist natürlich eine zentrale Forderung. Diese aber will gelernt sein und damit benötigen erschöpfte Subjekte unterstützende Strukturen und hilfreiche Partner für die anspruchsvolle Aufgabe, in einer zunehmend unübersichtlichen Welt den Überblick zu behalten. Der vorliegende Band beschäftigt sich mit den oben skizzierten zentralen Fragen. Ein Kernstück für die Diskussion sind die Ergebnisse des Projektes pragdis – einem Kooperationsprojekt der TU Dort14 | ERSCHÖPFENDE ARBEIT mund mit der LMU München. Pragdis will für die Zielgruppe der diskontinuierlich Beschäftigten in der IT-und Medienbranche Strategien und Instrumente des präventiven Arbeits- und Gesundheitsschutzes im Spannungsfeld zwischen betrieblichen Unterstützungsmöglichkeiten und individueller Verantwortung entwickeln. Auf der Basis von qualitativen und quantitativen Erhebungen werden die gesundheitlichen Belastungen, die individuellen Ressourcen und Präventionsstrategien der diskontinuierlich Beschäftigten analysiert. Ergänzt wird diese Betrachtung durch Befragungen bei Unternehmen. Im Fokus steht dabei die Frage, ob es branchentypische, IT-spezifische Belastungsfaktoren gibt und/oder ob die Beschäftigungsform (Alleinselbstständige, diskontinuierlich Beschäftigte, Jobhopper, Cappuccinoworker) die Belastungen mit sich bringt. Ziel des Projektes Pragdis ist, auf der Basis dieser Erhebungen spezifische Präventionsstrategien zu entwickeln und zu erproben, die sich an die Zielgruppe der diskontinuierlich beschäftigten Wissensarbeiter/ innen richten, Verbündete für die Umsetzung durch Nutzung bzw. Etablierung von überbetrieblichen Präventionsnetzwerken zu gewinnen und dabei an der Lebenswelt und der Lebensführung der Zielgruppe anzusetzen. Pragdis wird gefördert vom Bundesministerium für Bildung und Forschung und dem Europäischen Sozialfonds. Grundlage für diesen Band sind die Beiträge einer Tagung in München, bei der die pragdis-Forscherinnen und -Forscher ihre Ergebnisse mit der scientific community diskutierten. Mit der Tagung in München waren zwei Ziele verbunden: Zum einen ging es um eine erste Bilanz der quantitativen und qualitativen Forschungsergebnisse im Projekt pragdis und deren Verortung in der arbeitswissenschaftlichen, arbeitssoziologischen und sozialpsychologischen Forschung. Zum anderen ging es um erste Überlegungen zu daraus abgeleiteten Präventionsstrategien. Diese Einbettung skizziert Volker Schütte als Vertreter des Projektträgers DLR in einer kurzen Vignette. Hartmut Neuendorff und Rüdiger Klatt führen in das Projekt pragdis und seine Einbettung in die Forschungslandschaft ein und erläutern die Vernetzung von pragdis im Förderschwerpunkt „Arbeiten – Lernen – Kompetenzen entwickeln. Innovationsfähigkeit in einer modernen Arbeitswelt“ des BMBF. DILL/KEUPP: VORWORT | 15 Heiner Keupp sieht im gesellschaftlichen Strukturwandel der Globalisierung, in der „entfesselten Welt“ wie es Giddens beschreibt, die Grundlage für eine Erschöpfung als gesellschaftlichem Phänomen und plädiert für eine nachhaltige Selbstsorge, einen bedachtsamen Umgang mit den je eigenen Ressourcen und eine neue Selbstbestimmung. Die Daten der BKK zu psychischen Erkrankungen und Belastungen von Versicherten, zusammengefasst und erläutert von Erika Zoike, bestätigen die Befunde von pragdis auf eindrückliche Weise. Fritz Böhle vertritt die These von einem grundlegenden Strukturwandel der Arbeitswelt. Ausgehend von einem Rückblick auf die historische Entwicklung schildert er den Prozess der Subjektivierung von Arbeit über Selbstorganisation, Selbstmanagement bis hin zur Selbstkontrolle. Als Auslöser für Belastungen können nicht länger eindimensionale Ursache-Wirkungsfaktoren identifiziert werden, Stress und psychische Belastungen entstehen vielmehr aus Belastungskonstellationen. Erfahrungen mit Erschöpfung und Belastungskonstellationen schildern Wolfgang Dunkel, Nick Kratzer und Wolfgang Menz anhand der Ergebnisse des Projektes pargema, das sich mit (psychischen) Gesundheitsgefährdungen im Zusammenhang mit neuen Organisations- und Steuerungsformen beschäftigt und Konzepte dagegen entwickelt. Partizipatives Gesundheitsmanagement wird zusammen mit den Unternehmen, Betriebsräten, Arbeits- und Gesundheitsschutzexperten und Beschäftigten konzipiert und in ausgewählten Betrieben implementiert. Die Ergebnisse der qualitativen und quantitativen Forschungsteile in Pragdis stehen im Kern dieses Tagungsbandes. Dagmar Siebecke kommt zu dem Schluss, dass diskontinuierliche Arbeit mehr Stress mit sich bringt, aber dass die Freiheitsgrade in Kombination mit als ausreichend erlebter Gratifikation auch zu positiver Leistungsorientierung führen. Helga Dill und Florian Straus zeigen die Ambivalenzen diskontinuierlicher Arbeitsformen auf. Eine als sinnvoll erlebte Arbeit kompensiert hohen Zeit- und Ergebnisdruck. Während selbstgewählte Diskontinuität als nicht-entfremdete Arbeit positiv erlebt wird, kann erzwungen Diskontinuität, etwa aus der Arbeitslosigkeit heraus zu tiefer Erschöpfung führen. 16 | ERSCHÖPFENDE ARBEIT Guido Becke beleuchtet die Entwicklung der Gesundheitsförderung inner- und überbetrieblich. Neue Arbeitsformen – so seine These – sind mit Konzepten betrieblicher Prävention nicht mehr in den Griff zu bekommen. Gesundheitsförderung muss sich netzförmig organisieren, sich stärker auf lokale Unternehmen beziehen. Entsprechend sieht Kurt-Georg Ciesinger langfristige Präventionsstrategien für diskontinuierlich Beschäftigte in einer Kombination aus individueller und individuumsbegleitender Unterstützung. Neue Anreizsysteme müssen geschaffen werden, die nicht mehr beim Betrieb, sondern beim Beschäftigten platziert werden. Regionale Präventionsagenturen könnten flexibel beraten, unterstützen und Ressourcen bereit halten. Unser Dank gilt allen Autorinnen und Autoren, die mit ihren Beiträgen in diesem Band zu einer Diskussion über Gesundheit in der neuen Arbeitswelt einladen. Besonders bedanken wir uns bei Martin Schmidt, der mit viel Engagement an der Realisierung dieses Buchprojektes beteiligt war. LITERATUR Antonovsky, A. (1997): Salutogenese. Zur Entmystifizierung der Gesundheit. Tübingen: DGVT. Beck, U. (1986): Risikogesellschaft. Auf dem Weg in eine andere Moderne. Frankfurt: Suhrkamp. Beck, U. (2007): Tragische Individualisierung. Blätter für deutsche und internationale Politik, Nr. 5, Bonn, S.577-584. Bröckling, U. (2007): Das unternehmerische Selbst: Soziologie einer Subjektivierungsform. Frankfurt: Suhrkamp. Ehrenberg, A. (2008): Das erschöpfte Selbst. Depression und Gesellschaft in der Gegenwart. Frankfurt: Suhrkamp. Habermas, J. (1998): Die postnationale Konstellation. Frankfurt: Suhrkamp. Jensen, T.E. / Westenholz, A. (Hrsg.) (2004): Identity in the age of the new economy. Life in temporary and scattered work practices. Cheltenham: Edward Elgar. DILL/KEUPP: VORWORT | 17 Marx, K. / Engels, F. (1966): Manifest der Kommunistischen Partei. In: dies.: Ausgewählte Schriften. Band I, S.17-57. Berlin (DDR): Dietz. Pongratz, H.J. / Voß, G.G. (2003): Arbeitskraftunternehmer: Erwerbsorientierungen in entgrenzten Arbeitsformen. Berlin: edition sigma. Sennett, R. (2005): Die Angst überflüssig zu sein. In: DIE ZEIT vom 19. Mai 2005. Schirrmacher, F. (2009): Payback: Warum wir im Informationszeitalter gezwungen sind zu tun, was wir nicht tun wollen, und wie wir die Kontrolle über unser Denken zurückgewinnen. München: Karl Blessing. Small, G. / Vorgan, G. (2008): iBrain: Surviving the Technological Alteration of the Modern Mind. New York: William Morris. Wohlrab-Sahr, M. (1997): Individualisierung: Differenzierungsprozess und Zurechnungsmodus. In: Beck, U. / Soop, P. (Hrsg.): Individualisierung und Integration. Opladen: Leske + Budrich, S.23-36. Weitere Titel aus der Reihe Reflexive Sozialpsychologie |
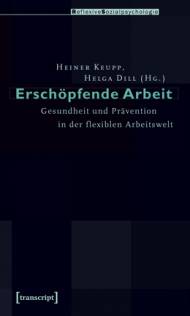
 Bei Amazon kaufen
Bei Amazon kaufen