|
|
|
Umschlagtext
Wieso wird Venus oft von einem Taubenpaar begleitet? Welche Quellen berichten von der Kindheit Marias? Und woran erkennt man den Erzengel Gabriel? Ohne die Kenntnis des klassischen Bildungskanons lassen sich viele Kunstwerke nicht verstehen.
Der vorliegende Band zur Ikonographie schafft Abhilfe, indem er eine umfassende Einführung in das weite Feld der verschiedenen Bildthemen, ihrer literarischen Quellen und der Bildfunktionen bietet. Frank Büttner ist emeritierter Professor für Kunstgeschichte an der Ludwig-Maximilians-Universität München. Andrea Gottdang ist Professorin für Kunstgeschichte an der Universität Salzburg. Bei C.H.Beck ist von den beiden Verfassern erschienen: Einführung in die Malerei (2012). Rezension
Ikonographie - das ist die kunstwissenschaftliche Methode der Inhaltsdeutung von Werken der Bildenden Kunst. Dieses Buch führt in die kunstgeschichtliche Lehre von den Bildinhalten, die Ikonographie, ein, die wesentlich auf Erwin Panofsky (1892-1968), den bekanntesten Vertreter der kunsthistorischen Schule der ‘Ikonologie’ zurück geht: In der sog. Ikonographischen Interpretation geht es darum, die Bedeutung des Werks in seiner Entstehungszeit zu ermitteln (Erfassen einzelner Motive, historische Ableitung von Motiven und Symbolen), in der sog. Ikonologischen Interpretation als drittem Schritt geht es abschließend um das Erfassen des gesamten Bildsinns oder der Botschaft des Bildes als synthetische Gesamtdeutung. Was ist dargestellt, wen verkörpern die Figuren des Bildes, was bedeutet die Szenerie, welche Quellen liegen der Darstellung zugrunde? Ikonographie als Gesamtheit der europäischen Bildthemen beantwortet kunstinteressierten Laien ebenso wie Kunsthistorikern diese Fragen. Die Ikonographie als Lehre der Verbildlichungen christlicher und heidnischer, sakraler und profaner, politischer wie privater Themen gibt Einblick in die Entstehung und den Wandel bildhafter Motive in unserer Kultur.
Oliver Neumann, lehrerbibliothek.de Verlagsinfo
Welche Quellen berichten von der Kindheit Marias? Wieso wird die Venus oft von einem Taubenpaar begleitet? – Ohne die Kenntnis des klassischen Bildungskanons lassen sich viele Kunstwerke nicht verstehen. Der vorliegende Band zur Ikonographie schafft Abhilfe, indem er eine umfassende Einführung in das weite Feld der verschiedenen Bildthemen, ihrer literarischen Quellen und der Bildfunktionen bietet. Die vorliegende Einführung, als Handbuch konzipiert, erschließt Wege zur Deutung von christlichen und profanen Bildinhalten vom frühen Christentum bis ins 20. Jahrhundert. Sie macht mit den literarischen Quellen wie der Bibel und der Überlieferung der antiken Mythologie vertraut und führt in den Forschungsstand wichtiger Themenfelder wie Typologie und Symbolik ein. Dabei informieren historische Überblicke über die Entwicklung christlicher und profaner Bildthemen und -funktionen. Die Anwendung der ikonographischen Methode wird an ausgewählten Beispielen vorgeführt, die zeigen, daß verschiedene literarische Quellen, Darstellungstraditionen, der Bestimmungsort und die Funktion des Bildes in einem komplexen Geflecht zusammenwirken. Eine Einführung in die Geschichte der ikonographischen Methode und Terminologie sowie ein kommentiertes Literaturverzeichnis vervollständigen das Studienbuch. Frank Büttner ist em. Professor für Kunstgeschichte an der Ludwig-Maximilians-Universität München. Andrea Gottdang ist Professorin für Kunstgeschichte an der Universität Salzburg. Inhaltsverzeichnis
VORWORT 9
I. EINLEITUNG 11 Wahrnehmen und Verstehen von Bildern 11 Grundbegriffe der ikonographischen Analyse 14 Zur Geschichte der ikonographischen Methode 19 Felder ikonographischer Forschung: Zentrum und Peripherie 23 II. CHRISTLICHE IKONOGRAPHIE 27 I. Historischer Überblick 27 Frühes Christentum 27 Der Bilderstreit im 8. und 9. Jahrhundert 30 Kirchenausstattung im Mittelalter 32 Das Spätmittelalter: Eine neue Bildauffassung 35 Reformation und Gegenreformation 38 Das 19. Jahrhundert 41 Das 20. Jahrhundert 43 2. Systematischer Überblick 45 Bibelillustration 45 Die Bibel 45 Texttreue und Bildfindung 46 Wandmalerei 48 Buchmalerei 49 Buchdruck 51 Liturgische Bücher und Gebetbücher im Mittelalter 53 Typologie 56 Erweiterung und Ausdeutung des biblischen Themenkanons 64 Jüdische Quellen 64 Patristik und Bibelkommentare 66 Apokryphen 68 Entstehungslegenden über Christusporträts 73 Meditationsliteratur 75 Andachtsbilder 78 Heiligenikonographie 83 Heiligenverehrung 83 Hagiographie 84 Heiligenviten: Franziskus 88 Apostel 92 Evangelisten 95 Reliquiare 96 Symbole und Personifikationen 97 Frühchristliche Symbole 97 Gottesikonographie 101 Physiologus 102 Mariensymbole 103 «Disguised symbolism» 104 Ecclesia und Synagoge 106 Tugenden und Laster 106 Exemplarische Analysen 107 Gotische Kathedralen: Das ikonographische Programm der Portale 107 Das Straßburger Münster 110 Barocke Deckenfresken 118 Die «Asamkirche» Mariae Himmelfahrt in Aldersbach 119 III. PROFANE IKONOGRAPHIE 123 1. Historischer Überblick 123 2. Systematischer Überblick 127 Symbolik, Hieroglyphik, Emblematik 128 Tier- und Pflanzensymbolik 129 Hieroglyphenkunde der Renaissance 132 Impresen 136 Emblematik 137 Emblematik in Bildzusammenhängen 140 Allegorie und Personifikation 142 Allegorie und Allegorese 142 Personifikation 146 Personifikationen in Mittelalter und Neuzeit 148 Cesare Ripa und die Kanonisierung der Personifikationen 151 Die Kritik am Gebrauch von Personifikationen 155 Allegorische Kompositionen 157 Symbol und Zeichen im 19. und 20. Jahrhundert 164 Mythologie 173 Überlieferungsgeschichte der antiken Mythologie 173 Die drei Traditionen der Mythendeutung 175 Physische Mythendeutung 176 Mythologie und Astrologie 178 Historische Mythendeutung 182 Die Apotheose 184 Moralische Mythendeutung 186 Mythologische Darstellungen in der Frührenaissance 188 Handbücher der Mythologie in der Frühen Neuzeit 192 Emanzipation des mythologischen Bildes in Renaissance und Barock 193 Mythologie in der Tradition der Herrscherikonographie 195 Barocke Synthese: Das Fresko in der Galerie des Palazzo Medici-Riccardi in Florenz 198 Krise und Neuorientierung des mythologischen Bildes 203 Geschichte 207 Historienbild und Geschichtsdarstellung 207 Geschichtsdarstellung in Mittelalter und Renaissance 209 Uomini illustri — Helden und Heldinnen 216 Geschichte als Exemplum 218 Geschichtsdarstellung im Zeitalter der Revolution 226 Zwischen Idealismus und Realismus 229 Nationalbewusstsein 233 Engagement und Kritik 236 Die Krise der Geschichtsmalerei 239 Dichtung 242 Texte und Bilder 242 Illustration im Mittelalter — Tristan und Isolde 246 Dante Alighieris Divina Commedia 249 Ludovico Ariosto und Torquato Tasso 256 Von Shakespeare zu Goethe 262 Die Nibelungen 269 IV. ENDE DER IKONOGRAPHIE? 273 LITERATURHINWEISE 276 HINWEISE ZUR INTERNETRECHERCHE 301 BILDNACHWEIS 304 Weitere Titel aus der Reihe C. H. Beck Studium |
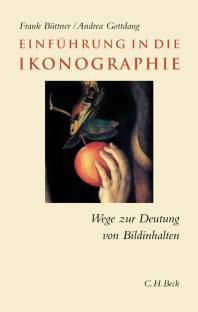
 Bei Amazon kaufen
Bei Amazon kaufen