|
|
|
Umschlagtext
Gegenwärtig erleben wir eine tiefgehende Krise aller ethischen Normen. Wir stehen nicht nur in einem rasnten Wertewandel, sondern in einem dramatischen Werteverfall. In dieser Situation genügt es nicht, bei der klassischen Frage stehenzubleiben: „Was soll ich tun?" Vielmehr gilt es, sich ganz neu der grundlegenden Frage zu stellen: „Wie kann ich überhaupt erkennen, was ich zu tun habe?" und „Wie kann ich tun, was ich als richtig erkannt habe?"
Die vorliegende „Einführung in die Ethik" gibt auf diese Fragen in einer umfassenden, neuen Konzeption Antwort. Gegenüber den Einseitigkeiten einer allgemeinen Ethik, in der das Christliche keinen Platz mehr hat, und einer christlichen Ethik, die in einer zunehmend nichtchristlichen Gesellschaft ihre Relevanz verloren hat, bindet der Autor in einem heilsgeschichtlich differenzierten Entwurf beide Anliegen zusammen: gesellschaftliche, allgemein- menschliche Relevanz und Wahrnehmung des spezifisch Christlichen. „Schon informeller Hinsicht besticht das als Lehrbuch konzipierte Buch durch seine prägnante und allgemeinverständliche Sprache". Dr. Werner Neuer, in: „Theol. Beiträge" „Burkhardt gibt in seinem Buch eine gelungene Einführung in die Grundlagen der Ethik". Marcus Mockler, in: „Reutlinger Generalanzeiger" Dr. theol. Helmut Burkhardt, geboren 1939 in Breslau, ist Dozent für Systematische Theologie am Theologischen Seminar St. Chrischona/Schweiz. Rezension
Die Ethik wird üblicherweise unterteilt ist die materiale Ethik, in der die Frage im Mittelpunkt steht: „Wie soll ich handeln?“ und in die Fundamentalethik, in der die Frage nach den Grundlagen sittlichen Verhaltens gestellt wird. Dieser Band wendet sich in dezidiert christlicher Perspektive ausschließlich den Grundlagen zu, wie der Untertitel verrät. Die Materialethik ist unter dem Untertitel „Das gute Handeln“ einem zweiten Band (in zwei Teilbänden) vorbehalten. Gerade aber die grundlegenden Fragen : "Wie und wo kann ich überhaupt erkennen, was ich zu tun habe?" Und: "Wie kann ich eigentlich tun, was ich als richtig erkannt habe?" sind entscheidend für alle Ethik. Auf 50 S. gibt der Verfasser deshalb zunächst einen verständlichen Überblick über die Fragen „Was ist Ethik?“ und „Entwürfe säkularer Ethik“, bevor er mit der spezifisch „theozentrischen Ethik“ seine eigene Grundlegung darstellt.
Jens Walter, lehrerbibliothek.de Verlagsinfo
Dr. theol. Helmut Burkhardt ist Dozent für Systematische Theologie am Theologischen Seminar St. Chrischona bei Basel. Weitere lieferbare Titel des Autors: "Die Inspiration heiliger Schriften bei Philo von Alexandrien"; " Einführung in die Ethik"; "Christ werden. Bekehrung und Wiedergeburt als Anfang des christlichen Lebens"; "Wirtschaft ohne Ethik"; "Christliche Ethik im Wandel der Systeme". Inhaltsverzeichnis
Vorwort 13
A. Vorfragen der Ethik: Was ist Ethik? 15 I Klärung ethischer Allgemeinbegriffe 15 1. Ethik 15 1.1 Herkunft und Definition des Begriffs Ethik 15 1.2 Der Begriff Ethik und die Sprache der Bibel 16 2. Moral 18 3. Recht 19 4. „Christliche" und „allgemeine" Ethik 20 II. Die Stellung der Ethik innerhalb der systematischen Theologie 21 1. Zur Geschichte des Problems 21 2. Tendenzen in der Bestimmung des Verhältnisses von Dogmatik und Ethik 24 3. Das Verhältnis von Dogmatik und Ethik in biblischer Sicht 25 III. Literatur zur Ethik 26 1. Lehrbücher der Ethik 26 2. Biblisch-exegetische Lehrbücher 29 3. Bücher speziell zu Grundfragen der Ethik 30 B. Entwürfe säkularer Ethik 31 I. Positivistische Ethik: Richtig handelt, wer geltendem Recht und anerkannter Sittlichkeit entsprechend handelt. 31 1. Darstellung des Ansatzes positivistischer Ethik 31 2. Kritik des Ansatzes positivistischer Ethik 32 2.1 Wahrheitsmomente positivistischer Ethik 32 2.2 Die Problematik positivistischer Ethik 33 II. Utilitaristische Ethik: Richtig handelt, wer nützlich handelt 34 1. Darstellung des Ansatzes utilitaristischer Ethik 34 1.1 Individualutilitarismus 34 1.2 Sozialutilitarismus 36 2. Kritik des Ansatzes utilitaristischer Ethik 37 2.1 Wahrheitsmomente utilitaristischer Ethik 37 2.2 Die Problematik utilitaristischer Ethik 37 III Naturrechtliche Ethik: Richtig handelt, wer der Natur entsprechend handelt 39 1. Darstellung des Ansatzes der naturrechtlichen Ethik 39 1.1 Der geschichtliche Hintergrund der Entstehung des Naturrechtsgedankens im Griechenland des 5. Jhs. v.Chr. 39 1.2 Die Entwicklung des Naturrechtsgedankens bei Plato 40 1.3 Die Weiterbildung des Naturrechtsgedankens bei Aristoteles 41 1.4 Der stoische Naturrechtsgedanke 41 1.5 Das Nachwirken des antiken Narurrechtsgedankens 42 2. Kritik des Ansatzes der Naturrechtsethik 43 2.1 Das Wahrheitsmoment der Naturrechtsethik 43 2.2 Die Problematik des Ansatzes der Naturrechtsethik 43 IV. Situationsethik: Richtig handelt, wer der Situation entsprechend handelt 44 1. Darstellung des Ansatzes der Situationsethik 44 1.1 Das Wesen des situationsethischen Ansatzes 44 1.2 Begründung des situationsethischen Ansatzes 45 1.2.1 Weltanschauliche Begründung 45 1.2.2 Anthropologische Begründung 45 1.3 Christliche Situationsethik 45 2. Kritik des situationsethischen Ansatzes 46 2.1 Wahrheitsmomente des situationsethischen Ansatzes 46 2.2 Die Problematik des situationsethischen Ansatzes 46 V. Zusammenfassender Rückblick 48 C. Theozentrische Ethik 49 Vorüberlegungen zur theozentrischen Ethik 49 1. Orientierung am Willen Gottes 49 2. Grundsätzlicher Widerspruch gegen den theozentrischen Ansatz in der Ethik 50 I. Geschichtstheologische Begründung der Ethik: Das Israel offenbarte Gesetz 53 1. Das Gesetz im Alten Testament 53 1.1 Der Begriff Gesetz 53 1.2 Die wichtigsten Inhalte des Gesetzes 54 1.3 Die heilsgeschichtliche Verwurzelung des mosaischen Gesetzes 56 1.4 Die sprachliche Struktur des Gesetzes 57 1.5 Folgerungen für das theologische Verständnis des Gesetzes 57 2. Das mosaische Gesetz im Zeugnis des Neuen Testaments 59 3. Das Gesetz in der Geschichte der christlichen Theologie 60 4. Grenzen der geschichtstheologischen Begründung der Ethik 61 II. Schöpfungstheologische Begründung der Ethik 62 1. Gesetz und Schöpfung 62 1.1 Der universale Horizont von Erwählung und Gesetz 62 1.2 Der vom Schöpfungsglauben her modifizierte biblische Naturrechtsgedanke 63 2. Die christliche Lehre vom Menschen: der Mensch als Ebenbild Gottes 66 2.1 Das biblische Zeugnis vom Wesen des Menschen als Gottes Ebenbild 66 2.2 Die Infragestellung der Gottebenbildlichkeit des Menschen in der Theologie 70 2.2.1 Die Infragestellung der Gottebenbildlichkeit des Menschen von der Erkenntnis seines Sünderseins her 70 2.2.2 Die Infragestellung der Gottebenbildlichkeit des Menschen von seiner Geschöpflichkeit her 72 2.3 Die Gottebenbildlichkeit des Menschen als Geschöpf Gottes und als Sünder 74 2.3.1 Die Gottebenbildlichkeit des Menschen als Geschöpf Gottes 74 2.3.2 Die Gottebenbildlichkeit des Menschen auch als Sünder 75 3. Phänomene des Menschlichen als erkennbarer Ausdruck der Gottebenbildlichkeit des Menschen 78 3.1 Das Gewissen als Ausdruck der personalen Verantwortlichkeit des Menschen vor Gott 78 3.1.1 Der Begriff des Gewissens 78 3.1.2 Psychologische Beschreibung der Funktion des Gewissens als schlechten Gewissens 80 3.1.3 Fehlformen des Gewissens 81 3.1.4 Das gute Gewissen 83 3.1.5 Herkunft und Wesen des Gewissens 84 3.2 Die Handlungsfreiheit des Menschen 86 3.3 Die Normgebundenheit des Menschen 90 4 Konsequenzen aus der christlichen Lehre vom Menschen für eine schöpfungstheologisch begründete Ethik 91 4.1 Das Menschsein des Menschen (hominitas) als Grundvoraussetzung allgemeiner Ethik 92 4.1.1 Konsequenzen aus dem christlichen Menschenbild für den Menschen als Handelnden (Subjekt der Ethik) 92 4.1.2 Konsequenzen aus dem christlichen Menschenbild für den Menschen als Gegenstand des Handelns (Objekt der Ethik) 94 4.2 Die Menschlichkeit des Menschen (humanitas) als Ziel allgemeiner Ethik 95 4.2.1 Humanität in der Dimension Mensch Kreatur 96 4.2.2 Humanität in der Dimension Mensch Mitmensch 98 4.2.3 Humanität in der Dimension Mensch Gott 99 4.2.4 Humanität und Selbstverwirklichung 99 5. Die bleibende Gültigkeit geschichtlich offenbarter und schöpfungstheologisch begründeter Normen 100 5.1 Die Veränderbarkeit schöpfungstheologisch begründeter Normen und ihre überzeitliche Gültigkeit 100 5.2 Die geschichtliche Bedingtheit des Gesetzes und seine bleibende Verbindlichkeit 103 6. Offene Fragen an die schöpfungstheologische und offenbarungstheologische Begründung der Ethik 105 6.1 Sünde und Erlösung 105 6.2 Gesetz und Geist 107 III. Eschatologische Begründung christlicher Ethik: die Herrschaft Gottes in Christus 108 1. Das biblische Zeugnis von der Herrschaft Gottes 111 1.1 Herrschaft Gottes nach dem Alten Testament 112 1.1.1 Exkurs: Die Erwartung des Reiches Gottes im Judentum der Zeit Jesu 114 1.2 Herrschaft Gottes nach dem Neuen Testament 115 1.2.1 Das noch ausstehende Reich Gottes 115 1.2.1.1 Das kommende Reich 115 1.2.1.2 Das himmlische Reich 116 1.2.2 Das gegenwärtige Reich Gottes 117 1.2.2.1 Das in Christus gegenwärtige Reich Gottes 117 1.2.2.2 Das im Leben des Jüngers gegenwärtige Reich Gottes 118 2. Das Christsein als individuelle Voraussetzung des Lebens unter der Herrschaft Gottes 120 2.1 Das Verhältnis von Indikativ und Imperativ in der ethischen Unterweisung der christlichen Gemeinde (Evangelium und Gesetz) 120 2.2 Das Christsein als bleibende Voraussetzung christlicher Ethik 121 3. Das Christwerden als individueller Beginn des Lebens unter der Herrschaft Gottes und die Schaffung des Subjekts christlicher Ethik 123 3.1 Bekehrung 123 3.2 Wiedergeburt 125 3.3 Neue Schöpfung 126 3.4 Glaube 128 3.5 Versöhnung, Rechtfertigung und Heiligung 129 3.6 Die Neuheit der christlichen Existenz (Zusammenfassung) 130 4. Christbleiben als Fortführung des Lebens unter der Herrschaft Gottes: die Heiligung 132 4.1 Das Wesen der Heiligung 133 4.2 Die Möglichkeit der Verwirklichung der Heiligung 136 4.2.0 Das Problem der Verwirklichung der Heiligung 136 4.2.1 Das optimistische Heiligungsverständnis 137 4.2.2 Das pessimistische Heiligungsverständnis 139 4.2.3 Das realistische Heiligungsverständnis: Leben im Geist 140 4.2.3.1 Heiligung als Gegenstand des Glaubens 140 4.2.3.2 Heiligung als Ziel des Glaubens 141 4.2.3.3 Wachstum in der Heiligung 144 4.2.4 Christbleiben durch ständig neue Umkehr (Buße und Beichte) 145 4.3 Die erkennrnismäßigen Voraussetzungen für ein Leben in der Heiligung: die Führung durch den Heiligen Geist 147 4.3.0 Führung durch Gott und Erkenntnis seines Willens 147 4.3.1 Das konstante Element in der Erkenntnis des Willens Gottes 151 4.3.1.1 Der in der Schrift ausgesprochene Wille Gottes (tertius usus legis) 151 4.3.1.2 Der im Vorbild erkennbare Wille Gottes 152 4.3.2 Das variable Element in der Erkenntnis des Willens Gottes 157 4.3.2.1 Führung durch Gott im Alten Testament 157 4.3.2.2 Geistesleitung im Neuen Testament 158 4.3.2.3 Einwände gegen die Lehre von der Geistesleitung 159 4.3.2.4 Zur praktischen Erfahrung der Geistesleitung 160 4.4 Das Ziel der Heiligung: Die drei Dimensionen der Heiligung 162 4.4.1 Das individuelle Ziel der Heiligung: die Liebe 162 4.4.2 Das soziale Ziel der Heiligung: Die christliche Gemeinde als Gestaltwerdung der Liebe Gottes unter den Menschen 163 4.4.2.1 Exkurs: Die Zwei-Reiche-Lehre 165 4.4.3 Das kosmische Ziel der Heiligung: die neue Welt Gottes 168 Abkürzungen 169 Stichwortregister 170 Namenregister 175 Bibelstellenregister 179 |
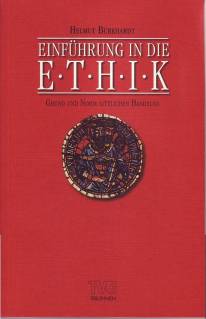
 Bei Amazon kaufen
Bei Amazon kaufen