|
|
|
Umschlagtext
Die Publikation zeichnet die Entwicklung der Verbindung von Nationalsozialismus und Katholizismus im Werk von Thomas Bernhard nach: von der Auseinandersetzung mit religiösen Motiven in der frühen Lyrik über die zentrale Rolle des nationalsozialistisch-katholischen Syndroms in den autobiographischen Schriften bis zur Auseinandersetzung damit im späten Roman Auslöschung. Im Mittelpunkt der Aufmerksamkeit steht dabei nicht so sehr eine skandalisierte oder skandalisierende Ineinssetzung der beiden Phänomene, wie sie häufig in der Rezeption wahrgenommen wurde. Der Fokus des Interesses liegt vielmehr auf Bernhards spezifisch literarischer Perspektive: auf seiner hohen ästhetischen Sensibilität für die existentielle Situation der mit Leiden und Tod konfrontierten Menschen. Auffallend ist, dass er geradezu leitmotivisch seine Auseinandersetzung mit dem Katholizismus mit dem Fortleben des Nationalsozialismus in der österreichischen Gesellschaft verbindet. Im Buch wird diese Verbindung mit dem Begriff eines ›Syndroms‹ zu erfassen versucht, der in Medizin, Psychologie sowie Sozialwissenschaften Anwendung findet. Dabei soll die nicht aufgelöste Ambivalenz eines vom katholischen Christentum geprägten und zugleich von seinem Versagen abgestoßenen Schriftstellers sichtbar gemacht werden.
Josef Mautner ist Literaturwissenschaftler und kath. Theologe. Er lebt in Salzburg. Publikationen u.a. zu den Themenbereichen Literatur und Religionen, Ästhetik der späten Moderne sowie zu Franz Kafka, Bertolt Brecht und Thomas Bernhard. Rezension
Kein Autor hat nach dem Zweiten Weltkrieg die österreichische Öffentlichkeit so sehr polarisiert und Literatur so in den Focus der Öffentlichkeit gerückt wie Thomas Bernhard, - und Österreich hat einige literarische "Provokateure" hervorgebracht: Ingeborg Bachmann, Ernst Jandl, Peter Handke, Elfriede Jelinek ... Der in den Niederlanden als uneheliches Kind geborene österreichische Schriftsteller (1931-1989) zählt zu den bedeutendsten deutschsprachigen Schriftstellern der zweiten Hälfte des 20. Jahrhunderts. Er beschäftigte sich zunächst wesentlich mit Lyrik, wechselte dann aber zu Prosa und Drama. Sein Grundgefühl, ungeborgen und ungeliebt zu sein, manifestierte sich auch in ungezügelter Kritik gegen den "katholisch-nationalsozialistischen" Staat Österreich. Wesentliche Teile seiner Kindheit verbringt er bei den Großeltern in Wien und nach Konflikten mit der wiederverheirateten Mutter in einem nationalsozialistischen Erziehungsheim. Den leiblichen Vater lernt er nie kennen, die Mutter verstirbt 1950 an Krebs. Also heißen Thomas Bernhards Werke entsprechend: hora mortis, Frost, Die Kälte, Verstörung oder Auslöschung. Bernhards Auseinandersetzung mit dem Katholizismus und mit dem Fortleben des Nationalsozialismus in der österreichischen Gesellschaft wird in diesem Buch mit dem Begriff eines ›Syndroms‹ zu erfassen versucht, der in Medizin, Psychologie sowie Sozialwissenschaften Anwendung findet. Dabei soll die nicht aufgelöste Ambivalenz eines vom katholischen Christentum geprägten und zugleich von seinem Versagen abgestoßenen Schriftstellers sichtbar gemacht werden.
Jens Walter, lehrerbibliothek.de Inhaltsverzeichnis
Statt einer Einleitung: Nationalsozialismus und Katholizismus - eine ästhetische Verunsicherung 7
Erstens: Die Verunsicherung des Wahrnehmens 13 Zweitens: Unsichere Identitäten 15 Drittens: Gegensatzkunst 18 Kapitel 1: Von der Gottesverzweiflung zur Wahrnehmung des Syndroms. Frühe Lyrik und Prosa. 25 Erstens: Gottesverzweiflung im Leiden — die frühe Lyrik 25 Zweitens: Einige Beobachtungen zur frühen Prosa und zum Roman Frost 35 Kapitel 2: Der „nationalsozialistisch-katholische Todesboden". Die autobiographischen Texte 49 Erstens: Zur Ästhetik der autobiographischen Inszenierung 52 Zweitens: Orte des nationalsozialistisch-katholischen Syndroms I — Internat und Schule 56 Drittens: Orte des nationalsozialistisch-katholischen Syndroms II — die Krankenanstalten 74 Kapitel 3: Auslöschen der Geschichte. Der Roman Auslöschung 83 Erstens: Zeitgeschichte als Resonanzraum: Zum (Un-)Verhältnis von Geschichte und Fiktion 86 Zweitens: „Ich fahre in die Hölle zurück". Wolfsegg als Ort der auslöschenden Erinnerung 91 Schlussbemerkungen 111 Erstens: Wie der Text die Wahrnehmung der Worte verändert 111 Zweitens: Offene Lektüre des Syndroms 112 Drittens: Zur Aktualität des nationalsozialistisch-katholischen Syndroms 115 Literatur 121 |
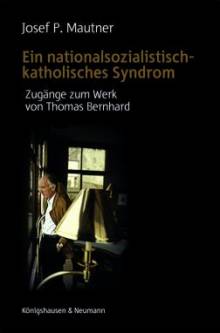
 Bei Amazon kaufen
Bei Amazon kaufen