|
|
|
Umschlagtext
Diktatur per Gesetz
Am 23. März beschloss der Deutsche Reichstag das Ermächtigungsgesetz, das einen Schlussstrich unter die Weimarer Verfassung zog. Es ermöglichte dem Reichskanzler Adolf Hitler, sich der Kontrolle des Parlaments zu entziehen. Auf der Basis des scheinlegalen Gesetzes konnte Hitler den Staat auf eine totalitäre Diktatur zuschneiden. Philipp Austermann zeigt, warum die Abgeordneten trotzdem mit großer Mehrheit für das Gesetz stimmten. Der Professor für Staatsrecht beschreibt eindrücklich die bedrohliche Atmosphäre auf den Straßen und im Parlament - aber auch den geringen Widerstand, den Hitlers Pläne im Reichstag erfuhren. Er erklärt, wie das Gesetz zustande kam, warum es scheinlegal war und welche Schlüsse nach 1945 daraus für das Grundgesetz gezogen wurden. Bis heute muss das Ermächtigungsgesetz als Mahnung dienen: Keine Demokratie ist unverletzlich. Rezension
Philipp Austermanns "Ein Tag im März" beleuchtet die Ereignisse rund um die Verabschiedung des Ermächtigungsgesetzes am 23. März 1933, das den Untergang der Weimarer Republik besiegelte, sich also in diesen Tagen zum 90. Male jährt. Philipp Austermann ist selbst studierter Jurist, arbeitete früher als Parlamentsbeamter und lehr heute Staats- und Europarecht. Das Buch eines echten Kenners und Fachmannes.
Nach einigen einleitenden Worten beleuchtet Austermann die Vorgeschichte der Entstehung des unheilvollen Ermächtigungsgesetzes und sodann die Abläufe an jenem verhängnisvollen 23. März 1933. Hierbei werden vor allem die verschiedenen politischen Akteure genauer unter die Lupe genommen. Die (berechtigte) Frage, ob denn das "Gesetz zur Behebung der Not von Volk und Reich", wie das Ermächtigungsgesetz im formellen Titel benannt wurde, tatsächlich verfassungskonform war und somit rechtens, wird im dritten Abschnitt aufgegriffen und diskutiert, bevor auf die tatsächlichen Wirkungen des Gesetzes und die historischen Lehren eingegangen wird. Fazit: Der Autor vermittelt dem Leser auf anschauliche Weise (also: keine Bedenken, man muss selbst kein Jurist sein, um dem Inhalt folgen zu können), wie dieser einschneidende historische Moment zustande kam und welche Auswirkungen er hatte. Besonders beeindruckend ist die Schilderung des Tages der Abstimmung über das Ermächtigungsgesetz selbst. Austermann erzählt die Ereignisse dieses Tages eindrucksvoll realitätsnah. Der Leser wird in die Atmosphäre des Reichstagsgebäudes versetzt und erlebt hautnah mit, wie die Nationalsozialisten das Gesetz durchsetzen und die Weimarer Republik endgültig ausgelöscht wird. Die Stärke des Buches liegt jedoch nicht nur in der Darstellung des historischen Moments selbst. Austermann bietet auch eine differenzierte Analyse der politischen Hintergründe und Kräfte, die zum Scheitern der Weimarer Republik führten. Er zeigt auf, wie die Schwäche und Fragmentierung der demokratischen Kräfte es den Nationalsozialisten ermöglichten, an die Macht zu kommen und wie das Ermächtigungsgesetz den Weg für Hitlers Diktatur ebnete. Auch die Rolle der einzelnen politischen Akteure - von Reichspräsident Hindenburg bis zu den Abgeordneten des Reichstags - wird von Austermann kritisch hinterfragt. Er veranschaulicht, wie ihre Entscheidungen und Handlungen den Lauf der Geschichte maßgeblich beeinflussten. Philipp Austermann schreibt flüssig und verständlich und bietet dem Leser eine facettenreiche Analyse der Ereignisse um das Ermächtigungsgesetz. "Ein Tag im März" ist ein informatives Buch, das jedem, der sich für deutsche Geschichte und Politik interessiert, bedenkenlos ans Herz gelegt werden kann. Dietmar Langusch, Lehrerbibliothek.de Verlagsinfo
1933: Diktatur per Gesetz Das am 23. März 1933 vom Reichstag beschlossene Ermächtigungsgesetz zog einen Schlussstrich unter die Weimarer Verfassung. Von den Nationalsozialisten selbst wurde es als wichtige Legitimationsgrundlage ihrer Herrschaft verstanden. Die Demokratie in Deutschland fand mit dem Gesetzesbeschluss ihr vorläufiges Ende. Der Staatsrechtler Philipp Austermann, der die Geschichte und die Rechtsgrundlagen des deutschen Parlamentarismus seit Jahren erforscht, erklärt anlässlich des 90. Jahrestages des Gesetzes, warum und wie es zustande kam, ob es überhaupt legal war, welche verfassungsrechtlichen und politischen Folgen es hatte und welche Schlüsse nach 1945 daraus für das Grundgesetz gezogen wurden. Philipp Austermann, Prof. Dr., Jahrgang 1978, Professor für Staats- und Europarecht am Zentralen Lehrbereich der Hochschule des Bundes für öffentliche Verwaltung, Brühl. Zuletzt erschien von ihm: „Der Weimarer Reichstag. Die schleichende Ausschaltung, Entmachtung und Zerstörung eines Parlaments“ (2020). Inhaltsverzeichnis
Einleitung 7
Die Vorgeschichte 11 1. Hitlers erstes Kabinett 11 2. Erste Maßnahmen zum Ausbau der Macht 19 3. Die Aushebelung des Rechtsstaats und des Föderalismus 25 4. Pläne zum Umbau der Staatsorganisation 29 5. Die Verhandlungen mit dem Zentrum 39 Ein Tag im März 53 1. Gespräche innerhalb der Zentrumsfraktion 53 2. Bedrohliche Sitzungsatmosphäre 56 3. Sitzung im Zeichen des Hakenkreuzes 59 4. Regierungserklärung: Versprechungen und Drohungen 60 5. Die interne Entscheidungsfindung der gemäßigten Parteien 64 6. Die Debatte 72 7. Die Abstimmung und ihre Folgen 78 8. Das weitere Schicksal der Versprechungen gegenüber dem Zentrum 80 Scheinlegale "Ermächtigung" 83 1. Die offizielle Legalitätsbehauptung 83 2. Das fehlerhafte Gesetzgebungsverfahren 87 3. Verfassungswidriger Inhalt? 91 Die tatsächlichen Wirkungen des Ermächtigungsgesetzes 95 1. Das Ende der Weimarer Verfassung 95 2. Scheinlegale Grundlage des Staatsumbaus 99 3. Due beruhigende Wirkung eines Gesetzes 104 Historische Lehren 109 Anhang 17 Chronologie der wichtigsten Ereignisse des Jahres 1933 119 Anmerkungen 121 Quellen und Literatur 143 Abbildungsnachweis 155 Über den Autor 157 |
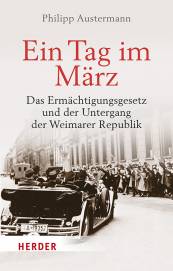
 Bei Amazon kaufen
Bei Amazon kaufen