|
|
|
Umschlagtext
Kirchen und Klöster, Taufkapellen und Grabdenkmäler aus dem 4. bis 8. Jahrhundert stehen im Zentrum dieser systematischen Beschreibung frühchristlicher Architekturformen. Ausgangspunkt für die Ausformung sakraler Räume ist dabei die liturgische Handlung selbst, weist Holtzinger überzeugend nach.
Viel mehr als moderne Fotografien es könnten, vermitteln die Architekturzeichnungen und Risse das Wesen von Struktur und Gestalt der frühchristlichen Architektur. So kann man das Werk auch heute noch als Standardwerk zur altchristlichen Architektur bezeichnen. Rezension
Dieses Buch ist zwar seit seinem Ersterscheinen 1889 mehr als 120 Jahre alt, ist aber noch immer qualitativ hochwertig und beschreibt die altchristliche Architektur noch immer äußerst kompetent und so umfassend und zutreffend, dass es nun als Nachdruck der Originalausgabe Stuttgart 1889 abermals im "reprint Verlag Leipzig" der Wissenschaftlichen Buchgesellschaft Darmstadt aufgelegt wird. Derlei widerfährt einem wissenschaftlichen Buch nur äußerst selten und zeigt die hohe Qualität des Inhalts an, der sich insbesondere der Architektur der frühchristlichen Kirchen zuwendet (1. Buch), Langbau und Zentralbau unterscheidet, die altchristlichen Baptisterien mit einbezieht (2. Buch) und abschließend (3. Buch) die altchristlichen Sepulcral- und Memorialbauten thematisiert.
Thomas Bernhard, lehrerbibliothek.de Verlagsinfo
reprint Verlag Leipzig WBG-Preis EUR 24,90 Buchhandelspreis EUR 29,90 Kirchen und Klöster, Taufkapellen und Grabdenkmäler aus dem 4. bis 8. Jahrhundert stehen im Zentrum dieser systematischen Beschreibung frühchristlicher Architekturformen. Ausgangspunkt für die Ausformung sakraler Räume ist dabei die liturgische Handlung selbst, weist, Holtzinger nach. Dank zahlreicher Abbildungen erschließt sich dem Leser der Zusammenhang von liturgischem Wesen und Struktur sowie äußerer Gestalt des Sakralraums auf höchst genussvolle Weise. Heinrich Holtzinger stellt den zahlreichen kunsthistorischen Betrachtungen zur Architekturgeschichte seine systematische Betrachtung an die Seite. Historisch grenzt er seinen Forschungsgegenstand auf den Zeitraum zwischen 300 und 800 n. Chr. ein. Noch heute ist es faszinierend zu lesen, wie es Holtzinger gelingt, aus den Anforderungen des Gottesdienstes die Funktionen der Gebäudeteile abzuleiten und daraus die architektonische Gestalt der Bauten selbst zu interpretieren. Vom ersten Moment an, da die gottesdienstliche Handlung aus dem Privatraum heraustrat und nach besonderen Gebäuden verlangte, aus denen sich das Langhaus entwickelte, das schließlich zur Basilika wurde, folgt die Form dem liturgischen Inhalt. Viele spezielle Formprobleme – beispielsweise das Atrium, die Apsis, die Türgestaltungen oder die Lösung des Lichtproblems in der Basilika – erklärt Holtzinger aus den Bedürfnissen der liturgischen Handlungen. Überzeugend wie der Text sind auch die zahlreichen Abbildungen: Viel mehr, als moderne Fotografien es könnten, vermitteln die Architekturzeichnungen und Risse das Wesen von Struktur und Gestalt der frühchristlichen Architektur. Das macht Holtzingers Buch nicht nur zu einem Standardwerk systematischer Architekturbeschreibung, sondern auch zu einem bibliophilen Ereignis für heutige Leser. Autorenporträt: Der Kunsthistoriker Heinrich Holtzinger (1856–1940) studierte in Bonn, Leipzig und Tübingen und wurde 1879 promoviert. Bis 1880 war er am Deutschen Archäologischen Institut in Rom und Athen tätig. 1883 wurde er Privatdozent, 1889 ordentlicher Professor in Tübingen und wechselte 1891 nach Hannover. Neben der »Altchristlichen Architektur« von 1889 gehört »Altchristliche und Byzantinische Architektur« von 1899 zu seinen Hauptwerken. Inhaltsverzeichnis
Einleitung.
I. Umfang und Inhalt der altchristlichen Architektur. 1-2 § 1-3 II. Grundbedingungen der Form in der altchristlichen Architektur. A. Kirchen im eigentlichen Sinne. § 4. Longitudinalbauten; ihr Vorzug vor den Centralbauten 2 § 5. Einfachfte Form der Langbauten 3 § 6. Weiterbildung des Longitudinalbaues vom einfachen Oblongum zur basilikalen Anlage 3 B. Baptisterien, Mausoleen und Denkmalkirchen 4 § 7 4 Erstes Buch. Die altchristlichen Kirchen. Erster Abschnitt. Lage und Orientirung der Kirchen. § 8. Die Lage der Kirchen 5 § 9. Die Orientirung der Kirchen 6 Zweiter Abschnitt. Peribolos, Atrium und Narthex. § 10. Der Peribolos 9 § ii. Das Atrium. Name, Ursprung und Form 11 § 12. Der Brunnen im Atrium 14 § 13. Der Eingang zum Atrium und Peribolos. Die Propyläen 19 § 14. Beifpiele altchriftlicher Atrien 23 § 15. Die Vorhalle (Narthex) 27 Dritter Abschnitt. Der Hauptbau. A. Basiliken (Longitudinattauten). Erste Abtheilung. Das Langhaus. Capitel I. Allgemeine Anlage. Proportionen. § 16. Anlage 30 § 17. Proportionen 31 Capitel II. Gliederung des Grundrisses. § 18. 31 Capitel III. Querschnitt. § 19. Ueberhöhung des Mittelfchiffes 34 § 20. Emporen 35 Capitel IV. Einzelglieder des Aufbaues. § 21. Deckenfüitzen 38 § 22. Pfeiler 38 § 23. Stützenwechfel 39 § 24. Säulen (Allgemeines) 41 § 25. Säulenordnungen 42 § 26. Säulenbafen 43 § 27. Säulenfchafte 44 § 28. Säulenkapitelle 45 § 29. Kämpfer 46 § 30. Säulengebälk 48 § 31. Arkaden 49 S 32. Decke 52 §33. Dachftuhl 54 S 34. Dach 55 § 35. Eingänge 56 S 36. Fenfter 65 Zweite Abtheilung. Das Presbyterium. Capitel I. Allgemeine Form und Namen. § 37. Form 72 § 38. Namen 73 Capitel II. Abweichende Apsidenbildungen. § 39. Rechtwinkelige und polygon ummantelte Apfiden 77 § 40. Durchbrochene Apfiden 78 § 41. Apsis trichora 81 Capitel III. Fensteranlage in der Apsis. § 42. 82 Capitel IV. Weiterbildungen des Presbyteriums (Querschiff. Prothesis. Diakonikon). § 43. Der Altardienft in feiner Bedeutung für die Raumgestaltung des Presbyteriums 83 § 44. Das Querschiff 86 § 45. Prothefis und Diakonikon 90 B. Centrale Kirchenanlagen. § 46. Allgemeines 94 § 47. Ungegliederte Centralkirchen 95 5 48. Gegliederte Centralkirchen 96 Vierter Abschnitt. Immobile Utensilien im Innern der Kirchen. Capitel I. Der Altar. A. Der Tischaltar der ältesten Zeit. § 49. Die Form im Allgemeinen 114 § 50. Material 114 § 51. Einzelheiten der Form 116 B. Der Altar in Verbindung mit dem Reliquiencultus. § 52. Allgemeines 120 § 53. Stellung des Altars über der Confeffio 120 § 54. Form und Entwickelung der Confeffio 120 § 55. Die Confeffio im Altar 121 Anhang zu § 52—55. Belege aus der Tradition und den Monumenten 122 § 56. Nebenaltare 133 Capitel II. Das Ciborium. § 57. Name und Ursprung 133 § 58. Die Form im Allgemeinen 134 § 59. Material 135 § 60. Einzelheiten der Form und Beifpiele 135 § 61. Lampen und Vorhänge am Ciborium 146 Capitel III. Die Presbyteriumsschranken. § 62. Urfprung 148 § 63. Namen 148 § 64. Material 149 § 65. Form 150 Capitel IV. Die Säulenstellung vor dem Presbyteriutn. Ikonostasis. § 66. Beftimmung 153 § 67. Form 154 Capitel V. Cathedra und Subsellien. § 68. Ort und Beftimmung 162 § 69. Namen 163 § 70. Form und Material 163 Capitel VI. Der Ambon. § 71. Name und Beftimmung 169 § 72. Stellung 171 § 73. Soleas 171 § 74. Form des Ambon 172 Fünfter Abschnitt. Die Platzabtheilungen in der Kirche. § 75. Bedeutung 175 § 76. Art und Weife der Abtheilungen 175 5 77. Geftühl 177 § 78. Chorus 178 Sechster Abschnitt. Die Dekoration im Innern der Kirchen. § 79. Das Paviment 179 § 80. Wände und Wölbungen. Allgemeines. Technik 183 § 81. Gegenftände an den Langhauswänden 186 5 82. Gegenftände am Triumphbogen 187 § 83. Gegenftände in der Apfis 189 § 84. Vorhänge 194 Siebenter Abschnitt. Künstliche Beleuchtung. § 85. 195 Achter Abschnitt. Das Aeussere der Kirchen. § 86 196 Neunter Abschnitt. Anbauten und Nebengebäude. § 87. Cubicula 202 § 88. Thürme 203 § 89. Kirchliche Nebengebäude: Xenodochia, Armenhäufer, Schulen, Bäder, Monasteria u. a. 205 Zweites Buch. Die altchristlichen Baptisterien. § 90. Beftimmung und Namen 212 § 91. Die Form der Baptifterien 213 S 92. Die Piscina 217 § 93. Die Ausfchmückung der Baptifterien 222 § 94. Anbauten am Baptisterium 223 Drittes Buch. Die altchristlichen Sepulcral- und Memorialbauten. § 95. Allgemeines 225 Erster Abschnitt. Die unterirdischen Sepulcralanlagen. § 96. Allgemeines 225 Capitel I. Die Katakomben. § 97. Anlage der Katakomben. 226 § 98. Die Ausftattung der Katakomben 232 a. Die malerifche Dekoration 232 b. Immobile Utenfilien 236 Capitel II. Unterirdische Einzelgräber. § 99 237 Capitel III. Gräber in der Erdoberfläche. § 100. Allgemeines 238 § 101. Anlage und Form der Gräber 238 Zweiter Abschnitt. Die oberirdischen Sepulcralbauten. Capitel I. Die Gesammtanlage oberirdischer Cömeterien. § 102 241 Capitel II. Freistehende Gräber und ihr Schmuck. § 103 242 Capitel III. Mausoleen. § 104. Namen der Maufoleen 243 § 105. Form der Maufoleen 246 Capitel IV. Andere Cömeterialbauten sub dio. § 106. Cömeterialbafiliken 252 § 107. Portiken und Eingangshallen 255 Capitel V. Memorialbauten. § 108 256 Anhang I. Zu Seite 174. Paulus Silentiarius, Descriptio ambonis s. Sophiae 258 Anhang II. Zu Seite 185. S. Nilus Abbas, Epist. IV, 61 265 Anhang III. Zu Seite 186. Paulinus Nolanus, Poem. XXVII, v. 511 ff 266 Anhang IV. Zu Seite 195. Paulus Silentiarius, Descriptio s. Sophiae, V. 806 ff 270 Zusätze und Berichtigungen 274 Sachregister 276 Quellenregister 278 Ortsregister 281 |
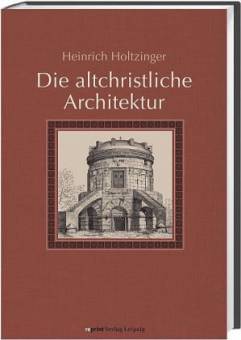
 Bei Amazon kaufen
Bei Amazon kaufen