|
|
|
Umschlagtext
Viktor Frankls sinnorientierte Psychotherapie gewinnt weiterhin an Interesse und Bedeutung. Werk wie Person Frankls sind jedoch nicht unumstritten. Mutig und erhellend packt die Autorin auch heiße Eisen an. Neben den klinischen und philosophischen Aspekten der Logotherapie, ihrer Entstehung und ihrer Weiterentwicklung in den divergierenden Schülergenerationen bearbeitet sie auch das umstrittene Thema von Logotherapie und Religion kritisch und fachkundig und entwirft ein alternatives, kirchenunabhängiges Gottes-und Religionskonzept. Die Autorin, eine der frühesten und genauesten Kennerinnen der Logotherapie, bietet eine sorgfältige, informativ-spannende Lektüre für Fachinteressenten und Laien.
Rezension
Der Wiener Psychiater und Psychotherapeut Victor Emil Frankl (1905 -1997) hat, wie die Verfasserin betont, das gesamte 20. Jhdt. begleitet und Spuren hinterlassen, ab 1955 als Professor in Wien, ab 1970 auch in San Diego. Er ist der Begründer der Existenzanalyse und der auf ihr basierenden Logotherapie. V. Frankl geht in der Geschichte der Existenz eines Individuums dem Willen zum Sinn (Logos) nach und ergänzt damit die anderen Wiener Psychoanalytiker („Wiener Schule“) mit ihrer Betonung des Willens zur Lust (S. Freud) und des Willens zur Macht (A. Adler); denn jeder Mensch hat ein Sinngebungsbedürfnis, dessen Frustration nach Frankl zur Entstehung von Neurosen führt. Von daher kommen Religion bzw. Religiosität in diesem Ansatz besondere Bedeutung zu, die die Verfasserin im abschließenden 4. Kapitel (Logotherapie und Religion) eigens ausführlich thematisiert. Es kommt mithin darauf an, dass jeder Klient seinen Daseinssinn selbst findet, dazu hilft auch das Akzeptieren von Unvollkommenheiten und Leiden. – Dieses Buch führt umfassend, sachlich, tiefgründig und sprachlich gut verständlich in das Werk V. E. Frankls ein. Allein ein Register wäre noch hilfreich gewesen.
Jens Walter, lehrerbibliothek.de Verlagsinfo
Eine umfassende, kritische und systematische Gesamtdarstellung und Auseinandersetzung mit Viktor Frankls Werk. Erstmals wird seine vehemente Abwertung der Tiefenpsychologie zugunsten der logotherapeutischen Höhenpsychologie in Zusammenhang gebracht mit der persönlichen Scheu vor kritischer Selbstreflexion. Neben den klinischen und philosophischen Aspekten der Logotherapie bearbeitet die Autorin auch das umstrittene Thema von Logotherapie und Religion. Hedwig Raskob ist eine anerkennte Expertin, die Stärken und Schwächen der Logotherapie für Fachleute und Laien nachvollziehbar darstellt. Geschrieben für: Psychotherapeuten, Psychologen, Psychiater, Allgemeinärzte, Lehrer, Religionslehrer, Pfarrer, Erzieher, Laien Schlagworte: Existenz Logos Neurosenlehre Religion Sinnsuche Ärztliche Seelsorge Inhaltsverzeichnis
Abkürzungsverzeichnis XVI
Einführung 1 I Zur Geschichte der Logotherapie und Existenzanalyse 1 Zur Entstehung der Logotherapie und Existenzanalyse 13 1.1 Das Wiener Klima 13 1.2 Der Kontakt zu Freud und der Bruch mit der Psychoanalyse 16 1.3 Der Kontakt zu Adler und der Individualpsychologie 18 1.3.1 Der Bruch mit Adler 1927 19 1.3.2 Heutige Kritik der Adlerianer an Frankl 22 1.4 Psychologismus-Kritik und Entstehung der Logotherapie 26 1.5 Frankls eigene philosophische Orientierung 29 1.6 Frankls soziales Engagement und die Zeit der Gestation 31 1.7 Die Geburt der Logotherapie 32 1.7.1 Der Aufsatz von 1938: „Zur geistigen Problematik der Psychotherapie" 33 1.7.2 Der Aufsatz von 1939: „Philosophie und Psychotherapie" 37 1.7.3 Begriffsbildung in Anlehnung an die Psychoanalyse 39 Exkurs - „Logotherapie": Wer hatte den Begriff zuerst, Frankl oder Viktor von Weizsäcker? 40 Exkurs - „Existenzanalyse": Was heißt hier Existenz? Was heißt hier Analyse? 41 1.8 Frankls ärztliche Praxis, die Kinderstube der Logotherapie 42 Exkurs - Zu Frankls Experimenten 43 1.9 Experimentum crucis (KZ-Erfahrungen) 44 1.10 Gestaltwerdung 48 1.11 Die Werke Frankls - und die fünf Aspekte der Logotherapie 49 2 Zur Entwicklung der Logo therapie und Existenzanalyse 53 2.1 Schulebildung und Institutionalisierung 53 2.2 Erste gescheiterte Versuche der Institutionalisierung 55 2.3 Das Schicksal der Logotherapie bis zu den 70er Jahren 56 2.3.1 ... im deutschsprachigen Raum 56 2.3.2 ... in den USA 61 2.3.3 ... feste Etablierung der Logotherapie in den USA 66 2.3.4 ... weltweit (zeitlich offen) 71 2.4 Etablierung der Logotherapie im deutschsprachigen Raum (ab den 80erJahren) 73 2.4.1 Elisabeth Lukas (Süddeutsches Institut) 75 2.4.2 Uwe Böschemeyer (Hamburger Institut) 78 2.4.3 Günter Funke (Berliner Institut) 79 2.4.4 Walter Böckmann (Logotherapie und Arbeitswelt) 80 2.4.5 Wolfram Kurz (Religions-Pädagogik) 81 2.4.6 Karl-Dieter Heines (für die Medizin und die DGL/DGLE) 84 2.4.7 Alfried Längle (Gesellschaft für Logotherapie und Existenzanalyse, Wien. GLE) 87 2.4.8 Frankl distanziert sich von Längle und der GLE 91 2.4.9 Das Viktor-Frankl-Institut (Vesely, Wien) 94 3 Zur Tragik Frankls: die Verschattungen 97 3.1 Frankls problematisches Verhältnis zur Psychoanalyse 97 3.1.1 Das „Entlarven", Zielscheibe seiner Kritik 99 3.1.2 Das Thema Selbstwert bei Frankl 101 3.1.3 Die „Hölle" für Frankl im psychoanalytischen Wien 104 3.1.4 Frankls Psychoanalyse-Kritik teilweise berechtigt 107 3.2 Die Auswirkung der persönlichen Verschattungen auf das Werk 109 3.2.1 Selbst-Transzendenz als Selbstschutz 111 3.2.2 Die Rechnung geht nicht auf 112 Exkurs - Das Leben verlangt die rechte Ordnung und drängt auf Heilung (aus der Therapieform des Familienstellens nach B. Hellinger) 115 3.2.3 Zur aktuellen Diskussion um Selbsterfahrung 117 3.3 Wie könnte die Tragik Frankls zu verstehen sein? 118 4 Weitere Elemente zur Geschichte der Logotherapie und Frankl 121 4.1 Zur biographisch-chronologischen Entwicklung 121 4.2 Öffentliche Ehrungen Frankls 122 4.3 Einordnung der Logo therapie in der Fachwelt 124 II Die philosophisch-anthropologischen Grundlagen der Logotherapie und Existenzanalyse Vorbemerkung 129 5 Der Mensch in seiner geistig-existentiellen Verfasstheit: Anthropologische Strukturfragen 131 5.1 Intention und Anspruch 131 5.2 Die dimensional-ontologische Konzeption 133 5.2.1 Das Modell selbst 133 5.2.2 Differenzierungen in den Verhältnisbestimmungen 134 5.3 Macht und Ohnmacht des Geistes 136 5.3.1 Die Unableitbarkeit und Unzerstörbarkeit des Geistes 139 5.3.2 Unbewusste Geistigkeit 140 5.4 Die medizingeschichtliche Bedeutung des Modells 143 5.5 Geschichtliche Anmerkung zu Frankls Rede vom Geist 146 5.5.1 Geist, ein korrelativer Begriff 148 5.5.2 Der Geist, das jeweils Höchste der Rangordnung 148 5.5.3 Der Geist bestimmt den Menschen, nicht umgekehrt 149 5.5.4 Vernunft mehr als logische Vernunft 149 5.5.5 Objektiver Geist 150 5.5.6 Namensänderung in der Moderne: Existenz statt Geist 150 6 Der Mensch als Sinnsuchender 153 6.1 Der Wille zum Sinn, fundamentales anthropologisches Datum 153 6.2 Motivationsansatz - im Vergleich zu Freud und Adler 156 6.3 Der bedingungslose Glaube an den unbedingten Sinn 157 6.4 Die Freiheit als Voraussetzung der persönlichen Sinnfindung 159 6.4.1 Zu den biologischen Bedingungen 160 6.4.2 Zu den psychologischen Bedingungen 160 6.4.3 Zu den soziologischen Bedingungen 161 6.5 Verantwortung für die persönliche Sinnerfüllung 161 6.6 Transzendentale und intentionale Verwiesenheit 162 6.6.1 Intentionalität 164 6.6.2 Transzendenz 166 7 Der objektive Logos und die subjektive Sinnfindung 169 7.1 Wertkategorien und Sinn-Universalien 170 7.1.1 Die drei Wertkategorien 17l 7.1.2 Sinn-Universalien 173 7.1.3 Frankls Logos und die Antike 174 7.2 Die Frage nach dem Sinn des Lebens 175 7.2.1 Inhaltliche Offenheit der Sinnfrage 175 7.2.2 Die Frage nach dem „Sinn des Ganzen" 176 7.2.3 Sinn ist person- und situationsbezogen 178 7.2.4 Sinnfmdung statt Sinngebung 179 7.3 Das Gewissen 180 7.3.1 ... als Sinnfindungsorgan 180 7.3.2 ... mit Über-Ich-Qualitäten? 182 7.3.3 ... als Stimme der Transzendenz 183 7.3.4 ... als menschliches in seiner Fehlbarkeit 184 III Die logotherapeutische Neurosenlehre und „Ärztliche Seelsorge" 8 Aufriss der logotherapeutischen Neurosenlehre 189 8.1 Klinische und paraklinische Neurosen 190 8.2 Echte Neurosen und Pseudoneurosen 191 8.2.1 Medizingeschichtlicher Zweck der Unterscheidung 191 8.2.2 Die Unterscheidung aufgrund der Ursachenbereiche 192 8.2.3 Unterscheidung und Gesamtschau 193 8.3 Einführung in den Begriff der reaktiven Neurosen 194 8.3.1 Hauptgruppe der neurotischen Reaktionsmuster 195 8.3.2 Zufällig veranlasste neurotische Reaktionen 195 8.3.2.1 Zur jatrogenen Erwartungsangst 196 8.3.2.2 Zur bibliogenen Erwartungsangst 197 8.4 Logotherapie bei Psychosen 198 8.4.1 Existenzanalytische Grundauffassung 199 8.4.2 Logotherapeutisches Therapieziel 199 8.5 Frankl und die psychosomatische Medizin 200 9 Die somatogenen Pseudoneurosen 203 9.1 Basedowoide Pseudoneurosen 204 9.2 Addisonoide Pseudoneurosen 204 9.3 Tetanoide Pseudoneurosen 205 9.4 Andere somalische Bedingungen für psychische Symptome 206 9.5 Zum Gefalle: Somatogenese - Psychogenese 207 10 Die psychogenen Neurosen: Grundsätzliches 209 10.1 Frankls Relativierung der Psychogenese 209 10.1.1 Seelische Belastungen als solche nicht krank machend 209 10.1.2 Seelische Belastungen sind universal 210 10.1.3 „Unlösbare" Konflikte nicht Ursache, sondern Symptom 210 10.1.4 Belastung kann gesundheitsfördernd sein 211 10.2 Entstehungsbedingungen psychogener Neurosen 212 10.2.1 Konstitutionelle und organische Faktoren 213 10.2.1.1 Konstitution, generell disponierend 213 10.2.1.2 Organisches, unmittelbar disponierend 214 10.2.2 Psychische Faktoren 215 10.2.2.1 Frühe Traumata, generell disponierend (ergänzend zur Frankl'sehen Sicht) 215 10.2.2.2 Andere psychische Erlebnisse, unmittelbar disponierend 216 10.2.2.3 Erwartungsangst und Fehlreaktionen als eigentliche Entstehungs momente 217 10.2.2.4 Der neurotische Zirkelschluss 217 10.2.3 Soziale Faktoren 217 10.2.3.1 Die Bedingungen der Gesellschaft 217 10.2.3.2 „Krankheit der Zeit" als disponierend 218 10.2.3.3 Krankheitsgewinn als fixierend 219 10.2.4 Geistig-existentielle Faktoren 219 10.2.4.1 Existentieller Hintergrund 219 10.2.4.2 Das „existentielle Vakuum" und die existentielle Frustration 220 11 Psychogene Neurosen: die Hauptformen Angst und Zwang 221 11.1 Angstneurotisches Reaktionsmuster 222 11.1.1 Existentieller Hintergrund 222 11.1.2 Die konstitutionelle Grundlage 223 11.1.3 Unmittelbar disponierende Momente 223 11.1.4 Das angstneurotische Geschehen 223 11.1.5 Zur Phobienbildung 224 11.1.6 Therapeutische Ansätze 224 11.1.7 Aus der Kasuistik 225 11.2 Zwangsneurotisches Reaktionsmuster 227 11.2.1 Existentieller Hintergrund 227 11.2.2 Die konstitutionelle Grundlage 228 11.2.3 Unmittelbar disponierende Momente 228 11.2.4 Das zwangsneurotische Geschehen 229 11.2.5 Zur Phobienbildung 229 11.2.6 Therapeutische Ansätze 230 11.2.7 Aus der Kasuistik 232 12 Psychogene Neurosen: Sexualneurotische und sonstige neurotische Störungen 233 12.1 Existentieller Hintergrund 233 12.2 Zur konstitutionellen Grundlage 233 12.3 Unmittelbar disponierende Momente 234 12.4 Das sexualneurotische Geschehen 234 12.5 Therapeutische Ansätze 236 12.6 Aus der Kasuistik 237 12.7 Sonstige neurotische Funktionsstörungen 239 12.8 Sonstige Neuroseformen: Organneurosen und Hysterien 240 13 Die noogenen Neurosen 243 13.1 Einführung und Grundsätzliches 243 13.2 Definition der noogenen Neurose 246 13.3 Abgrenzungen und Unterscheidungen 246 13.4 Zur medizingeschichtlichen Bedeutung der noogenen Neurose 254 13.5 Kasuistik 256 13.5.1 Existentielle Angstneurose 256 13.5.2 Noogene Karzinophobie 257 13.5.3 Logotherapeutische Traumdeutung 258 13.5.4 Ein existenzanalytisch-logotherapeutischer Traum 259 13.5.5 Ergänzende logotherapeutische Behandlung 260 13.5.6 Existenzanalytische Behandlung religiöser Probleme 260 13.5.7 Existentielle Frustration. Tiefgreifende Sinnkrise 264 14 Behandlungsformen: Paradoxe Intention und Dereflexion 267 14.1 Zu den Indikationsgebieten von Paradoxer Intention und Dereflexion 267 14.2 Darstellung der Paradoxen Intention 269 14.2.1 Kernstück 270 14.2.2 Humor und Eigeninitiative 272 14.2.3 Medikamentöse Begleitbehandlung 273 14.2.4 Phase der Aufklärung 273 14.2.5 Herstellung der Vertrauensbasis 274 14.2.6 Durcharbeitung der Widerstände und der Konfliktlage 275 14.2.7 Begleitende Betreuung 275 14.2.8 Zum persönlichen Einsatz des Therapeuten 276 14.3 Theorien zur Wirksamkeit der Paradoxen Intention 277 14.3.1 Durchbrechung der neurotischen Reaktionsmuster 277 14.3.2 Zur Bedeutung des Humors und der Eigenverantwortlichkeit 278 14.3.3 Umstellung der Einstellung 278 14.3.4 Aus der Sicht der Verhaltenstherapie 281 14.3.5 Aus der Sicht der Psychoanalyse 283 14.3.6 Die Paradoxe Intention als Suggestion und Persuasion 283 14.3.7 Michael Ascher und die Paradoxe Intention 284 14.3.8 Zum Begriff „Paradoxe Intervention" 286 14.4 Darstellung der Dereflexion 286 14.5 Theorien zur Wirksamkeit der Dereflexion 290 14.5.1 Intentionalität menschlicher Akte und Selbst-Transzendenz 290 14.5.2 Vertrauen zum Unbewussten 291 15 Weitere Behandlungsformen und -prinzipien 293 15.1 Frankls Gebrauch „fremder" Methoden und Techniken 293 15.2 Frankls Improvisieren und Individualisieren 294 15.3 Hilfe zur Sinnfmdung (Frankl) 298 15.4 Methodische Weiterentwicklung (nach der Zeit Frankls) 300 15.5 Umgang mit religiösen Fragen in der logotherapeutischen Praxis 306 15.5.1 ... bei Frankl 306 15.5.2 ... nach der Zeit Frankls 308 15.5.3 Ein Beispiel 309 15.5.4 Weitere unterschiedliche Positionen 312 15.5.5 Weiterentwicklungsbedarf im Umgang mit religiösen Fragen 314 15.6 Abschließend 317 16 Ärztliche Seelsorge 319 16.1 Verschiedene Bedeutungen des Begriffs 319 16.1.1 Ärztliche Seelsorge im weiteren Sinne 319 16.1.2 Ärztliche Seelsorge im engeren Sinne 320 16.2 Verpflichtung und Berechtigung des Arztes 322 16.2.1 Frankls Argumente zur Legitimation 322 16.2.2 Eingrenzung der ärztlichen „Verpflichtung" 323 16.3 Grundlagen für die Konzeption der ärztlichen Seelsorge 323 16.3.1 Glaube an die unbedingte Sinnhaftigkeit 323 16.3.2 Anerkennung der medizinischen Grenze 324 16.3.3 Keine Flucht vor der Wirklichkeit 325 16.4 Inhalt und Ziel der ärztlichen Seelsorge 325 16.4.1 Möglichkeit äußerster Sinnerfüllung 325 16.4.2 Leidensfähigkeit und Aussöhnung mit dem Schicksal 326 16.4.3 Theodizee - Pathodizee 326 16.4.4 Wachsen und Reifen durch Leiden 328 16.4.5 Weg der Sinnfmdung im Schicksal 329 16.5 Zur Sinnfmdung im Leid als höchster und letzter Sinnerfüllung 330 16.5.1 Zwischen Sinnlosigkeit und falscher Leidensmystik 330 16.5.2 Beispiele aus dem Leben 334 16.6 Frankls Anmerkungen zum Sinn von Vergänglichkeit und Tod 337 16.7 Zusammenfassend 337 IV Logotherapie und Religion Einführung und Problemstellung 341 17 Die religiöse Dimension menschlicher Existenz nach Frankl 345 17.1 Die Verankerung des Religiösen im System der Logotherapie 345 17.2 Frankls Argumente für die Einbeziehung der religiösen Frage 347 17.3 Frankls Abgrenzungs-und Abwehrmanöver 350 17.4 Reaktionen zu Frankls religiöser Position 354 18 Frankls Religionsverständnis 357 18.1 Über-Ich-geprägt 358 18.2 Kategorial 365 Exkurs - Das transkategoriale Religionsverständnis 365 18.3 Ein konventionelles Religionsverständnis 366 18.4 Frankls Religionsverständnis, Zusammenfassung 367 18.5 Bedingungen und Begriffsklärungen für die alternative Perspektive 369 19 Skizze der historischen Religionskritik 373 19.1 Alte Welt 374 19.2 Neuzeit/Aufklärung 375 19.3 Moderne/20. Jahrhundert 379 19.4 20. Jahrhundert/Postmoderne 380 19.5 Postsäkulare Gesellschaft/Jetztzeit 382 19.5.1 Zur nachchristlichen Religiosität 383 19.5.2 Das neue Interesse an Religion in der Psychotherapie 386 19.6 Zusammenfassend zur Religionskritik 390 20 Alternative (l): Ein universelles Gottesverständnis 393 20.1 Die falsche Alternative: Gott oder der Mensch 393 20.2 Die Kongenialität von Gott und Mensch im kosmischen Verständnis 394 20.2.1 Als Sein und Seiendes: Urgrund und Gewordenes 394 20.2.2 Mythisch-mystisch gesehen 395 20.2.3 In der Philosophie und Theologie 397 20.3 Besprechung theologischer und psychologischer Konsequenzen 399 20.3.1 Therapeutische Gesichtspunkte 404 20.3.2 Theologische Rückfragen 406 21 Alternative (2): Ein individualisiertes Religionsverständnis 411 21.1 Brisanz der Gottfrage als solcher 413 21.2 Institutionelle Bedenken 416 21.3 Gottesbilder wandeln sich 420 21.4 Kritische Fragen und theologische Argumente 422 21.5 Gewissen und Ebenbildlichkeit Gottes 423 21.6 Mystik und das individualisierte Gottesverhältnis 425 21.7 Abschließend: Logotherapie und Religion 430 Schlusswort 433 Dank 434 Literatur 435 |
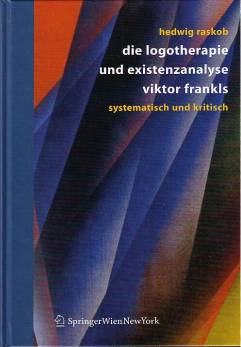
 Bei Amazon kaufen
Bei Amazon kaufen