|
|
|
Umschlagtext
Über alle Veränderungen der Zeiten und kulturellen Unterschiede hinweg gilt, daß der Gottesdienst der Kirche nur als Antwort des Dienstes, den der dreifaltige Gott ihr erwiesen hat und immer wieder erweist, möglich ist. Gottesdienst ist zuallererst der Dienst Gottes an der Kirche, sein Werk für die vielen Schwestern und Brüder seines Sohnes; dann erst ist die Liturgie der Kirche als Antwort auf Gottes Handeln möglich. Der Gedanke von der lebenschaffenden, ja vergöttlichenden Kommunikation zwischen Gott und Mensch zieht sich wie ein Leitfaden durch das gesamte Werk. Der erste Teil handelt vom Herabstieg Gottes zum Menschen, von der katabatischen Dimension des Gottesdienstes als Einladung an den Menschen, in die göttliche Lebensfülle einzutreten. Der zweite Teil hat die Befolgung dieser Einladung, den Aufstieg des Menschen zu Gott, die anabatische Dimension, zum Thema. Diese beiden Teile bilden sozusagen die „allgemeine Liturgik". In den folgenden vier Teilen geht es um Themen der speziellen Liturgik: die Feier der Eucharistie, die Sakramente und Sakramentalien, Stundengebet und Wortgottesdienst sowie das Herrenjahr. Ziel der Veröffentlichung ist, über die reine Wissensvermittlung hinaus die Liebe zum Gottesdienst, zum Dienst Gottes an den vielen und zum Dienst der vielen Gläubigen zur höheren Ehre Gottes, zu wecken und zu bestärken.
Rezension
Mit dem vorliegenden 10. Band, der von der Liturgie der Kirche handelt, findet das Unternehmen der AMATECA-Lehrbücher seine Fortsetzung. Studierende der Theologie sollen eingeführt werden in die Geschichte, die gegenwärtige Gestalt und die theologische Systematik des Gottesdienstes. Sie sollen bekannt gemacht werden mit den gewachsenen Strukturen, mit dem geistlichen Anspruch liturgischer Vollzüge und auch mit der Frage nach der Gestalt der Liturgie von morgen.
Diese überarbeitete Fassung weist auf ein erstes ernstes ekklesiologisches Problem hin: Hand in Hand mit einem in den verschiedenen Regionen der Kirche katastrophale Ausmaße annehmenden Priestermangel und der dadurch immer größer werdenden Bedeutung der Laien in der Liturgie wird die Rolle und theologische Bedeutung des Weiheamtes gerade auch von liturgiewissenschaftlicher Seite relativiert oder sogar in Frage gestellt. Probleme stantis et cadentis Ecclesiae und damit auch ihrer Liturgie werfen verschiedene "Christologien der Liturgie" auf; ihnen gegenüber erneuern und bestärken wir in Übereinstimmung mit Jean Corbon unsere verschiedenerseits kritisierte Rede von der "vorliturgischen Zeit" vor der Inkarnation des Sohnes Gottes. Damit soll auf den unaufgebbaren Kern christlicher Identität gegenüber allen nur möglichen theologischen Modeströmungen hingewiesen werden, die in irgendeiner Weise die Person und Heilsbedeutung dessen relativieren wollen, dessen Name größer ist als alle anderen im Himmel, auf der Erde und unter der Erde. Möge diese zweite Auflage des Lehrbuchs dem Ziel dienen, in die Geheimnisse des christlichen Gottesdienstes theologisch verantwortet einzuführen, mehr aber noch, die Liebe zur Liturgie zu wecken oder zu bestärken. Nieder, lehrerbibliothek.de Inhaltsverzeichnis
Vorwort 14
l. Teil: Katabasis: Der Herabstieg Gottes zum Menschen 1.1 Eine „theologische Wende" in der Liturgie-Wissenschaft? 19 1.1.1 Zur „anthropologischen Wende" in der Theologie 19 1.1.2 Die katabatische Wende in der Liturgietheologie 21 1.1.3 Die anthropologische und die katabatische Wende in Zusammenschau 22 1.2 Der problematische Begriff des „Kultes" - oder:Warum überhaupt Gottesdienst? 26 1.2.1 Infragestellung 26 1.2.2 Kultkritik 27 1.2.3 Lösungsversuche 32 1.3 Liturgie - Gottes Werk und Gottes Dienst an den vielen 36 1.3.1 Der Begriff „Liturgie" und seine profane Herkunft 36 1.3.2 Der Umfang des Liturgiebegriffs im theologisch-kirchlichen Sprachgebrauch37 1.3.3 Die katabatische Verankerung des Liturgiebegriffs im Leben des dreifaltigen Gottes 39 1.3.3.1 Das Fest als Daseinsbestätigung 40 1.3.3.2 Das urcwige Fest der himmlischen Liturgie 41 1.3.3.3 Himmlische und irdische Liturgie 44 1.4 Die sichtbare Welt als Voraussetzung der Liturgie 51 1.4.1 Das Dazwischen als Voraussetzung jedweder Kommunikation 52 1.4.2 Das Dazwischen Gottes 53 1.4.3 Profanität als Schonung des kreatürlichen Selbstandes 55 1.4.4 Die Sünde der Entsakralisierung des Profanen 56 1.4.5 Die Heilung als Resakralisierung des Profanen 57 1.4.6 Die Unaufgebbarkeit der Sakral-profan-Unterscheidung 58 1.5 Aktestamendiche Katabasis: Das göttliche Geschenk der Gemeinschaft 63 1.5.1 Die Katabasis Gottes in die Geschichte seines Volkes 63 1.5.2 Der Kult des alttestamentlichen Bundesvolkes 64 1.5.3 Die vorliturgische Zeit 71 1.6 Die Liturgie des Hohenpriesters Christus 75 1.6.1 „Kein Mensch kann mich sehen und am Leben bleiben" (Ex33,20). 75 1.6.2 Christi Menschennatur als Quelle der Erlösung 77 1.6.3 Die Bedeutung von Tod und Auferstehung für die Erlösung 78 1.6.4 Christos leitourgos-der hohepriesterliche Mittler 82 1.7 Der Geist, „der alle Heiligung vollendet" (4. Hochgebet) 86 1.7.1 „ Geistvergessenheit" des Abendlandes ? 86 1.7.2 Aus dem Vater, durch den Sohn, im Heiligen Geist 86 1.7.3 Spiritus communicator 88 1.7.4 Die Bedeutung der Epildese in der Liturgie 90 1.8 Kirche I: Die Kirche als Ort und Ereignis der Begnadung 93 1.8.1 Kirche als Teil der göttlichen Katabasis 93 1.8.2 Die Kirche als Ort der Anaphora 94 1.8.3 Opfergemeinschaft 97 1.8.4 Eucharistische Ekklesiologie 99 1.8.5 Königliches und ministerielles Priestertum 100 1.9 Anamnesis: Die Katabasis Gottes in die Zeit 108 1.9.1 De immutabilitate Dei 108 1.9.2 Der Mensch in der Zeit. 109 1.9.3 Anamnesis: Die liturgische Gegenwart 112 1.9.4 Anamnesis-Gottes-oder Menschenwerk? 116 1.10 Theosis - Die Vergöttlichung von Mensch und Welt als Ziel der göttlichen Katabasis 120 1.10.1 Nicht zitierbare Eschata? Zur Frage nach der Liturgiefähigkeit des modernen Menschen 120 1.10.2 „In deinem Licht schauen wir das Licht" (PS 36,10b) 123 2. Teil: Anabasis: Der Aufstieg des Menschen zu Gott 2.1 Die Anabasis und ihre sichtbare Gestalt 129 2.1.1 Der Mensch als ein sich äußerndes Wesen 129 2.1.2 Ein kommunikatives Symbolverständnis 133 2.1.3 Die Anabasis als Vollendung aller menschlichen Äußerungen und „Anaphora" 136 2.2 Liturgie und Kultur 141 2.2.1 Liturgiewissenschaf t als Kulturwissenschaf t ? 141 2.2.2 Liturgie und Kultur — ein ambivalentes Verhältnis 142 2.2.3 Die Inkulturation der Liturgie als bleibende Aufgabe 144 2.3 Von der Liturgiewissenschaft und ihrer Geschichte 149 2.3.1 Die theologische Disziplin und ihre Aufgabenstellung 149 2.3.2 Die lange Epoche der Rituserklärung 150 2.3.3 Die wissenschaftliche Auseinandersetzung mit der Liturgie 156 2.3.4 Bleibende Aufgabenfelder 160 2.4 Der Leib des Menschen als Organ liturgischen Handelns 166 2.4.1 Anima forma corporis 166 2.4.2 Die Wiedergewinnung leiblicher Vollzüge in der Liturgie 167 2.4.3 Leibliche Ausdrucksformen in der Liturgie 170 2.5 Die Sprache der Liturgie 179 2.5.1 Sprache als Lebensvollzug 179 2.5.2 Die „liturgische Sprache" 180 2.5.3 Das verkündigte Wort Gottes 183 2.5.4 Formen der Wortverkündigung in der Liturgie 184 2.5.5 Das Gebet als Lebensvollzug und Antwort auf das verkündigte Wort 187 2.5.6 Gebetsformen der Liturgie 190 2.6 Gesang und Musik im Gottesdienst 193 2.6.1 Der singende und musizierende Mensch 193 2.6.2 Zur Geschichte von Gesang und Musik im christlichen Gottesdienst 194 2.6.3 Liturgische Musik nach dem 2. Vatikanum 201 2.6.4 Instrumente für die liturgische Musik 205 2.6.5 Die liturgische Musik der byzantinischen Kirche 207 2.7 Das liturgische Kleid 210 2.7.1 Die menschliche Erscheinungsweise. 210 2.7.2 Christus als Gewand anlegen 211 2.7.3 Das liturgische Gewand 213 2.8 Das Ding: Materielle Gegenstände als anabatische Ausdrucksmedien 220 2.8.1 Das materielle Objekt als Ausdrucksgegenstand in der Liturgie 220 2.8.2 Naturelemente im Gottesdienst 222 2.8.3 Die liturgischen Geräte 228 2.8.4 Die heiligen Bilder 230 2.9 Der liturgische Raum 233 2.9.1 Kirche aus Steinen, lebendigen wie richtigen 233 2.9.2 Der liturgische Raum in seiner geschichtlichenEntwicklung 234 2.9.3 Die Orte der erneuerten Liturgie 244 2.9.4 Die bleibende Aufgabe der Durchwohnung des liturgischen Raums 246 2.10 Kirche II: Die Gemeinschaft als anabatische Wirklichkeit 250 2.10.1 Das zweite Subjekt liturgischen Handelns: die versammelte Gemeinde 250 2.10.2 Participatio actuosa 252 2.10.3 Gegliederte Feiergemeinde: die besonderen liturgischen Dienste 256 2.10.4 Die Liturgie im Spannungsfeld zwischen Ordnung und Freiheit - Liturgie und Recht 258 2.10.5 Liturgie und Ökumene. 263 3.Teil: Die Feier der Eucharistie 3.1 Das Sakrament der Sakramente 269 3.1.1 Teilhabe an der Quelle der Vergöttlichung 269 3.1.2 Realpräsenz 270 3.1.3 Das Zulassen der göttlichen Liturgie an uns - das Opfer 274 3.1.4 Die die Eucharistie feiernde Gemeinde 278 3.2 Aus der Geschichte der Eucharistiefeier 281 3.2.1 Von den Anfängen bis zu Hippolyt von Rom 281 3.2.2 Vom 4. Jahrhundert bis zum Frühmittelalter 285 3.2.3 Von der Übernahme der römischen Messe im Frankenreich bis zur Reformation 291 3.2.4 Die Tridentinische Reform und das Missale Romanum Pius V von 1570 294 3.2.5 Von der Restauration zum Vorabend des 2. Vatikanums 296 3.2.6 Die Meßreform des 2. Vatikanums und das Messbuch Pauls VI. 298 3.3 Die verschiedenen Formen der Meßfeier 301 3.3.1 Die verschiedenen Feierweisen der Messfeier vor der Reform 301 3.3.2 Die Feier der Messe mit Gemeinde als Grundform der erneuerten Eucharistiefeier 302 3.3.3 Die Konzelebration 304 3.3.4 Weitere Formen der Meßfeier305 3.3.5 Versuch einer Wertung. 309 3.4 Der Eröffnungsteil der Messe 311 3.4.1 „Vorhöfe" 311 3.4.2 Die Einzugsprozession mit dem Introitus 312 3.4.3 Die Verehrung des Altars 313 3.4.4 Die Eröffnung: Der liturgische Eingangsgrußund die Einführung. 314 3.4.5 Der Bußakt 314 3.4.6 Das Kyrie 316 3.4.7 Das Gloria 317 3.4.8 Das Tagesgebet. 318 3.4.9 Der Eröffnungsteil in der Eucharistiefeier anderer Riten .320 3.5 Der Wortgottesdienst 324 3.5.1 „Katechumenenmesse" 324 3.5.2 Die Leseordnung 325 3.5.3 Der Ort der Schriftverkündigung 328 3.5.4 Die Begleitriten 329 3.5.5 Der Antwortpsalm 330 3.5.6 Halleluja und Sequenz 331 3.5.7 Die Homilie 332 3.5.8 Das Glaubensbekenntnis 334 3.5.9 Die Fürbitten.336 3.5.10 Die Schriftverkündigung in der Eucharistiefeier anderer Riten 337 3.6 Die Gabenbereitung341 3.6.1 „Opferung"?341 3.6.2 Die „Früchte der Erde und der menschlichen Arbeit" 343 3.6.3 Die Begleitgebete zur Gabenbereitung 345 3.6.4 Die Inszenierung der bereiteten Gaben 346 3.6.5 Oratefratres 347 3.6.6 Das Gabengebet . 348 3.6.7 Die Gabenbereitung in der Eucharistiefeier anderer Riten . 349 3.7 Das eucharistische Hochgebet 352 3.7.1 Der Begriff des „Hochgebets" 352 3.7.2 Die Struktur des eucharistischen Hochgebets 353 3.7.3 Die vier Hochgebete des Römischen Meßbuchs von 1970 362 3.7.4 Weitere Hochgebete 364 3.7.5 Offene Fragen und Wünsche zum Hochgebet. 365 3.7.6 Das Hochgebet die Anaphora in der Eucharistiefeier anderer Riten 366 3.8 Der Kommunionteil der Messe 370 3.8.1 Das Vaterunser 370 3.8.2 Der Friedensgruß 371 3.8.3 Fractio, Agnus Dei und Commixtio 373 3.8.4 Die Kommunion 375 3.8.5 Die Entlassung 380 3.8.6 Der Kommunionteil in der Eucharistiefeier anderer Riten 383 4. Teil: Die sakramentlichen Feiern der Kirche 4.1 Über die Sakramente als solche und ihre Beziehung zur Eucharistie als Grundsakrament. 389 4.1.1 Die Sakramente als Mittel der Heiligung von Mensch und Welt 389 4.1.2 „Spenden" oder „Feiern" der Sakramente? 391 4.1.3 „Gnadenmittel" oder Grundvollzüge? 392 4.1.4 Wort und Zeichen 393 4.1.5 DasRituale 394 4.2; Die Initiationssakramente 398 4.2.1 Die Bedeutung der Initiation 398 4.2.2 Die christliche Initiation in der Alten Kirche 398 4.2.3 Die Feier der Kindertaufe: Entwicklung und heutige Gestalt 402 4.2.4 Der heutige Ritus der Aufnahme Erwachsener in die Kirche 406 4.2.5 Die Firmung in Geschichte und Gegenwart: Unangepaßte Übernahme alter Tradition? 410 4.2.6 Von der Taufkommunion zur Erstkommunion: Die Eucharistie als Teil der Initiation 415 4.2.7 Die Initiation bei den Byzantinern 416 4.3 Die Eucharistie als Sakrament außerhalb der Messe 419 4.3.1 Kommunionspendung außerhalb der Messe 419 4.3.2 Die Krankenkommunion und der Versehgang 421 4.3.3 Die Verehrung der Eucharistie 423 4.4 Das Bußsakrament 427 4.4.1 Das „liturgische Ethos" 427 4.4.2 Das Bußsakrament in Geschichte und Gegenwart 428 4.4.3 Die erneuerte Ordnung der Buße 433 4.4.4 Die Feier der Buße bei den Byzantinern 435 4.4.5 Die Buße in den Kirchen der Reformation 436 4.5 Die Krankensalbung 438 4.5.1 Lebenszusage an Leib und Seele des Menschen 438 4.5.2 Geschichtliche Entwicklung von der Krankensalbung zur „Letzten Ölung" 439 4.5.3 Die Reform: Von der „Letzten Ölung" zurück zur Krankensalbung 442 4.5.4 Offene Fragen 444 4.5.5 Das byzantinische Euchelaion 447 4.6 D äs Weihesakrament. 450 4.6.1 Die Erneuerung der Weiheliturgie 450 4.6.2 Der Weiheritus in Geschichte und Gegenwart 451 4.6.3 Die Feier der Beauftragung zu den Ministeria 458 4.6.4 Die byzantinische Weiheliturgie 460 4.7 Das Ehesakrament 464 4.7.1 Zur Geschichte der Eheliturgie 464 4.7.2 Die erneuerte Trauliturgie 467 4.7.3 Die byzantinische „Feier der Krönung" 469 4.7.4 Wer spendet die Ehe? 470 4.7.5 Die sogenannte „ökumenische Trauung" 474 4.7.6 Die liturgische Feier von Ehejubiläen 474 4.8 Die übrigen sakramentlichen Handlungen der Kirche 476 4.8.1 Sakramentliche Handlungen über die sieben Sakramente hinaus 476 4.8.2 Die Benediktionen 477 4.8.3 Der Exorzismus 481 4.8.4 Sakramentliche Handlungen in geistlichen Gemeinschaften 483 4.8.5 Die Begräbnisliturgie 485 5. Teil: Die Heiligung der Zeit 1: Liturgia verbi - Stundengebet und Wortgottesdienst 5.1 Die Heiligung der Zeit 493 5.1.1 Grundzüge einer Theologie des Gebetes 493 5.1.2 Grundlegende Aussagen der Allgemeinen Einführung in das Stundengebet 497 5.1.3 Hohe Gebetstheologie und tiefe Gebetsnot 499 5.1.4 Konsequenzen für die Bezeichnungen der Sache 503 5.2 Die geschichtliche Entwicklung des Stundengebets 506 5.2.1 Das jüdische Erbe und die frühen Entwicklungen 506 5.2.2 „Kathedrales" und „monastisches" Stundengebet 509 5.2.3 Von der Stundenliturgie zum Breviergebet 515 5.2.4 Die erneuerte Stundenliturgie 519 5.3 Die erneuerte Stundenliturgie und ihre Elemente 522 5.3.1 Die erneuerte Stundenliturgie als solche 522 5.3.2 Die einzelnen Elemente der Stundenliturgie. 527 5.3.3 Vorschläge neuer bzw. wiederzugewinnender Elemente er Stundenliturgie 538 5.4 Die Stundenliturgie in den Kirchen des Ostens ud der Reformation 542 5.4.1 Das Stundengebet der byzantinischen Kirche 542 5.4.2 Das Stundengebet in den Kirchen der Reformation 545 5.4.3 Das Stundengebet in der anglikanischen Kirche 548 5.5 Die Andachten 551 5.5.1 Wortgottesdienste neben der Stundenliturgie 551 5.5.2 Beispiele der Volksandacht 553 5.5.3. Die Wortgottesfeier - oder: Der priesterlose Sonntagsgottesdienst 559 6. Teil: Die Heiligung der Zeit 2: ie Feier des Herrenjahres 6.1 Das Herrenjahr: die jährliche Feier der Heilsgeheimnisse Christi 565 6.1.1 Die Jahresfeier als solche 568 6.1.2 Der jüdische Festkalender 570 6.1.3 Die Bezeichnungen für die christliche Jahresfeier 572 6.1.4 Ereignis -und Ideenfeste 574 6.1.5 Festdatierung als ökumenisches Problem 576 6.1.6 Die Jahresfeier im byzantinischen Ritus 578 6.1.7 Die Jahresfeier in den Kirchen der Reformation 579 6.2 Der Sonntag als Wochenpascha, die christliche Woche, die Quatembertage 582 6.2.1 Der Sonntag 582 6.2.2 Die Woche 593 6.2.3 Quatember 595 6.3 Der österliche Festkreis 598 6.3.1 Das jüdische Pesach und das christliche Ostern 598 6.3.2 Zur Geschichte der christlichen Osterfeier 600 6.3.3 Die Liturgie der Karwoche und der drei österlichen Tage 604 6.3.4 Quadragesima — die österliche Bußzeit 613 6.3.5 Quinquagesima/Pentekoste - die österliche Freudenzeit 617 6.4 Der Weihnachtsfestkreis 621 6.4.1 Der Advent. 621 6.4.2 Weihnachten (25. Dezember) 624 6.4.3 Die Weihnachtsoktav 627 6.4.4 Epiphanie (6. Januar) und Taufe des Herrn 629 6.4.5 Darstellung des Herrn (2. Februar) 632 6.4.6 Verkündigung des Herrn (25. März) 633 6.5 Herrenfeste im Herrenjahr 635 6.5.1 Fronleichnam (zweiter Donnerstag nach Pfingsten)635 6.5.2 Das Herz-Jesu-Fest (dritter Freitag nach Pfingsten) 638 6.5.3 Christkönig (letzter Sonntag im Jahreskreis) 639 6.5.4 Verklärung des Herrn (6. August) 640 6.5.5 Kreuzerhöhung (14. September) 641 6.5.6 Die Kirchweihfeste. 643 6.6 Die Feste Mariens und der Heiligen 646 6.6.1 Einführung in die Theologie der Heiligenverehrung 646 6.6.2 Zur geschichtlichen Entwicklung des Sanctorale 649 6.6.3 Hochfeste und Feste der Gottesmutter 652 6.6.4 Hochfeste und Feste der Heiligen 658 Abkürzungen 667 Personenregister 675 Sachregister 687 Register der Schriftstellen 715 Vergleichstabelle der Nummern der Allgemeinen Einführung in das Römische Meßbuch AEM 1970, 1988 - IGMR 2000, 718 |
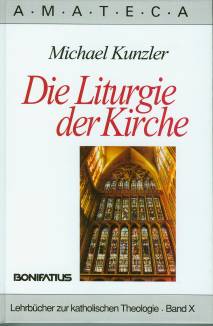
 Bei Amazon kaufen
Bei Amazon kaufen