|
|
|
Umschlagtext
Mit der Neuedition von Alois Riehls dreibändigem Werk »Der Philosophische Kritizismus und seine Bedeutung für die positive Wissenschaft« wird ein seit fast 100 Jahren vergriffener, philosophiegeschichtlich bedeutender Text wieder zugänglich gemacht. Im ersten Band (1876) rekonstruiert Riehl die Geschichte des Kritizismus und stellt seinen eigenen kritischen Realismus in die Reihe von Denkern wie Locke, Hume und Kant, aber auch Wolff, Lambert und Tetens.
Um die Jahrhundertwende gehörte Riehl zu den bestvernetzten deutschsprachigen Forscherinnen und Forschern – sein Einfluss reichte aber auch darüber hinaus, u. a. bis nach England, den USA, Russland und Japan. Er war Herausgeber der einflussreichen »Vierteljahresschrift für wissenschaftliche Philosophie«, richtete mit Hilfe Wilhelm Wundts in Halle eines der ersten psychologischen Laboratorien Deutschlands ein und hat maßgeblich dazu beigetragen, den Begriff »Wissenschaftsphilosophie« in seiner bis heute gebräuchlichen Verwendung zu etablieren. In Band 1 entwirft Riehl eine Geschichte des Kritizismus und positioniert seinen eigenen philosophischen Ansatz darin. Wichtigster Bezugspunkt ist Kants »Kritik der reinen Vernunft«, deren empiristische Quellen und systematische Lehrstücke er rekonstruiert. Der erste Band ist also als ein Buch über Kant und seine Vorgeschichte zu lesen und gleichzeitig als systematische Auseinandersetzung mit kritischer Philosophie. Dadurch nimmt das Buch in der Geschichte der Philosophie und Wissenschaften eine einzigartige Stellung ein und stellt immer noch einen höchst aktuellen Versuch einer »Integrated History and Philosophy of Science« dar. Rezension
Wissenschaftsphilosophie, englisch philosophy of science, ist ein Forschungsbereich, der sich mit philosophischen Grundlagen der Einzelwissenschaften bzw. der Wissenschaftsfamilien auseinandersetzt. Dazu zählt die Beschäftigung mit der Ontologie, Erkenntnistheorie, Wissenschaftstheorie, Methodologie und Logik sowie mit dem Verhältnis der Einzelwissenschaften zueinander. Ab der Mitte des 19. Jahrhunderts wurde innerhalb der Philosophie und in den Einzelwissenschaften die erkenntnistheoretische Begründung der positiven Wissenschaften intensiv diskutiert.
Eines in der Zeit wichtigsten Werke, welches breit rezipiert wurde, war: „Der philosophische Kritizismus und seine Bedeutung für die positive Wissenschaft“(1876-1887) von Alois Riehl (1844-1924). Dieses umfangreiche Werk umfasst drei Bände, deren Auflagen der Philosophieprofessor, der 1905 Nachfolger auf dem Lehrstuhl von Wilhelm Dilthey in Berlin wurde, überarbeitete und aktualisierte. Der erste Band trug den Untertitel „Geschichte und Methode des philosophischen Kritizismus“. In diesem entfaltet Riehl zunächst seine Variante einer realistischen Erkenntnistheorie. Auf dem Nachweis der theoretischen Ursprünge des Riehlschen Kritizismus u.a. in den empirischen Erkenntnistheorien von John Locke und David Hume sowie in der Transzendentalphilosophie von Immanuel Kant liegt der Schwerpunkt des ersten Bandes. Mit anderen Worten: Riehl interpretiert die klassischen Epistemologien durch seine erkenntnistheoretische Brille. Das Werk ist also von großem philosophiegeschichtlichem Interesse und kann als eines der wichtigsten Werke der Wissenschaftsphilosophie ab der zweiten Hälfte des 19. Jahrhunderts gelten. Dem Felix Meiner Verlag ist es zu verdanken, dass erstmals nach fast 100 Jahren eine Neuedition des wissenschaftsphilosophischen Klassikers zugänglich ist. Herausgegeben wird das Werk von Rudolf Meer, Marie Curie STAR Fellow am Institut für Mathematik an der Universität Siegen, und ausgewiesener Kant-Experte. Auch für die Kant-Forschung, insbesondere für die Rezeptionsgeschichte der „Kritik der reinen Vernunft“ ist die Neuedition des philosophischen Kritizismus von Relevanz. Meers Ausgabe ist versehen mit einer sehr guten Einleitung und hervorragenden editorischen Anmerkungen, welche verdeutlichen, in welche philosophischen Diskurse der Zeit sich Riehl argumentativ einschaltete. Lehrkräfte des Faches Philosophie werden durch die vorliegende Ausgabe motiviert, sich in ihrem Unterricht mit Varianten realistischer und antirealistischer Erkenntnistheorien problemorientiert auseinanderzusetzen. Fazit: Mit der Neuedition von Alois Riehls Werk „Der philosophische Kritizismus und seine Bedeutung für die positive Wissenschaft“ wird ein Schatz der Wissenschaftsphilosophie und Epistemologie gehoben. Dr. Marcel Remme, für lehrerbibliothek.de Verlagsinfo
Mit der Neuedition von Alois Riehls dreibändigem Werk »Der Philosophische Kritizismus und seine Bedeutung für die positive Wissenschaft« wird ein seit fast 100 Jahren vergriffener, philosophiegeschichtlich bedeutender Text wieder zugänglich gemacht. Im ersten Band (1876) rekonstruiert Riehl die Geschichte des Kritizismus und stellt seinen eigenen kritischen Realismus in die Reihe von Denkern wie Locke, Hume und Kant, aber auch Wolff, Lambert und Tetens. Um die Jahrhundertwende gehörte Riehl zu den bestvernetzten deutschsprachigen Forscherinnen und Forschern – sein Einfluss reichte aber auch darüber hinaus, u. a. bis nach England, den USA, Russland und Japan. Er war Herausgeber der einflussreichen »Vierteljahresschrift für wissenschaftliche Philosophie«, richtete mit Hilfe Wilhelm Wundts in Halle eines der ersten psychologischen Laboratorien Deutschlands ein und hat maßgeblich dazu beigetragen, den Begriff »Wissenschaftsphilosophie« in seiner bis heute gebräuchlichen Verwendung zu etablieren. In Band 1 entwirft Riehl eine Geschichte des Kritizismus und positioniert seinen eigenen philosophischen Ansatz darin. Wichtigster Bezugspunkt ist Kants »Kritik der reinen Vernunft«, deren empiristische Quellen und systematische Lehrstücke er rekonstruiert. Der erste Band ist also als ein Buch über Kant und seine Vorgeschichte zu lesen und gleichzeitig als systematische Auseinandersetzung mit kritischer Philosophie. Dadurch nimmt das Buch in der Geschichte der Philosophie und Wissenschaften eine einzigartige Stellung ein und stellt immer noch einen höchst aktuellen Versuch einer »Integrated History and Philosophy of Science« dar. Inhaltsverzeichnis
Vorwort VII
Einleitung IX Alois Riehls Werdegang IX Zur Stellung des »Philosophischen Kritizismus« in Riehls Werk XI Forschungsstand XVI »Geschichte und Methode des Philosophischen Kritizismus« XIX Editorischer Bericht XLI Bibliografie VLII DER PHILOSOPHISCHE KRITIZISMUS UND SEINE BEDEUTUNG FÜR DIE POSITIVE WISSENSCHAFT 1 Vorrede 3 Detailliertes Inhaltsverzeichnis 7 Einleitung 15 § 1. Der philosophische Kritizismus und seine Bedeutung für die positive Wissenschaft 15 § 2. Entwicklungsgang der kritischen Philosophie 17 § 3. Der Kritizismus Kants. Über die Versuche, ihn zu restaurieren. Hauptsächliche Missverständnisse der Kantischen Philosophie 19 § 4. Nächste Aufgabe dieses Werkes. Bedeutung einer Untersuchung der Methode Kants. Die beiden Erkenntnisfaktoren. Kant und Fichte 25 § 5. Die Terminologie Kants. Beispiel, der Terminus: Möglichkeit der Erfahrung. Die Vernunftkritik ist nicht Kritik der Erkenntnisvermögen, sondern der Erkenntnis selbst 29 Erster Abschnitt Die geschichtlichen Voraussetzungen der kritischen Philosophie Kants 35 Erstes Kapitel: Locke als Begründer des psychologischen Kritizismus 35 § 1. Die Aufgabe und die Methode Lockes im Allgemeinen 35 § 2. Sensation und Reflexion. Sekundäre Natur der letztern 38 § 3. Der Empirismus Lockes. Seine Einschränkung auf den Inhalt der Begriffe. Wahrer Gegensatz zu Descartes. Anerkennung einer ursprünglichen Verstandestätigkeit (›archetypes‹). Bemerkung über Nativismus und Empirismus 39 § 4. Die Empfindung. Klassifikation der einfachen Ideen. Kriterien für deren Einfachheit 42 § 5. Primäre und sekundäre Qualitäten. Prinzipielle Voranstellung des »mechanischen Sinnes«. Die spezifischen Erregungen und die Eigenschaften der Außendinge. Kritik der Unterscheidung Lockes 43 § 6. Erkenntnistheoretische Bedeutung der Empfindung. Die Empfindung als Grenze des Erkennens 49 § 7. Lockes Lehre vom Raum. Unterscheidung von Raum und Materie. Psychologischer Beweis für die Existenz des absoluten Raumes 52 § 8. Die Zeit. Die einfache Idee der Dauer. Unabhängigkeit der Vorstellung der Sukzession von der Vorstellung der Bewegung. Kritik der Lehre von der Zeit. Gemeinsame Eigenschaften von Raum und Zeit. Deren Grund 60 § 9. Theorie der Unendlichkeit. Ausgang von der Zahl. Bedeutung der Locke’schen Untersuchung der Idee des Unendlichen. Diese Idee ist negativ. Schwierigkeiten des räumlich Unendlichen 63 § 10. Kritik des Begriffs der Substanz. Locke und Hume. Annäherung Lockes an Kant. Die relative Bedeutung der Substanzvorstellung 67 § 11. Mathematische und moralische Erkenntnis. Ihre Zurückführung auf Synthese durch den Verstand. Der Grund ihrer Evidenz und Gewissheit. Analogie des moralischen Erkennens mit dem mathematischen. Die Synthesis a priori 72 § 12. Locke und Kant. Vergleichung ihrer Methoden. Kein direkter Einfluss Lockes auf Kant78 Zweites Kapitel: Humes skeptischer Kritizismus 81 § 1. Die Philosophie Humes ist nicht als Skeptizismus, sondern als Positivismus aufzufassen. Die Gründe ihres Missverständnisses. Unvollständige Kenntnis Kants von Hume 81 § 2. Die Methode Humes. Klassifikation der Impressionen. Der Fundamentalsatz des Kritizismus Humes. Gesetze der Assoziation. Verhältnis des Assoziationsprinzipes zum Fundamentalsatz. Grenzen der Methode Humes 89 § 3. Berkeley und Hume über den Allgemeinbegriff. Wundt über den Begriff. Die Bestreitung einer Vorstellung des Allgemeinen hebt nicht die Existenz der Begriffe im Bewusstsein auf. Grundlinien einer Theorie des Begriffs. Einfluss der unrichtigen Erfassung 98 § 4. Humes Lehre über Raum, Zeit und Mathematik. Bestreitung der unendlichen Teilbarkeit. Kritik dieser Bestreitung. Die formale Natur des Raumes und der Zeit. Bestreitung des Leeren. Angriffe gegen die Geometrie. Die Geometrie hat keine genaue Gültigkeit 106 § 5. Kritik der Kausalität. Bedeutung der Hume’schen Untersuchung. Dogmatischer Missbrauch des Satzes vom zureichenden Grunde. Entstehung der Kausalitätskritik. Die Notwendigkeit als ihr Problem. Unterscheidung der begrifflichen und tatsächlichen Erkenntnis 123 § 6. Zusammenhang der theoretischen Philosophie Humes. Die Skepsis als Waffe gegen den Dogmatismus. Unbeweisbarkeit des Daseins. Substanz. Persönliche Identität und Einheit des Bewusstseins. Anhang: Humes Idee von mechanischer Anpassung bei Entstehung und Entwicklung der Organismen 170 Drittes Kapitel: Der Einfluss Wolffs auf Kant. Die kritischen Bestrebungen von Lambert und Tetens 182 § 1. Der Einfluss Wolffs 182 § 2. Der Begriff der Möglichkeit. Übereinstimmung und Divergenz von Wolff und Kant 185 § 3. Der Satz vom Grunde in der Wolff’schen Philosophie 191 § 4. Kritische Bestrebungen in der deutschen Philosophie am Ausgang des 18. Jahrhunderts. Lambert. Bedeutung seines neuen Organons für die Theorie der Forschung. Gesetz der Interpolation. Lambert über die Prinzipien der Mechanik. Trennung von Kinematik und Mechanik 194 § 5. Die »Versuche über die menschliche Natur« von Tetens. Die psychologische Methode in erkenntnistheoretischen Fragen. Missglückter Versuch, Hume zu widerlegen. Annäherungen an Kant. – Zusammenfassung der Vorgeschichte der Philosophie Kants 208 Zweiter Abschnitt Die Methode des Kritizismus Kants 223 Erstes Kapitel: Ausbildung der kritischen Methode 223 § 1. Aufgabe dieses Kapitels. Methodische Bedeutung der Erkenntniskritik. Kritische Vorbemerkungen. Prüfung der Darstellung Fischers vom Entwicklungsgange Kants 223 § 2. Kants Entwicklungsgang bis zum Jahre 1770. Die Motive zur Reform der philosophischen Methode. Anteil der Naturwissenschaft an der Reform der Philosophie. Einfluss der Newton’schen Naturphilosophie. Newton über den absoluten Raum und die absolute Zeit 250 § 3. Die unauflöslichen Begriffe. Entwicklung der Kausalitätslehre Kants. Fortschritte in der Raumtheorie. Kant und die absolute Geometrie. Der Aufsatz »Von dem ersten Grunde der Unterscheidung der Gegenden im Raume«. Euler und Kant. Beweis für die Notwendigkeit der Annahme des absouten Raumes 274 Zweites Kapitel: Die Dissertation vom Jahre 1770 und die fernere Ausbildung der Vernunftkritik288 § 1. Der Standpunkt der Dissertationsschrift. Erklärung des Dogmatismus dieser Abhandlung. Die methodischen Beziehungen der Dissertation zur Vernunftkritik. Analyse der Abhandlung 288 § 2. Fernere Ausbildung der Methode. Der kritische Standpunkt in Hinsicht der rein begrifflichen Erkenntnis. Das kritische Problem erscheint zuerst im Briefe an Herz von 1772 formuliert. Entdeckung der metaphysischen Deduktion der Kategorien. Die kritische Hypothese 307 § 3. Kontroversen über die Methode der Vernunftkritik. Das psychologische Vorurteil. Die anthropologische Kritik. Unterscheidung von subjektiver und objektiver Notwendigkeit. Die Einwendungen Herbarts gegen die Methode. Wundts synthetische Raumtheorie. Kants Lehre ist nicht Nativismus 318 Drittes Kapitel: Die Methode der Vernunftkritik 340 § 1. Das Problem der Kritik. Analyse der Frage: Wie sind synthetische Urteile a priori möglich? Erkenntnistheoretische Bedeutung des Urteils. Analytisch und synthetisch. Analytische Urteile sind Begriffsurteile, synthetische, Urteile auf Grund von Anschauung 340 § 2 a. Die Methode. Unterschied der metaphysischen Erörterung und Deduktion von der transzendentalen. Ableitung der Tatsache reiner Erkenntnis und Beweis ihrer Gültigkeit von den Objekten. Die Ableitung der Tatsache erfolgt durch Analyse der Begriffe. Die Tatsache reiner Anschauungsformen 365 § 2 b. Ableitung der Tatsache reiner Begriffe. – Funktionen der Einheit des Denkens und Kategorien. Kritik der metaphysischen Deduktion. Erfolgt die Anwendung der Kategorien bewusst oder unbewusst? 380 § 2 c. Transzendentale Deduktion. Sinn der Aufgabe. Die »Möglichkeit« des Apriori. Keine physiologische Deduktion. Kant gegen Locke. Die erste und zweite Auflage der Vernunftkritik. Gedankengang der Deduktion im Allgemeinen. Prüfung der Deduktion in der ersten Bearbeitung 393 § 2 d. Die zweite Bearbeitung der Deduktion. Ihre methodischen Vorzüge. Ihr Gedankengang. Wesentliche Übereinstimmung beider Bearbeitungen 419 § 3. Schematismus und Grundsätze der Erfahrung. Kritik des Schematismus. Der Schematismus als Grundlage der Lehre von den Grundsätzen. Der Begriff der Erfahrung. Die mathematischen Grundsätze. Die dynamischen Grundsätze. Erklärung des Ausdruckes: Analogien 428 § 4 a. Erscheinung, Ding an sich und Noumenon. Lehre von der Existenz der Dinge. Der methodische Begriff: Erscheinung. Widerlegung des Idealismus. Beweis, dass die Gründe dieser Widerlegung schon in den Paralogismen der ersten Auflage enthalten sind. Das Ding an sich als Korrelat der Erscheinung 450 § 4 b. Die Begriffe des Noumenon und des Dinges an sich sind nicht gleichbedeutend. Zweideutigkeit in der Konzeption des Noumenon. Das Noumenon ist imaginär und dennoch die Stütze der Moralphilosophie Kants 463 § 5. Methode der Dialektik. Nachahmung der Analytik in der Produktion von Ideen. Künstlichkeit der Dialektik. Die Methode der übrigen kritischen Werke 467 § 6. Zusammenfassung dieses Kapitels 470 Editorische Anmerkungen 477 Siglenverzeichnis 489 Literaturverzeichnis 491 Personenregister 499 |
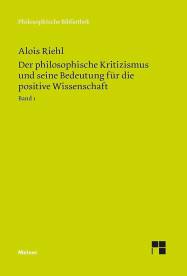
 Bei Amazon kaufen
Bei Amazon kaufen