|
|
|
Umschlagtext
Angesichts der Krisen und Defizite säkularer Gesellschaften wird die Relevanz der Religion für zentrale und elementare Fragen menschlichen Miteinanders zunehmend wieder entdeckt. Zugleich bestreitet ein „Neuer Atheismus“, dass die Berufung auf Gott im Denk- und Erfahrungshorizont der Welt noch Geltung beanspruchen kann. Allenfalls eine Gott los gewordene Religiosität will er noch zulassen.
Wie man angesichts dieser widerstreitenden Tendenzen und den damit verbundenen intellektuellen und existenziellen Herausforderungen angemessen von Gott sprechen kann, ist die Grundfrage dieses Buches. Darin greift Hans-Joachim Höhn auf die „theologia negativa“ zurück – eine Denkform, welche im Bewusstsein des vielfachen Missbrauchs des Wortes „Gott“ die „Entleerung“ eines dogmatisch und moralisch überfrachteten Glaubens betreibt und ebenso die Fremdheit und Unverfügbarkeit wie die verborgene Gegenwart Gottes zu wahren sucht. Autor: Hans-Joachim Höhn, Dr. theol., geboren 1957; Professor für Systematische Theologie und Religionsphilosophie an der Universität zu Köln. Rezension
Hans-Joachim Höhns Buch hat sich zur Aufgabe gesetzt, die Verwendung und Bedeutung des Wortes 'Gott' in unserer, einer 'postsäkularen' Zeit, darzustellen und darüber zu reflektieren, wie und in welchem Sinne man heute von Gott reden und an ihn glauben kann. 'Postsäkular' will sagen, dass die lange behauptete endgültige Säkularisierung der Welt und damit das Ende der Religion und des Redens von Gott offenbar nicht eingetreten sind. Es wird weiterhin von Gott gesprochen. Aber wie kann, darf und soll man von ihm sprechen, ohne in alte und desavouierte Denkmuster zurückzufallen?
Kapitel 1 legt dar, dass eine theologische Rede von Gott, die nicht zur Kenntnis nimmt, dass sich die Gegenwart ohne Gott verstehen kann und will, keinen Sinn macht. Kapitel 2 plädiert für eine 'theologia negativa', die allen Gottesbildern ihre Berechtigung bestreitet, die Gott zu verzwecken suchen und seiner absoluten Andersheit nicht gerecht werden. Diese 'theologia negativa' wird im dritten Kapitel daraufhin überprüft, was sie zum Verständnis der Gleichzeitigkeit von Fraglosigkeit und Fragwürdigkeit der menschlichen Existenz zwischen Sein und Nichts beizutragen hat. Kapitel 4 wendet die 'theologia negativa' in die Kritik einer Mediengesellschaft, in der die Unterschiede zwischen Realität und Virtualität in einer falschen Anschaulichkeit verloren gehen, die vom Gottesbegriff her zu kritisieren ist. Das fünfte Kapitel schließlich bietet eine Skizze der Verankerung der 'theologia negative' in der persönlichen Biografie des Autors. Höhns Reflexionen sind sprachlich, begrifflich und gedanklich anspruchsvoll und verlangen eine genaue Lektüre. Ihre Bedeutung wird am leichtesten von ihrem autobiografischen Schlusskapitel her sichtbar. Hier durchbricht Höhn nämlich die akademische Konvention der Objektivität und Ausgewogenheit von wissenschaftlichen Abhandlungen, um seinen persönlichen Bezug zu beschreiben, also die Lebenserfahrungen, von denen her er argumentiert. Er sei, so schreibt er "... von allen theologischen Konstruktionen abgerückt, die Gott und das Leid derart zusammendenken wollen, dass sie sein Nicht-Eingreifen in die Welt als Respekt weltlicher Autonomie und menschlicher Freiheit rechtfertigen.' (245/246). Ebenso habe er es aufgegeben, "naturwissenschaftliche Weltentstehungstheorien auf Lücken abzusuchen, die Platz lassen für ein unmittelbares Eingreifen." (248) Er stellt sich unter Bezug auf Bonhoeffer einer Glaubenssituation, die den Glauben an Gott als eine 'Hoffnung wider alle Hoffnung' begreift: "'Gott gibt uns zu wissen, dass wir leben müssen als solche, die mit dem Leben ohne Gott fertig werden. Der Gott, der uns in der Welt leben lässt ohne die Arbeitshypothese Gott, ist der Gott, vor dem wir dauernd stehen. Vor und mit Gott leben wir ohne Gott.'" Wer seinen Gottesglauben so radikal in Frage gestellt sieht und selbst in Frage stellt wie Bonhoeffer, wird Höhns Buch mit Gewinn lesen. Matthias Wörther, lehrerbibliothek.de Inhaltsverzeichnis
I. Abschied von Gott? Theologie an den Grenzen der Moderne ... 13
1. Provokationen: Die Passion des Wortes 'Gott' ... 15 1.1 Enteignungen: Vom Verbrauch des Wortes 'Gott' ... 22 1.2 Bestreitungen: Für und wider die Notwendigkeit Gottes ... 47 1.3 Aufbegehren: Auf den Gedanken kommen, (an) Gott zu denken ... 57 2. 'Gott' als AdVerb: Perspektiven einer postsäkularen Rede von Gott ... 66 2.1 Versuchungen: Die Rede von Gott - nach ihrem Ende ... 68 2.2 Plädoyer: Rehabilitierung einer theologie negativa ... 85 II. Biblische Aufklärung: Offenbarung als Bestreitung ... 99 1. Da - Sein - Werden: Das Wort 'Gott' und der Name Gottes ... 103 2. Gott sehen: Etwas vor sich haben - das Nachsehen haben ... 109 3. Gottes Unheimlichkeit: Erschlichene und errungene Identität ... 119 4. Bild des Unsichtbaren: Bilderverbot und Gottebenbildlichkeit ... 127 4.1 Versuchungen: Der wahre Gott und die falschen Bilder ... 129 4.2 Widerspruch? Schöpfung und Selbstoffenbarung Gottes ... 136 4.3 Entsprechungen: Offenbarung als Erfüllung des Bilderverbotes ... 143 III. Philosophischer Kontext: Gott denken im Widerstreit von Sein und Nichts ... 153 1. Welt ohne Gott: Versteht sich die Welt von selbst? ... 155 2. Gott im Nichts? Dem Dasein auf den Grund gehen ... 169 3. Vor dem Nichts stehen: Gottes WIderfahrnis? ... 175 4. Verschränkungen: Transzendenz und Immanenz grundlosen Daseins ... 190 IV. Ästhetische Kontroversen: Wahre Bilder? - Bilder der Wahrheit? ... 199 1. 'Wir sehen uns!' Zeit des Zeigens - Zeichen der Zeit ... 203 2. Bilder? Verbieten? Medienkritische Aspekte des BIlderverbotes ... 209 3. Kulturkritik und Bilderstreit: Religionskritische Aspekte des Bilderverbotes ... 218 4. Gottes Wort im Bild: Das Wagnis einer ästhetischen Gottesrede ... 225 V. Epilog: Gott - bestritten und vermisst ... 237 Auswahlbibliographie ... 253 |
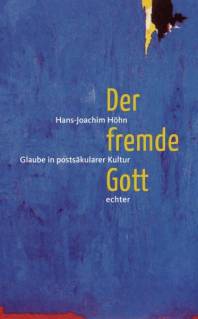
 Bei Amazon kaufen
Bei Amazon kaufen