|
|
|
Umschlagtext
In dieser einzigartigen zweisprachigen Quellensammlung zeigt sich das Verhältnis zwischen dem römischen Staat und dem frühen Christentum von den Anfängen bis zum endgültigen Ausgleich im Jahr 311. Der Kommentar erläutert zahlreiche wichtige profan- wie kirchengeschichtliche Probleme und Hintergründe.
Der erste Teil der Sammlung dokumentiert zunächst die Christenverfolgung im Römischen Reich, sodann die Ansatzpunkte zu einer Verständigung zwischen Heiden und Christen auf geistiger wie auch auf praktisch-politischer Ebene. Die Einbindung der Christen in eine enge Lebensgemeinschaft mit ihrer heidnischen Umwelt steht im Zentrum des zweiten Teils, der die Haltung der Christen zu wichtigen Institutionen der römischen Gesellschaft und die Reaktion der Heiden auf das Verhalten der Christen belegt. Peter Guyot, geb. 1951, ist Verlagslektor für Altertumswissenschaften, Religionswissenschaft und Philosophie. Richard Klein, geb. 1934, ist Professor für Alte Geschichte an der Universität Erlangen. Rezension
Das Verhältnis von Kirche und Staat gehört in der gesamten abendländischen (Kirchen-)Geschichte zu einem Schlüsselthema; für das frühe Christentum und die Alte Kirche gilt das in ganz besonderer Weise. Bis zur sog. Konstantinischen Wende im beginnenden 4. Jhdt. war das Christentum eine (lokal und temporär) verfolgte Religion, binnen eines Jahrhunderts wurde es dann zur erlaubten und zur seinerseits verfolgenden Religion. Wer diesen komplexen Sachverhalt, der das Christentum maßgeblich für die nächsten 2000 Jahre konstituiert hat, nicht nur durch Sekundärliteratur-Darstellungen wahrnehmen möchte, sondern selbst anhand von ausgewählten Quellen begreifen möchte, der ist mit diesem voluminösen, ursprünglich zwei-bändigen Werk, allerbestens aufgehoben: auf der linken Druckseite findet sich der jeweilige ursprachliche Originaltext (griechisch oder lateinisch), auf der gegenüberliegenden Seite die deutsche Übersetzung.
Jens Walter, lehrerbibliothek.de Verlagsinfo
WBG-Preis EUR 29,90 Buchhandelspreis EUR 49,90 Diese einzigartige kommentierte Quellensammlung stellt die Situation der Christen im Römischen Reich dar. In den zweisprachig dokumentierten Texten wird die geschichtliche Entwicklung von den ersten christlichen Gruppierungen bis ins Jahr 311 erläutert, von den Christenverfolgungen unter Nero bis zu Domitian. Im ersten Teil werden vor allem die Konflikte zwischen Christen und Heiden dargestellt, im zweiten Teil das Verhältnis der christlichen Gemeinden zu den Institutionen des Römischen Reiches. Einführung A. Verfolgungen Das Schema der zehn Verfolgungen. (Augustinus, civ. Dei XVIII 52) 1. Nero (54 – 68) 2. Domitian (81 – 96) 3. Trajan (98 – 117) und Hadrian (117 – 138) 4. Marc Aurel (161 – 180) 5. Septimius Severus (193 – 211) 6. Maximinus Thrax (235 – 238) 7. Decius (249 – 251) 8. Valerian (253 – 260) 9. Aurelian (270 – 275) 10. Diokletian und seine Mitregenten (284 – 305) B. Ansätze zu einer Verständigung 1. Grundsätzliche Anerkennung der kaiserlichen Herrschaft 2. Das Gebet für den Kaiser 3. Das Römische Reich im heilsgeschichtlichen Denken der Christen 4. Die Mitarbeit von Christen im römischen Staat 5. Kontakte führender Vertreter beider Religionen 6. Übernahme profaner Rechts- und Verwaltungsformen A. Verfolgungen B. Ansätze zu einer Verständigung Kurzbiographien der antiken Autoren Literatur Register 1. Bibelstellen 2. Personennamen Rezensionen »Insgesamt ist dies eine sehr geglückte Dokumentation, die sich durch eine Vielfalt von Texten, Kommentaren, Interpretationen und Literaturangaben auszeichnet. Das Werk ist nicht nur als Arbeitsinstrument für Patristiker und Historiker geeignet, sondern kann jedem an der Geschichte des frühen Christentums interessierten Leser empfohlen werden. Durch die Übersetzungen und Kommentare haben uns die beiden Autoren aber vor allem reiches Material zum Selbststudium vorgelegt. Dies spricht nicht zuletzt dafür, dass diese breit angelegte Dokumentation als unentbehrlich angesehen werden darf.« Theologische Literaturzeitung »Bereits der Aufbau der beiden Bände zeigt, dass sie für die Praxis geschrieben sind. Für bestimmte Themen sind die entsprechenden Abschnitte durch die sehr ausführlich und doch übersichtlich gestalteten Inhaltsverzeichnisse leicht aufzufinden. Die ausführlichen Register helfen, wenn nach bestimmten Personen oder antiken Autoren gesucht wird. Besonders hervorzuheben ist die glückliche Hand, welche die beiden Autoren bei der Auswahl der Texte bewiesen haben. Es wurde Wert auf repräsentative oder besonders pointierte Quellen gelegt. Die Auswahl der Themen und die dafür herangezogenen Belegstellen darf als sehr gut getroffen bezeichnet werden. Den Autoren gelingt es damit, all jenen eine brauchbare Arbeitsgrundlage zu liefern, die zu einer altkirchlichen Fragestellung Quellentexte benötigen.« Biblos »Eine hervorragende Dokumentation! In Band I werden Texte zur Verfolgung sowie zu Ansätzen einer Verständigung zwischen Heiden und Christen präsentiert und kommentiert, sowohl in theologischer wie pragmatischer Art. In Band II geht es um die Lebenssituationen in Familie, Ehe, Stellung zur Frau, Wirtschaft, Wissenschaft, Bildung, Theater, Feste, Bäder, Sklaverei, wobei beide Seiten zu Wort kommen. Die zahlreichen Originaltexte werden griechisch bzw. lateinisch und in (neuer) deutscher Übersetzung gebracht und mit jenen Kommentierungen versehen, die zum Verständnis nötig sind.« Das gute Buch in der Schule Eine »hervorragende Präsentation von Text-Ausschnitten aller Art über die Epoche des vorkonstantinischen Christentums. Die Sammlung ist besonders geeignet zur Einführung in dieses wichtige Gebiet der Geistesgeschichte ... Im Zentrum der klugen Auswahl (R. Klein) stehen bekannte und weniger bekannte Texte, welche ein Licht werfen können auf das Verhältnis des Christen zum Staat oder zur Gesellschaft ... Aus NT, Apokryphen, Apologeten, Akten, Kommentaren, Predigten, historischen Werken, auch aus Papyri und Inschriften sind griechische und lateinische Text-Teilstücke ausgewählt und den wichtigsten Editionen entnommen worden, und P. Guyot hat eine gut lesbare, genaue Übersetzung beigesteuert. Das ›Zerschneiden‹ der Texte macht es notwendig, dass der Leser Erklärungen über den Zusammenhang und die Eigenheiten der verschiedenen Autoren erhält: diese Wünsche erfüllt R. Klein, ein bewährter Philologe und Althistoriker, durch einen reichhaltigen Kommentar, durch konzise Kurzbiographien der antiken Verfasser und durch zwei Bibliographien. Die Textsammlung könnte heute oft eine kleine ›Bibliothek‹ ersetzen.« Museum Helveticum Dieses Werk ist »ein wahres Muster an Informationsreichtum, Akribie und literatur- und geistesgeschichtlichem Rundblick und unverzichtbarer Bestandteil jeder altertumskundlichen Bibliothek.« (Gymnasium) »Die vorliegende Quellensammlung ist für Studierende wie für Forschende ein nützliches Arbeitsinstrument. Die Dokumentation eröffnet wieder einen Weg ›ad fontes‹.« (Gnomon) Inhaltsverzeichnis
Einführung 1
A. Verfolgungen Das Schema der zehn Verfolgungen (Augustinus, civ. Dei XVIII 52) 10 1. Nero (54-68) 16 a) Der Brand Roms und die Christen (Tacitus, ann. XV 44,2-5) 16 b) Todesurteile gegen die Christen (Sueton, Nero 16,2) 18 c) Tod der Apostel Petrus und Paulus in Rom (l Clem. 5-6) 18 d) Frühester Hinweis auf die Gräber von Petrus und Paulus (Eusebius, hist. eccl. II 25) 20 e) Verschwinden und Wiederkehr des Verfolgers (Laktanz, mort. pers. 2,5-9) 22 2. Domitian (81-96) 24 a) Das Einschreiten gegen Angehörige der römischen Oberschicht (Sueton, Domit. 10,2; 15,1 - Cassius Dio LXVII 14,1-2 - Eusebius, hist. eccl. III 18,4) 24 b) Das Problem des Fiscus ludaicus (Sueton, Domit. 12,2) 26 c) Unglück und Drangsal in Rom (l Clem. 1,1; 7,1) 26 d) Das Verhör der Davididen (Eusebius, hist. eccl. III 19-20) 26 e) Die Verbannung des Johannes nach Patmos (Eusebius, hist. eccl. III 17; 18,1) 30 f) Apokalyptische Visionen (Apocalypsis loannis 13; 17) 30 g) Domitian, ein halber Nero (Tertullian, apol. 5,4) 34 h) Die verdiente Strafe des Tyrannen (Laktanz, mort. pers. 3,1-5) 36 3. Trajan (98-117) und Hadrian (117-138) 38 a) Die Anfrage des Statthalters Plinius (Plinius, ep. X 96) 38 b) Die Antwort Trajans (Plinius, ep. X 97) 42 c) Ein christliches Urteil über die kaiserliche Antwort (Tertullian, apol. 2,6-9) 42 d) Das Reskript Hadrians an den Statthalter Minicius Fundanus (Eusebius, hist. eccl. IV 9,1-3) 44 4. Marc Aurel (161-180) 46 a) Die „neuen Gesetze" gegen die Christen (Melito bei Eusebius, hist. eccl. IV 26, 5-6) 46 b) Gesetze gegen Religionsfrevler (Digesta 1,18,13; 48,13,4,2; 48,19,13 - Sententiae Pauli 5,21,2) 46 c) Der Senatsbeschluß über die Herabsetzung der Gladiatorenpreise (Aes Italicense I 56-58) 48 d) Das Martyrium Polykarps von Smyrna (Martyrium Polycarpi 1-21) 48 e) Der Prozeß gegen Justin und seine Gefährten (Acta Justini 1-6) 64 f) Die Märtyrer von Lyon (Brief der Gemeinden von Lyon und Vienne bei Eusebius, hist. eccl. V l, 3-63) 70 g) Der Prozeß gegen die Märtyrer von Scili (Acta Martyrum Scilitanorum 1-17) 90 5. Septimius Severus (193-211) 96 a) Ein angebliches Edikt gegen die Christen (Historia Augusta, Sept. Sev. 16,8-17,1) 96 b) „Herrliche Martyrien" in Alexandria (Eusebius, hist. eccl. VI l; 2,2-4) 96 c) Kampf um die christlichen Friedhöfe in Karthago (Tertullian, Scap. 3,1; 5) 98 d) Das Leiden von Perpetua und Felicitas (Passio Perpetuae et Felicitatis 1-6; 7, 9; 15-21) 98 6. Maximmus Thrax (235-238) 118 a) Ein angebliches Edikt gegen die Kleriker - Befürchtungen in Palästina (Eusebius, hist. eccl. VI 28) 118 b) Verbannungen in Rom (Catalogus Liberianus) 118 c) Das Martyrium Hippolyts (Damasus, epigr. 35 Ferrua) 120 d) Heimsuchungen in Kleinasien (Cyprian, ep. 75,10) 120 7. Decius (249-251) 124 a) Zwei Opferbescheinigungen aus Ägypten (Nr. 6 und 23 Meyer) 124 b) Das Schicksal der Abtrünnigen (Cyprian, ep. 30,3) 124 c) Der Ruhm der Eingekerkerten (Cyprian, ep. 37,2) 128 d) Ein Rückblick nach dem Ende der Leiden (Cyprian, de lapsis 1-6; 25) 130 c) Die Bedrängnis in Alexandria (Eusebius, hist. eccl. VI 41-42,4) 138 f) Das Schicksal des Verfolgers (Laktanz, mort. pers. 4,1-3) 146 8. Valerian (253-260) 148 a) Das erste Edikt (Eusebius, hist. eccl. VII 11,2-11) 148 b) Das zweite Edikt (Cyprian, ep. 80) 150 c) Der Märtyrertod Cyprians (Acta Proconsularia S. Cypriani 1-5) 154 d) Das unrühmliche Ende des Verfolgers (Laktanz, mort. pers. 5) 158 c) Das Toleranzedikt des Gallienus (Eusebius, hist. eccl. VII 13) 160 9. Aurelian (270-275) 164 a) Der Plan einer Verfolgung (Eusebius, hist. eccl. VII 30,20-21) 164 b) Der frühe Tod des Kaisers verhindert die Ausführung (Laktanz, mort. pers. 6) 164 10. Diokletian und seine Mitregenten (284-305) 166 a) Die Hinrichtung des Soldaten Maximilianus (Acta Maximiliani) 166 b) Ursachen, Vorspiel und Ausbruch der Verfolgung (Laktanz, mort. pers. 10-15) 170 c) Das erste Edikt (Eusebius, hist. eccl. VIII 2, 4-5) 178 d) Das zweite und dritte Edikt (Eusebius, hist. eccl. VIII 6, 7-10) 178 e) Das vierte Edikt (Eusebius, märt. Pal. 3,1) 180 f) Der Märtyrertod der römischen Kleriker Marcellinus und Petrus (Damasus, epigr. 28 Ferrua) 180 g) Verbannung einer ägyptischen Christin (Papyrus Grenfell II, 73) 182 h) Das erste Edikt des Maximinus Daja (306) (Eusebius, märt. Pal. 4,8) 182 i) Das zweite Edikt des Maximinus Daja (309) (Eusebius, märt. Pal. 9,2) 182 k) Das Tyrosreskript des Maximinus Daja (Eusebius, hist. eccl. IX 7,3-14) 184 1) Das Toleranzedikt des Galerius (311) (Laktanz, mort. pers. 34) 188 B. Ansätze zu einer Verständigung 1. Grundsätzliche Anerkennung der kaiserlichen Herrschaft 194 a) Die Gehorsamsforderung des Apostels Paulus (Paulus, Rom. 13,1-7; 11) 194 b) Erste Berufung auf die paulinische Forderung (Irenaeus, adv. haer. V 24,1-3) 194 c) Der Kaiser ist von Gott eingesetzt (Tertullian, Scap. 2,5-10) 198 d) Gehorsam für den Kaiser, Verehrung für Gott (Tertullian, Idol. 15,3) 200 e) Auch gegen die ungerechte Staatsgewalt ist kein aktiver Widerstand erlaubt (Hippolyt, comm. in Dan. III 23) 202 f) Kein Schwur bei der Tyche des Kaisers (Origenes, contra Celsum VIII 63; 65; 67 gekürzt) 202 g) Gehorsam gegen die Gesetze, Furcht vor Gott (Origenes, comm. in ep. ad Rom. IX 28-30 gekürzt) 206 2. Das Gebet für den Kaiser 210 a) Die Mahnung des Apostels Paulus (Paulus, l Tim. 2,1-4) 210 b) Früher Bestandteil im Gottesdienst (l Clem. 61) 210 c) Gebet um kaiserliche Besonnenheit (Justin, apol. I 17) 212 d) Gebet für die Weltherrschaft Roms (Athenagoras, suppl. 37) 212 e) Gebet um kaiserliche Gerechtigkeit (Theophilus, Autol. I 11) 214 f) Gebet für den Fortbestand des Reiches (Tertullian, apol. 30,1-4, 7; 31; 32,1; 33) 214 g) Gebet auch für die Verfolger (Arnobius, adv. nat. IV 36) 218 3. Das Römische Reich im heilsgeschichtlichen Denken der Christen 222 a) Christliche Religion und augusteisches Fnedensreich im Heilsplan Gottes (Melito bei Eusebius, hist. eccl. IV 26, 7-11) 222 b) Die Christen sind die besten Stützen der Kaiserherrschaft (Justin, apol. I 12,1-8) 224 c) Eine Zukunftsvision - ein christliches Römerreich (Origenes, contra Celsum VIII 69-70) 226 d) Rom, das letzte der fünf Weltreiche (Tertullian, nat. II 17, 18-19) 228 e) Gott allein teilt die Herrschaft zu (Tertullian, apol. 26,1-3) 230 f) Das Christentum erfüllt die ganze Welt (Tertullian, adv. lud. 7,4-9) 232 g) Das Römische Reich als Hemmnis für den Antichrist (Tertullian, resurr. 24,17-18) 234 h) Die Herrschaft des Antichrist ist noch nicht angebrochen (Hippolyt, comm. in Dan. IV 8-10) 234 i) Rom, das letzte der irdischen Reiche (Laktanz, div. inst. VII 15) 238 4. Die Mitarbeit von Christen im römischen Staat 246 a) Die christliche Lebensform (Epistula ad Diognetum 5) 246 b) Die rasche Ausbreitung (Tertullian, apol. 37,4-5) 248 c) Christliche Freigelassene am Hof des Septimius Severus (Tertullian, Scap. 4,5-6) 248 d) Mitarbeit nur bei gänzlicher Vermeidung des Götzendienstes (Tertullian, idol. 17) 250 e) Übernahme ziviler und militärischer Ämter in der Friedenszeit nach dem Gallienus-Edikt (Eusebius, hist. eccl. VIII 1,1-7) 252 f) Marcus Aurelius Prosenes, ein christlicher Freigelassener am Kaiserhof (Diehl, ILCV I 3332) 254 g) Liberalis, Konsul und Märtyrer (Diehl, ILCV I 56; 57) 254 h) Julianus Severianus, vir clarissimus (Diehl, ILCV I 1583) 256 i) Julius Nestorianus, ein Senator (MAMA I 170) 256 k) Asturius, ein Senator (Eusebius, hist. eccl. VII 16) 258 l) Apollonius, Senator und Märtyrer (Hieronymus, vir. ill. 42) 258 m) Ein heidnisches Angebot (Origenes, contra Celsum VIII 75) 260 5. Kontakte führender Vertreter beider Religionen 262 a) Die Bekehrung des Prokonsuls Sergius Paulus von Cypern (Actus Apostolorum 13,4-12) 262 b) Kaiser Severus Alexander, ein Freund der Christen? Die kaiserliche Hauskapelle (Historia Augusta, Sev. Alex. 29,1-2) 262 Ein Tempel für Christus? (Ibid. 43,5-7) 264 Die Bischofsernennung, ein Vorbild für weltliche Beamte? (Ibid. 45,6-7) 264 Entscheidung zugunsten der Christen in einem Grundstücksstreit? (Ibid. 49,6) 266 Die Goldene Regel als Leitspruch? (Ibid. 51,7-8) 266 c) Eine ehrenvolle Einladung für Origenes nach Arabien (Eusebius, hist. eccl. VI19,12-15) 266 d) Origenes am Kaiserhof in Antiochia (Eusebius, hist. eccl. VI 21, 2-4) 268 e) Der rege Briefwechsel des Origenes (Eusebius, hist. eccl. VI 36, 3) 268 f) Philippus Arabs, der erste christliche Kaiser? (Eusebius, hist. eccl. VI 34) 270 g) Kaiserliche Hilfe gegen den „Ketzer" Paulus von Samosata (Eusebius, hist. eccl. VII 30,6-9, 18-19) 270 6. Übernahme profaner Rechts- und Verwaltungsformen 274 a) Frühe Ansätze in der korinthischen Gemeinde (l Clem. l ,3) 274 b) Kollegiale Bischofswahl in Alexandria (Hieronymus, ep. 146,1) 274 c) Aus dem Protokoll der Bischofssynode von Karthago vom l. September 256 (Sententiae LXXXVII episcoporum, v. Soden S. 247ff.) 274 d) Das bischöfliche Wahlverfahren in Karthago (Cyprian, ep. 67,1-6) 278 e) Das bischöfliche Zivilgericht (Didascalia Apostolorum II 45-52) 286 Kommentar A. Verfolgungen 301 B. Ansätze zu einer Verständigung 415 Kurzbiographien der antiken Autoren 475 Literatur 479 Register 503 1. Bibelstellen 503 2. Personennamen 507 Leseprobe c) Beteiligung der Christen an Wirtschaft und Handel Tertullian, Apologeticum 42, 1 – 3; 8 – 9 »(1) Aber auch noch aufgrund eines anderen Anklagepunkts, euch Schaden zuzufügen, zieht man uns immer noch zur Rechenschaft: wir sollen nämlich für den Handel unnütz sein. Auf welche Weise wäre das denn möglich, da wir doch Menschen sind, die mit euch zusammenleben, dieselbe Nahrung, Kleidung und Bildung haben und dieselben lebensnotwendigen Bedürfnisse? Denn wir sind ja keine Brahmanen oder indische Gymnosophisten, Waldbewohner und lebensflüchtige Menschen. (2) Wir denken daran, dass wir Gott, unserem Herrn und Schöpfer, Dank schulden; die Nutzung keines der Dinge, die er geschafften hat, lehnen wir ab, nur üben wir entschiedene Zurückhaltung, um sie nicht maßlos oder falsch zu gebrauchen. Demnach wohnen wir nicht ohne euer Forum, nicht ohne euren Markt, nicht ohne eure Bäder, Läden, Werkstätten, Gasthöfe, Wochenmärkte und ohne die übrigen Plätze, wo Handel getrieben wird, in dieser Welt mit euch zusammen. (3) Mit euch zusammen fahren auch wir zur See, leisten Militärdienst, betreiben Landwirtschaft und Handel; in gleicher Weise lassen wir unsere handwerklichen Fertigkeiten euch zugutekommen, und unsere Erzeugnisse stellen wir euch zu allgemeinem Gebrauch zur Verfügung. Warum wir als unnütz für euren Handel erscheinen, die wir doch mit und von euch leben, verstehe ich nicht. (8) ›Zweifellos‹, sagt ihr, ›werden die Einnahmen der Tempel von Tag zu Tag geringer; wie wenige sind es denn noch, die Spenden hineinwerfen?‹ Wir sind nämlich außerstande, sowohl den Menschen als auch euren Göttern, diesen Bettlern, zu helfen, und wir glauben auch nicht, dass man anderen als denen, die darum bitten, etwas schenken sollte. Kurz gesagt, Jupiter soll doch seine Hand ausstrecken, und er soll empfangen, während unterdessen unsere Barmherzigkeit auf den Straßen mehr ausgibt als eure Religion in den Tempeln. (9) ›Aber die übrigen Steuereinnahmen werden weniger.‹ Es genügt, wenn diese übrigen Einnahmen den Christen dafür dankbar sind, dass sie ihre Schuld mit der gleichen Gewissenhaftigkeit bezahlen, mit der wir uns auch hüten, fremdes Eigentum zu unterschlagen, so dass man, wenn man berechnen wollte, wieviel den Steuern verlorengeht durch Betrug und von euch gefälschte Zensuslisten, leicht eine ausgeglichene Rechnung erhalten könnte, da die Klage über den Missstand in dem einen Fall aufgewogen wird durch die Sicherheit, mit der die übrigen Arten von Steuern von uns bezahlt werden.« (aus: Wirtschaft u. Berufsleben) |
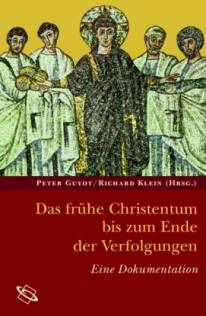
 Bei Amazon kaufen
Bei Amazon kaufen