|
|
|
Umschlagtext
Kaiser Konstantins Hinwendung zum Christentum hatte weitreichende Folgen sowohl für das Römische Imperium als auch das aufstrebende Christentum. Neben die traditionelle Autorität der Kaiser traten zunehmend die Führer der jungen Kirche, die Bischöfe. Beide Institutionen verantworten ab der Mitte des 4. Jahrhunderts weitgehend die Reichspolitik, die Staat und Kirche in eine Beziehung zwischen Kooperation und Machtkampf bringt und ihr Verhältnis zueinander in den folgenden Jahrhunderten prägen wird.
Das Buch liefert einen neuen Blick auf das Ende des Imperiums und den Aufstieg des Christentums. Die Kaiser waren nicht mehr Gott ebenbürtig, sondern Diener , und das nur dann, wenn sie der Kirche dienten. Am Ende war die Kirche Erbe des Römischen Imperiums und der Bischof von Rom (später Papst genannt) in der Nachfolge der Cäsaren Mittelpunkt nicht nur der christlichen Welt. Der Autor, bekannter und anerkannter Experte, zeichnet ein faszinierendes Bild der Epoche und spannt den Bogen durch eines der längsten Jahrhunderte der europäischen Geschichte. Pedro Barcelo, geboren 1950 in Vinaros/Spanien, ist Professor für Alte Geschichte an der Universität Potsdam. Studium derf Geschichte und Germanistik in Freiburg; 1980 Promotion; 1986 Habilitation in Eichstätt. 1992 Ruf an die Universität Erfurt, seit 1993 lehrt er an der Universität Potsdam. Forschungsschwerpunkte: Karthago, spätantike Kultur- und Religionsgeschichte. Rezension
In der Wahrnehmung vieler Zeitgenossen und wohl auch des schulischen Unterrichts bleibt die Spätantike oftmals hinter der klassischen Antike zurück. Insbesondere aber die umwälzenden Ereignisse ab dem 3. Jhdt. n. Chr. prägen wie kaum eine andere Epoche unsere christlich-abendländische Kultur. Die Religion in der Spätantike wird intensiv erforscht, - nicht nur, weil sich hier große religionspolitische Ereignisse vollziehen wie z.B. die Konstantinische Wende oder die Christenverfolgungen, sondern auch, weil sich in der Spätantike Konstellationen herausbilden, die z.T. bis in die Neuzeit prägend bleiben für die abendländische Religions- und Kulturgeschichte. Eine dieser prägenden Konstellationen ist das Verhältnis von Kaiser und Bischöfen, von weltlicher und religiöser Herrschaft, in Einigkeit, aber auch in Widerstreit - bis hin zum sog. Investiturstreit im Hochmittelalter und zur Frage nach weltlichem und geistlichem Regiment in der Reformationszeit. Die sog. Konstantinische Wende führt zur fortan prägenden christlichen Durchdringung von Kultur, Gesellschaft und Staat im Abendland.
Jens Walter, lehrerbibliothek.de Verlagsinfo
Pedro Barceló, Prof. Dr. Dr. h.c., geb. 1950 in Vinaròs (Spanien), ist Professor für die Geschichte des Altertums und Direktor des Histori-schen Instituts der Universität Potsdam. Von der Universität Carlos III de Madrid erhielt er die „Catedra de Excelencia“, eine zeitlich befristete Berufung international herausragender Forscher. Inhaltsverzeichnis
Vorwort 9
Einleitung 13 I. Vorgeschichte: Bündnisse der Kaiser Valerian und Diocletian mit der traditionellen Religion 19 1. Bürgerverband als Kultgemeinschaft 19 2. Kultische Identitäten in der Krise 24 3. Das tetrarchische Experiment 30 4. Zwischen Legitimationsdruck und Ausnahmezustand 31 5. Vom Versammlungsraum zur Kirche - Symbol einer Metamorphose 34 II. Constantin und sein Gott - Eingliederung des Christuskults in den römischen Staat 39 1. Vision und Aneignung 39 2. Wechselnde Herrschaftsideologien 42 3. Warum Christus? 46 4. Folgen der Parteinahme 50 III. Die Stunde der Bischöfe 53 1. Zur Bedeutung des Bischofsamts 53 2. Die Synoden von Rom (313) und Arles (314) 57 3. Klerikales Selbstbewusstsein 58 4. Das Konzil von Nicaea (325) 60 5. Welcher Platz gebührt dem Kaiser in der Kirche? 64 IV. Diskurs über das Göttliche - Christliche Potentaten im Wettstreit um die theologische Deutungshoheit 69 1. Machtkämpfe: Eusebios, Athanasios und Constantin 69 2. Athanasios zwischen Constans und Constantius II. 73 3. Die Synode von Serdica (343) 76 4. Verpasster Ausgleich: Die Synoden von Arles (353) und Mailand (355) 78 5. Dogmatische Sonderwege 80 6. Die Synode von Sirmium (358) 81 7. Kaiserliche Autokratie: Die Synoden von Rimini (359), Seleukia (359) und Constantinopel (360) 83 V. Sakralkunst als Spiegel des religiösen Wandels 89 1. Vom schwierigen Umgang mit Christusdarstellungen 89 2. Christliche Sakralbauten 96 VI. Verspäteter Weckruf - Julians heidnische Restauration 101 1. Religionspolitische Antagonismen 101 2. Anspruch und Scheitern des Julianischen Programms 103 VII. Entzauberung der Tradition - Von der Göttlichkeit zur Gottesnähe der Imperatoren 111 1. Henotheistische und monotheistische Kultoptionen 111 2. Herrscherverehrung als Relikt der Machtinszenierung 116 3. Christliche Einstellungen zum Kaiserkult 120 VIII. Erzwingung der Rechtgläubigkeit 129 1. Machtbewusstsein kirchlicher Amtsträger 129 2. Ambrosius, Symmachus, Gratian und Valentinian II. 134 3. Theodosius und die Verordnung der Glaubenseinheit 138 4. Theodosius und Ambrosius 141 5. Von heidnischen und christlichen Herrschern 146 IX. Zerfall der religiösen Autorität des Kaisertums 155 1. Verlust richterlicher und militärischer Kompetenzen 155 2. Schwindendes religiöses Charisma 158 3. Demontage der Kaisermacht im Westreich 161 4. Ivlerikalisierung der Kirchenpolitik 164 X. Monophysiten gegen Dyophysiten 171 1. Theodosius II., Pulcheria, Athenais, Nestorios und Kyrill 171 2. Von der „Räubersynode von Ephesos" (449) zum Konzil von Chalkedon (451) 175 3. Anatomie der Kirchenspaltung: Eine Brücke zum Islam? 178 Nachwort 183 Anmerkungen 185 Quellenverzeichnis 204 Literatur in Auswahl 206 Namensregister 218 Bildnachweis 220 |
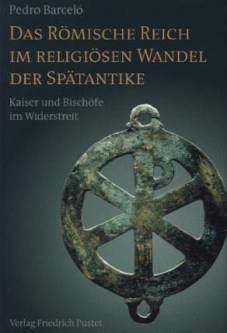
 Bei Amazon kaufen
Bei Amazon kaufen