|
|
|
Umschlagtext
In der fachdidaktischen Diskussion über den Deutschunterricht herrscht trotz unterschiedlicher Positionen weitgehend Einigkeit darüber, dass die Förderung des Lesens - auch des Lesens von Büchern - und die Befähigung zur Auseinandersetzung mit Gelesenem wichtige Zielsetzungen sind, deren Erreichung wesentlich von den Inhalten des Unterrichts und (mehr noch) von den gewählten Methoden abhängig ist. In diesem Zusammenhang wird häufig die Empfehlung gegeben, von den Schülerinnen und Schülern ein Lesetagebuch erstellen zu lassen, das begleitend zum Lesen geschrieben und gestaltet wird. Die Erforschung dieses Verfahrens, die Entfaltung der möglichen Bedeutung für den Umgang mit Büchern im Deutschunterricht und praxisnahe Tipps für die Umsetzung sind Gegenstand der vorliegenden Arbeit.
Im ersten Teil geht es um grundlegende Aspekte des Lesens, speziell des Lesens von Kinder- und Jugendliteratur im Deutschunterricht, verbunden mit Überlegungen zum produktiven Umgang mit Gelesenem, zum schreibdidaktischen Kontext und zu geöffnetem Unterricht. Im Anschluss daran gibt der zweite Teil einen problemgeschichtlichen Überblick zum Lesetagebuch und seinen unterschiedlichen Verwendungszusammenhängen. Der dritte Teil beschäftigt sich mit dem Begriff Lesetagebuch und entfaltet, welche Bedeutung das Tagebuchschreiben für die Schreiberinnen und Schreiber haben kann. Der umfangreiche vierte Teil enthält die Inhaltsanalyse konkreter Lesetagebücher, die von niedersächsischen Schülerinnen und Schülern der Klassen 5 bis 10 im Deutschunterricht begleitend zum Lesen von Jugendbüchern angefertigt wurden und als Dokumente der individuellen Auseinandersetzung mit dem jeweils gelesenen Buch anzusehen sind. Die bei der Untersuchung festgestellten Auseinandersetzungsweisen werden gebündelt und kategorisiert. Zusammenfassend wird begründet, dass das Lesetagebuch eine geeignete Methode zur Auseinandersetzung mit Kinder- und Jugendbüchern im Deutschunterricht ist. Im letzten Teil werden didaktische Perspektiven für den Einsatz von Lesetagebüchern im Unterrichtentfaltet, die in der Neuformulierung eines Handzettels mit Anregungen für Schülerinnen und Schüler konkretisiert werden. Die Autorin: Ingrid Hintz, Dr. phil., bis 1995 Lehrerin, danach Wiss. Angestellte, jetzt Akademische Rätin am Institut für Deutsche Sprache und Literatur der Universität Hildesheim. Dort wirkt sie in der Lehrerausbildung für das Lehramt an Grund-, Haupt- und Realschulen mit. Ihre besonderen Schwerpunkte sind die Lese- und Schreibdidaktik und die Kinder- und Jugendliteratur. Rezension
Die Förderung des Lesens, auch des Lesens von Büchern, und die Befähigung zur Auseinandersetzung mit Gelesenem bilden wichtige Zielsetzungen des Deutschunterrichts. Das Lesetagebuch als eine Methode des Lese- und Literaturunterrichts kann dabei eine nützliche Hilfe sein. Ein Lesetagebuch ist ein Tagebuch, das parallel zur Lektüre eines meist literarischen Textes geführt wird und in das Einträge unterschiedlichster Art vorgenommen werden können. Neben der Zusammenfassung von Textpassagen und Hauptaussagen bietet das Lesetagebuch Raum für persönliche Leseeindrücke, die Formulierung von Leseproblemen und Assoziationen. Ziel ist es, persönliche Zugänge vor allem zu Romanen zu ermöglichen. Schüler bekommen die Möglichkeit, unterschiedliche Zugänge zu Texten zu finden und vor allem ein eigenes Arbeitstempo beim Umgang mit Literatur zu finden.
Thomas Bernhard, lehrerbibliothek.de Inhaltsverzeichnis
Vorwort der Reihenherausgeber VII
Vorwort X Vorwort zur 3. Auflage XI Einleitung 1 1 Lesen im Deutschunterricht 8 1.1 Lesen - eine erkundungsbedürftige und förderungswürdige Tätigkeit 8 1.1.1 Lesevorgang und Lesebedeutung 11 1.1.2 Lesen - Sinn entnehmen oder konstituieren? 15 1.1.3 Lesesozialisation - privates und schulisches Lesen 18 1.2 Kinder-und Jugendliteratur im Unterricht 23 1.2.1 Was ist Kinder- und Jugendliteratur? 24 1.2.2 Wirkungsweisen und Bedeutung von Kinder- und Jugendliteratur 27 1.3 Didaktisch-methodische Aspekte des Lesens 32 1.3.1 Lese- und literaturdidaktische Überlegungen zur Kinder- und Jugendliteratur 34 1.3.2 Geöffneter Unterricht als Rahmenbedingung 42 1.3.3 Produktiver Umgang mit Literatur als methodisches Konzept 47 1.3.4 Schreibdidaktische Implikationen 51 1.3.5 Integrative Verbindung von Lesen und Schreiben 56 1.4 Zusammenfassung 60 2 Das Lesetagebuch - vom Untersuchungsmittel zur Unterrichtsmethode 62 2.1 Vorläufer des Lesetagebuchs in der Jungleserforschung 62 2.2 Forschungen mit Hilfe des Lesetagebuchs 64 2.3 Lesetagebücher im Deutschunterricht 67 2.3.1 Das Lesetagebuch als Mittel zur Dokumentation gelesener Bücher und zur Auseinandersetzung mit ihnen 68 2.3.1.1 Erfahrungen mit dem Lesetagebuch im Rahmen der literarischen Erziehung 68 2.3.1.2 Förderung und Intensivierung des privaten und schulischen Lesens mit Hilfe des Lesetagebuchs 70 2.3.2 Das Lesetagebuch als Methode im Umgang mit Kinder- und Jugendliteratur im Deutschunterricht 74 2.3.2.1 Lesetagebuch und Bücher-Lesen 76 2.3.2.2 Das Lesetagebuch als Schreibanlass 78 2.3.2.3 Das Lesetagebuch im'offenen'Unterricht 79 2.4 Der gegenwärtige Diskussionsstand 83 3 Zum Begriff 'Lesetagebuch' 86 3.1 Tagebuch - Begriff und Bedeutung 86 3.2 Tagebuchschreiben bei Schriftstellern 88 3.3 Warum Lesetagebuch? 90 4 Lesetagebücher - Analyse und Interpretation 93 4.1 Methodologische Überlegungen 93 4.1.1 Zum erkenntnisleitenden Interesse der Untersuchung 93 4.1.2 Zur Methode der Untersuchung: Inhaltsanalyse als Forschungsansatz 96 4.1.3 Beschreibung und Begründung des methodischen Vorgehens 100 4.2 Quantitative Erfassung ausgewählter Lesetagebücher 103 4.2.1 Angaben zu den untersuchten Lesetagebüchern 103 4.2.2 Quantitative Erfassung der Inhalte ausgewählter Lesetage bücher 108 4.2.2.1 Erläuterung der Anregungen auf dem Handzettel 111 4.2.2.2 Quantitative Erfassung der Inhalte 118 4.2.2.2.1 Aufgreifen der Anregungen 118 4.2.2.2.2 Umsetzung eigener Ideen 122 4.2.2.3 Ermittlung des'Mischungsverhältnisses'der Inhalte 130 4.2.3 Erste Kategorisierung von Auseinandersetzungsweisen 135 4.3 Qualitative Inhaltsanalyse ausgewählter Lesetagebücher 139 4.3.1 Hinweise zur Analyse von Auseinandersetzungsweisen 140 4.3.2 Lesetagebücher mit'freier'Aufgabenstellung 142 4.3.2.1 Vanessas Lesetagebuch (Klasse 5 / LT33) 146 4.3.2.2 Kevins Lesetagebuch (Klasse 6 / LT44) 158 4.3.2.3 Amels Lesetagebuch (Klasse 7 / LT 159) 168 4.3.2.4 Kays Lesetagebuch (Klasse 7 / LT 165) 185 4.3.3 Beispiele aus weiteren Lesetagebüchern (Klasse 5 bis 10) 197 4.3.3.1 Fehldeutungen und Unstimmigkeiten 198 4.3.3.2 Reflexionen und Bewertungen 204 4.3.3.3 Imaginationen und Identifikationen 216 4.3.3.4 Kommunikation und Metakognition 226 4.3.4 Lesetagebücher mit'vorstrukturierter'Aufgabenstellung 235 4.3.4.1 Beispiele mit Pflichtteil und Extras (Klasse 8) 235 4.3.4.2 Beispiele mit buchbezogenen Aufgabenkarten (Klasse 9) 242 4.4 Zusammenfassung und Kategorisierung von Auseinandersetzungsweisen 253 5 Didaktische Perspektiven 268 5.1 Organisationsrahmen und Unterrichtsgestaltung 269 5.2 Beraten - Begleiten - Beurteilen 271 5.3 Neuformulierung von Anregungen undTipps 278 Skizze: Varianten der Lesetagebucharbeit 281 Verzeichnis der Übersichten und Tabellen 282 Literaturverzeichnis 283 Weitere Titel aus der Reihe Deutschdidaktik aktuell |
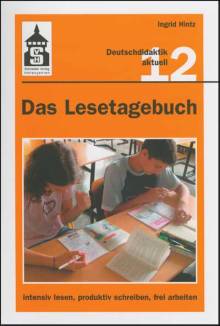
 Bei Amazon kaufen
Bei Amazon kaufen