|
|
|
Umschlagtext
Wie kann man die Borderline-Störung verstehen?
Welche Konzepte eignen sich dafür? Borderline-Patienten entwickeln - genau wie Patienten mit neurotischen Störungen - ein konsistentes Muster zueinander passender Modi des Denkens, der Gefühle, des Handelns, der Symptome, der Objektbeziehungen und der Abwehr. Verschiedene «Borderline-Stile» werden herausgearbeitet: • der impulsive und der paranoide Stil • die Vermeidung von Ambivalenz und Ambiguität • der primärprozesshafte und präoperationale Stil. In die zweite Auflage des Buches ist eine Fülle neuer Forschungsergebnisse eingeflossen - zur Phänomenologie und Psychodynamik der Affekte, zu Weiterentwicklungen der Diagnostik und der therapeutischen Konzepte und zur Wirksamkeit psychodynamischer Therapie. Das Buch vermittelt eine ganzheitliche Sichtweise der Borderline-Störung und verbindet wie kein anderes moderne psychoanalytische Theorie, kognitive Psychologie und empirische Forschungsmethodik. Interessenten: Psychiater, Psychoanalytiker, Psychotherapeuten, Klinische Psychologen, Pädagogen, Forschende im Bereich der Psychotherapie und der Psychologie. Rezension
Die Literatur über Borderline ist mittlerweile Legion, sogar innerhalb des Verlags selbst. Wo liegt nun das Spezifische dieses Buchs? Zum einen verbindet es schul-übergreifend psychoanalytische wie kognitive Methodiken, zum anderen ist es auf eine ganzheitliche Sichtweise der Borderline-Störung aus, indem typische, immer wiederkehrende "Muster" bzw. Stile der Ratio, der Emotion und des Handelns von Borderline-Patienten aufgezeigt und in verschiedene "Borderline-Stile" ausdifferenziert werden. Das hilft, die Störung einerseits und den konkreten Patienten andererseits besser zu verstehen. Borderline-Störungen gelten als besonders therapie-resistent. Suizidgefährdung, Therapieabbrüche, Schwierigkeiten im Umgang mit Borderline-Patient/inn/en, frustrane Behandlungsversuche u.a. machen die Therapie besonders schwierig. Zugleich sind Borderline-Patient/inn/en nicht selten besonders interessante und kreative Menschen. Deshalb erweist sich eine schulenübergreifende Zugangsweise, wie in diesem Buch als in besonderer Weise sinnvoll. Das vorliegendeBuch widmet sich deshlab primär der Erfassung aktueller Forschungsergebnisse und versucht, die bestehenden Konzepte, Therapieformen und insbesondere Stile voneinander abzugrenzen. Borderline-Betroffene sind nicht sonderlich eindeutig zu charakterisieren. Da Borderliner von ganz unterschiedlichem Naturell sein können, reicht ein Konzept nicht aus, um die Vielfältigkeit dieser Störung angemessen zu behandeln. Die Gemütszustände der Patienten reichen vom Gefühl chronischer Leere über Ängstlichkeit bis hin zu unbändigem Zorn. Das Konzept der Borderline-Persönlichkeitsstörung (Gunderson) wird unterschieden von dem der Borderline-Schizophrenie und dem der Borderline-Persönlichkeits-Organisation (Kernberg), das die Störung als eine Kombination von verschiedenen Symptomen versteht.
Jens Walter, lehrerbibliothek.de Verlagsinfo
Das bekannte, für die Neuauflage aktualisierte Buch verbindet wie kein anderes moderne psychoanalytische Theorie, kognitive Psychologie und empirische Forschungsmethodik. Die verschiedenen "Borderline-Stile" und daraus ableitbaren Interventionsstrategien werden dargestellt. Wie kann man die Borderline-Störung erklären? Welche Konzepte eignen sich dafür? Wie Patienten mit neurotischen Störungen, so entwickeln auch Borderline-Patienten ein konsistentes Muster zueinander passender Modi des Denkens, der Gefühle, des Handelns, der Symptome, der Objektbeziehungen und der Abwehr. Verschiedene «Borderline-Stile» werden herausgearbeitet: der impulsive und der paranoide Stil, die Vermeidung von Ambivalenz und Ambiguität sowie der primärprozesshafte Stil. In die zweite Auflage des Buches ist eine Fülle neuer Forschungsergebnisse eingeflossen - zur Phänomenologie und Psychodynamik der Affekte, zu Weiterentwicklungen der Diagnostik und der therapeutischen Konzepte und zur Wirksamkeit psychodynamischer Therapie. Das Buch vermittelt eine ganzheitliche Sichtweise der Borderline-Störung und verbindet wie kein anderes moderne psychoanalytische Theorie, kognitive Psychologie und empirische Forschungsmethodik. Inhaltsverzeichnis
1. Einleitung 7
2. Aktuelle Konzepte der Borderline-Störung 11 2.1 Borderline-Schizophrenie 11 2.2 Borderline-Persönlichkeitsstörung nach Gunderson 12 2.3 Borderline-Störung im DSM-III, DSM-III-R, DSM-IV und ICD-10 14 2.4 Kernbergs Konzept der Borderline-Persönlichkeitsorganisation 20 2.4.1 Deskriptive Merkmale: «Diagnostische Verdachtsmomente» 20 2.4.2 Strukturelle Kriterien 22 2.4.3 Unspezifische Anzeichen von Ich-Schwäche 22 2.4.4 Primärprozesshafte Denkformen 23 2.4.5 Primitive Abwehrmechanismen 23 2.4.6 Primitive Abwehrmechanismen, die zusammen mit der Spaltung auftreten 24 2.4.7 Genetisch-dynamische Merkmale 32 2.4.8 Strukturelle Diagnose und das «strukturelle Interview» 34 2.4.9 Empirische Untersuchungen zum Konzept der Borderline-Persönlichkeitsorganisation Kernbergs 36 2.4.10 Borderline-Persönlichkeitsstörungin Selbstbeurteilungsverfahren 40 2.4.11 Borderline-Persönlichkeits-Organisation im Rorschach-Test 45 2.4.12 Kritik am Konzept der Spaltung 46 2.4.13 Ein alternatives Konzept der Spaltung 48 2.4.14 Exkurs zur Verdrängung 49 2.4.15 Empirische Untersuchungen zur Spaltung 51 3. Therapeutische Konzepte der Borderline-Störung 57 3.1 Übertragungsfokussierte Therapie der Borderline-Persönlichkeits-Störung nach Kernberg 57 3.2 Dialektisch-Behaviorale Therapie nach M. Linehan 60 3.3 Zur Wirksamkeit psychodynamischer und kognitiv-behavioraler Therapie bei Borderline-Störungen 63 4. Borderline-Stile 69 4.1 Der «impulsive» Stil nach Shapiro 71 4.2 Der «paranoide» Stil nach Shapiro 75 4.3 Die Affekte bei Borderline-Patienten 78 4.3.1 Affekte bei Borderline-Störungen: Phänomenologie 78 4.3.2 Psychodynamik der Affekte bei Borderline-Störungen 80 4.3.3 Eine eigene empirische Untersuchung zu Affekten bei Borderline-Patienten und Schizophrenen 85 4.3.4 Abschließende Überlegungen zu Affekten bei Borderline-Patienten 91 4.4 Vermeiden von Ambivalenz und Ambiguität als kognitiv-affektiver Stil von Borderline-Patienten 93 4.4.1 Zusammenhänge zwischen dem Vermeiden von Ambiguität und Spaltung, primitiven Objektbeziehungen und Affekten 96 4.4.2 Vermeiden von Ambiguität bei Schizophrenen 100 4.4.3 Vermeiden von Ambiguität und weitere Konflikte 102 4.4.4 Vermeiden von Ambiguität als Persönlichkeitsfunktions-Stil auch unabhängig von Konflikten 103 4.4.5 «Zweiwertige Orientierung» 107 4.5 Primärprozesshaftes und präoperationales Funktionieren als kognitiv-affektiver Stil von Borderline-Patienten 110 4.5.1 Exkurs zum Konzept des Primärprozesses 110 4.5.2 Klinische Manifestationen primärprozesshaften Denkens 113 4.5.3 Die diagnostische Erfassung primärprozesshaften Funktionierens 116 4.5.4 Selbstbezug und Eigentümlichkeit 119 4.5.5 Selbstbezogenheit und Egozentrismus 122 4.5.6 Egozentrismus und bedürfnisbefriedigendes Objekt 126 4.5.7 Egozentrismus, Perspektivenübernahme und Empathie 127 4.5.8 Kontaminationen: Verschmelzungen von Objekten - Zusammenhänge mit primitiven Abwehrmechanismen und Objektbeziehungen 132 4.5.9 Kontaminationen, Objektpermanenz und Objektkonstanz 140 4.5.10 Fabulierte Kombinationen: zugrundeliegende Prozesse 141 4.5.11 Fabulierte Kombinationen, Spaltung und primitive Objektbeziehungen 142 4.5.12 Eigenwillige Logik 147 4.5.13 Resümee: präoperatives Funktionieren als kognitiv-affektiver Stil von Borderline-Patienten 149 4.6 Moralisches Urteil und Über-Ich-Pathologie: «heteronome Moral» 160 4.7 Borderline-Funktionsstile: Zusammenfassung 161 5. Therapeutische Ziele und Interventionen 165 Literatur 171 |
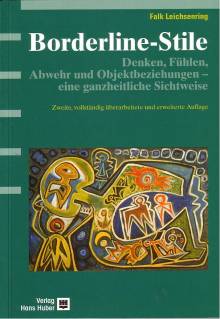
 Bei Amazon kaufen
Bei Amazon kaufen