|
|
|
Umschlagtext
Allein der Verweis auf die Theologie genügt in der modernen Gesellschaft sittliche Normen nicht mehr, sie bedürfen vernünftiger Begründungen, um angenommen zu werden. Was kann dann aber der christliche Glaube zur sittlichen Verwirklichung menschlicher Existenz noch beitragen und welche Rolle kann die Kirche dabei noch spielen?
In seinem erstmals 1971 erschienenen, berühmten Buch "Autonome Moral und christlicher Glaube" löst Alfons Auer (1915-2005) diese Problematik nicht so auf, dass er den ethischen Autonomieanspruch der Moderne theologisch diskreditiert - im Gegenteil "Die Autonomie des Sittlichen ist auch für den Theologen nicht nur ein möglicher, sondern [...] der einzig sinnvolle Ansatz." Auers lange vergriffenes und noch immer stark gefragtes Standardwerk, das Theologiegeschichte geschrieben hat, ist nun endlich wieder in unveränderter Form erhältlich. Die Ausgabe enthält auch den Nachtrag zur 2. Auflage von 1984, in dem Auer die kontroverse Rezeption seines Werkes thematisiert, sowie eine neue Einführung von Dietmar Mieth zu Auers Leben und Werk. "Alfons Auer hat mich während meines Studiums in Tübingen tief beeindruckt. Er zählt zu den großen Moraltheologen des 20. Jahrhunderts. "Autonome Moral und christlicher Glaube" gehört zu den wichtigsten Werken theologischer Ethik nach dem Zweiten Vatikanischen Konzil. Schön, dass es wieder erhältlich ist." Dr. Gebhard Fürst, Bischof, Rottenburg-Stuttgart Rezension
Immer wieder gibt es Debatten innerhalb der katholischen Kirche über die Empfängnisregelung oder den Sakramentenempfang Geschiedener. Eine theologische Lesart dieser Kontroversen besagt, dass es dabei um die Reichweite Theologischer Ethik geht. Gibt es eine genuin christliche Ethik und welches sind ihre Aufgaben? Sind Kants deontologische Ethik und christlicher Glaube miteinander vereinbar?
Diesen diffizilen und zentralen Fragen der Moraltheologie widmete sich der Tübinger Professor für Moraltheologie Alfons Auer (1915-2005) in seinem Klassiker „Autonome Moral und christlicher Glaube“(1971). Der „Wissenschaftlichen Buchgesellschaft“ kommt das Verdienst zu, dass das lange Zeit vergriffene Standardwerk als unveränderter Nachdruck der zweiten Auflage von 1984, ergänzt um eine sehr gute Einführung von Dietmar Mieth, dem Nachfolger Auers auf dessen Lehrstuhl, seit 2016 wieder im Buchhandel erhältlich ist. Mieth zufolge wurde durch Auers zwischen 1967 und 1971 entstandene Programmschrift eine Wende in der Theologischen Ethik eingeleitet. Im Unterschied zu Theologen, die eine christliche Ethik aus einem bestimmten Verständnis vom Christentum deduzieren und damit die Existenz einer von christlichen Prämissen unabhängigen Moral leugnen, begründet Auer in seiner Abhandlung das Programm einer autonomen Moral mittlerer Ebene, welches eine Kompatibilität von Moralphilosophie und christlichem Glauben bedeutet. Der ehemalige Religionslehrer am Wildermuth-Gymnasium Tübingen, bekannt auch durch sein Buch „Weltoffener Christ“(1961), sieht in der Vernunft der Menschen die Rationalität des Sittlichen und damit die Autonomie der Moral begründet. Dadurch könne zudem eine Kommunikation über ethische Fragen, unabhängig von spezifischen Glaubensvorstellungen, und ein sinnvolles Zusammenleben ermöglicht werden. Zurecht erinnert Auer in seinem Klassiker an die Autonomie des Sittlichen bei Thomas von Aquin und würdigt ebenso die Arbeiten des Münchner Moraltheologen Sebastian Mutschelle (1749-1800) zur Vereinbarkeit Kantischer Ethik und christlicher Moral. Die Aktualität von Auers vor knapp 50 Jahren erstmals erschienenen Werk liegt auch darin, dass in ihm mit dem Autonomiebegriff theoretische Grundlagen eines Humanismus elaboriert werden, welcher die gemeinsame anthropologische Basis einer schulischen Kooperation von Philosophie-, Ethik- und Religionslehrkräften bilden könnte. Dr. Marcel Remme, für lehrerbibliothek.de Verlagsinfo
Was kann christlicher Glaube angesichts der autonomen Moral einer modernen Gesellschaft zur sittlichen Verwirklichung menschlicher Existenz noch beitragen? Welche Rolle kann die Kirche dabei spielen? Der Verweis auf die Theologie genügt heute nicht mehr, um sittliche Normen zu legitimieren. Diese bedürfen vernünftiger Begründungen, um angenommen zu werden. Dies stellt die Moraltheologie vor neue Herausforderungen. In seinem berühmten Buch löst Alfons Auer diese Problematik nicht auf, indem er den ethischen Autonomieanspruch der Moderne theologisch diskreditiert. Stattdessen zeigt er, dass eine von Vernunft begründete autonome Sittlichkeit für den christlichen Glauben nicht fremd, sondern sogar erforderlich ist. Auers lange vergriffenes und noch immer stark gefragtes Standardwerk, das Theologiegeschichte schrieb, ist als gebundene Ausgabe nun endlich wieder erhältlich. Die Ausgabe enthält auch den Nachtrag zur 2. Auflage, in dem Auer die kontroverse Rezeption seines Werkes thematisiert, sowie eine neue Einführung von Dietmar Mieth zu Auers Werk. Mit einer Einführung von Dietmar Mieth. 2016. 1-10, XXXIX, 11-239 S., 14,5 x 21,7 cm, geb. WBG, Darmstadt. Inhaltsverzeichnis
Dietmar Mieth:
Moralische Autonomie - Selbstbestimmung und Selbstverpflichtung nach Alfons Auer I Einleitung 11 1. Kapitel: Weltethos als das Ja zur Wirklichkeit I. Bestimmung des Sittlichen (im Sinne des Weltethos) 15 1. Das Sittliche als das Ja zur Wirklichkeit 16 a) Die These 16 b)Die Bewertung der These 18 2. Die Dimension der Wirklichkeit 19 3. Der Anspruch der Wirklichkeit 22 a) Begründung des Anspruchs 22 b) Stufen der Erkenntnis und Anerkenntnis des Anspruchs 23 Sozial auferlegte Sittlichkeit 23 Personal bejahte Sittlichkeit 25 Christlich integrierte Sittlichkeit 27 Bewertung der Dreistufigkeit des Sittlichen 27 4. Folgerungen 28 a) Rationalität des Sittlichen 28 b) Autonomie des Sittlichen 29 c) Realistik des Sittlichen 30 II. Die Rationalität der Wirklichkeit ab Grund des Sittlichen 32 1. Die Rationalität der Wirklichkeit 33 a) Ihre Vorgegebenheit 33 b)Ihre Dynamik 35 c) Ihre Verbindlichkeit 35 2. Die normative Artikulierung der Rationalität der Wirklichkeit 36 a) Humanwissenschaftliche Grundlegung 39 b) Anthropologische Integrierung 44 c) Ethische Normierung 46 Entstehung sittlicher Normen 48 Funktion sittlicher Normen 53 2. Kapitel: Weltethos in der Heiligen Schrift I. Weltethos im Alten Testament 55 1. Der Dekalog 55 a) Das vorgefundene Ethos 56 b)Die religiöse Integrierung des vorgefundenen Ethos 62 2. Das prophetische Ethos 68 3. Das Ethos der Weisheit 72 a) Erfahrungsweisheit 72 b) Religiöse Integrierung der Erfahrungsweisheit 76 II. Weltethos im Neuen Testament 79 1. Die sittlichen Forderungen Jesu 79 a) Ausklammerung der sozialen Strukturprogrammatik 80 b) Herkömmlichkeit der sittlichen Weisungen Jesu 83 Einfache ethische Weisungen 83 Hochethische Weisungen 85 c) Die Neuheit des von Jesus verkündeten Ethos 92 Der neue Sinnhorizont 92 Das neue Ethos 95 2. Die paulinische Ethik 103 a) Weltethische Weisungen - Herkunft und Stellenwert 103 Herkunft der weltethischen Weisungen 105 Stellenwert der weltethischen Weisungen 111 b)Das christliche Proprium des Weltethos 114 Heil und Ethos 114 Christliche Motivation des Ethos 118 Exkurs: Modelle aus der Geschichte der Moraltheologie 123 3. Kapitel: Weltethos in der lehramtlichen Praxis und in der moraltheologischen Reflexion I. Die bisherige Position des Lehramts und der Moraltheologie 137 1. Darstellung 137 2. Begründung 140 3. Bewertung 142 II. Die Infragestellung der bisherigen Position des Lehramts und der Moraltheologie 145 1. Die Auslösung der theologischen Reflexion 145 2. Vertiefte theologische Interpretation des Verhältnisses von Kirche und Welt 149 a) Dualität der Wahrheit 149 b)Dualität der Ordnung (Weltliche und kirchliche Zuständigkeit) 150 « c) Dialog als Weg der Wahrheitsfindung 152 3. Theologische Bewertung des Säkularisierungsprozesses 153 a) Theologische Aufwertung der „Zeichen der Zeit" 153 b) Säkularisierung als „Zeichen der Zeit" 154 c) Säkularisierung des Sittlichen als „Zeichen der Zeit" 155 4. Die Realität der modernen Profanität als geistiger Ort heutiger moraltheologischer Reflexion 157 III. Einige Reflexionen über die Zuständigkeit des Lehramts und der Moraltheologie hei der Statuierung weltethischer Weisungen 160 1. Die Autonomie des Sittlichen 160 2. Das christliche Proprium des Sittlichen 163 a) Das christliche Proprium 165 b)Das christliche Proprium und die Autonomie des Sittlichen 173 3. Die Funktionen des kirchlichen Lehramts und der Moraltheologie bei der Statuierung weltethischer Weisungen 185 a) Grundlegende Unterscheidungen 185 b)Die integrierende Funktion 189 c) Die stimulierende Funktion 193 d)Die kritisierende Funktion 194 Literaturverzeichnis 198 Nachtrag: Die umstrittene Rezeption der Autonomie-Vorstellung in der katholisch-theologischen Ethik Vorbemerkung 205 I. Das Problem der Rezeption 207 1. Allgemeine Überlegungen 207 2. Zum Problem der Rezeption der Autonomie-Vorstellung 209 II. Heutige „autonome Moral im christlichen Kontext" 212 III. Der rezeptionsgeschichtliche Hintergrund der gegenwärtigen Diskussion 215 1. Selbstverständliche Voraussetzung in der biblischen und moraltheologischen Tradition 215 2. Die Radikalisierung der Autonomie-Vorstellung im 19. Jahrhundert 220 3. Die theologische Ratifizierung der Autonomie-Vorstellung 223 IV. Kritik an der Rezeption der Autonomie-Vorstellung 225 1. Die theologische Rezeption der Autonomie-Vorstellung stelle einen „Akt semantischer Politik" dar 226 2. Frühere Versuche einer theologischen Rezeption der Autonomie-Vorstellung seien theologiegeschichtlich in die Isolation geraten 227 3. Die gegenwärtige theologisch-ethische Rezeption der Autonomie-Vorstellung sei durch einen defizitären Theoriestatus gekennzeichnet 228 4. Die Rezeption der Autonomie-Vorstellung impliziere einen allzu individualistischen Ansatz 229 5. Die Rezeption der Autonomie-Vorstellung bedeute eine Anbiederung an die Modernität 231 6. Die Rezeption der Autonomie-Vorstellung gefährde die Identität der theologischen Ethik 232 V. Desiderate zur wissenschaftlichen Aufarbeitung der Rezeption der Autonomie-Vorstellung 236 |
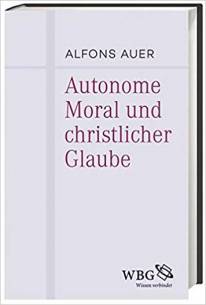
 Bei Amazon kaufen
Bei Amazon kaufen