|
|
|
Rezension
Das Thema der Digitalisierung ist spätestens seit Beginn der Corona-Pandemie in aller Munde, Publikationen dazu sprießen wie Pilze aus dem Boden, viele Verlage und Anbieter von Schulmaterialien beeilen sich, möglichst breite Programmsparten digital aufzustellen. Aber wie ist mit um die Reflexion dieses großen Themas bestellt? Im Beltz-Verlag ist nun ein Sammelband erschienen, der sich zum Ziel gesetzt hat, einen Beitrag zu konstruktiver Medienarbeit in der Schule zu leisten. Der Herausgeber, Ralf Lankau, Professor für Mediengestaltung und Medientheorie, hat bereits einige hochkarätige Publikationen zum Umgang mit Medien und Medienarbeit im schulischen Kontext verfasst. In diese Reihe kann auch der vorliegende Band gestellt werden. Die Autoren der dreizehn fundierten Beiträge beleuchten ganz verschiedene Aspekte der Thematik. Herausgeber Lankau selbst schreibt zwei Beiträge: Einerseits zur Problematik, dass digitale Unterrichtssettings eher der Ausbildung denn der Bildung dienlich sind, andererseits zu alternativen IT-Konzepten in der Schule. Letzteres ist ein Thema, dem Lankau sich schon häufiger zugewandt hat. Der Germanist und Philosoph Gottfried Böhme äußert sich in zwei Beiträgen einerseits zu standardisierten Korrekturschemata ("In der Matrix", S.42-55) und andererseits zur Untauglichkeit des Kompetenzbegriffs als Bildungsbegriff ("Von kompetenten Ignoranten und kreativen Tagträumern", S.145-152). Der Kunstpädagoge Jochen Krautz, Professor an der Bergischen Universität Wuppertal, schreibt über den Begriff der Digitalisierung im schulischen Kontext. Zentral hebt er hervor, dass der Begriff der "digitalen Transformation von Schule" vor allem von an Profit orientierten Wirtschaftsvertretern verwendet und in Umlauf gebracht wird, dass durch die Verwechselung von sicherer digitaler Infrastruktur mit "wir machen alles digital" jedoch große Verwirrung gestiftet werde. Ein Beitrag widmet sich der Beziehungsebene im Unterricht bei wachsendem Digitalisierungsanteil, ein weiterer Aufsatz nimmt den "menschliche
Zwischen den Beiträgen finden sich immer wieder (grau unterlegt) kleine Texte "Aus der Praxis". Hier berichten Eltern, Großeltern, Lehrerinnen und Lehrer und Schülerinnen und Schülern, wie sie die Beschulung in Pandemiezeiten erlebt haben. Alle Beiträge sprechen eine deutliche Sprache: Digitalisierung muss mit Augenmaß betrieben werden, keinesfalls mit der Gießkanne. Viele Auswirkungen, gerade auf junge Menschen, sind noch unbekannt, die Forschung dazu steckt noch in den Kinderschuhen. Für Lehrerinnen und Lehrer aller Stufen kann der Sammelband uneingeschränkt empfohlen werden: Vieles wird jeder Praktikerin / jedem Praktiker aus der Seele sprechen, die reichlich bemessenen Literaturangaben geben genügend Stoff für vertiefende Recherchen, zu denen dieser Band unmittelbar einlädt. Zum Einsatz des Bandes: Im Rahmen von Fortbildungstagen könnte beispielsweise ein Beitrag aus diesem Buch im Kollegium gemeinsam gelesen und diskutiert werden. Die Früchte solcher Arbeit wären an einigen Stellen vielleicht etwas zurückhaltendere Medien- und Digitalisierungskonzepte, als man sie in der letzten Zeit immer wieder in Händen hält. Johannes Groß, www.lehrerbibliothek.de Verlagsinfo
Digital- und Medientechnik sind heute typische Bestandteile des Unterrichts. Um Lern- und Verstehensprozesse zu ermöglichen, braucht es aber vor allem das Gespräch und den Diskurs. Lernen ist ein individueller und sozialer Prozess, der nicht digital kompensiert werden kann, wenn Verstehen und nicht nur Repetition das Ziel ist. Medien und Medientechnik können Lernprozesse unterstützen, aber wir lernen im Miteinander. Dieser Band soll die beabsichtigte digitale Transformation von Schule und Unterricht aus sowohl pädagogischer wie philosophischer, aus bildungstheoretischer wie kognitionswissenschaftlicher Perspektive betrachten, zugleich praxisnah die beabsichtigte digitale Steuerung und Quantifizierung von Lernprozessen transparent machen und Alternativen für einen verantwortungsvollen und pädagogisch sinnvollen Einsatz von Medien- wie Digitaltechnik im Unterricht aufzeigen. Das Ziel ist Emanzipation und Mündigkeit durch konstruktive und produktive Medienarbeit. Inhaltsverzeichnis
Ralf Lankau
Einleitung Schule, Computer und Unterricht Ralf Lankau Wenn aus Science-Fiction Realität wird Digitalisierung statt pädagogischer Konzepte Gottfried Böhme In der Matrix Axel Bernd Kunze Beziehung, Präsenz, Kommunikation Bildungstheoretische und bildungsethische Überlegungen zur digitalen Unterrichtsentwicklung Edwin Hübner Der menschliche Leib im medialen Zeitalter Aspekte einer Pädagogik der Kreativität im digitalen Zeitalter Christine Bär Von Stroh zu Gold und wieder zu Stroh? Die Einsozialisierung der jungen Generation in das digitale Zeitalter Angelika Supper und Gertraud Teuchert-Noodt Wie das Lernen nicht funktioniert Kinder bewerten ihren Handygebrauch – eine empirische Pilotstudie Ingo Leipner Digitales Raubrittertum Warum wir im elektrischen Strom nicht baden können – und wie Kinder den Ausschaltknopf finden Sandra Reuse Homeschooling – vielfältige Probleme, wenig Vereinbarkeit Eine interdisziplinäre Betrachtung des Distanzlernens nach Haushaltskonstellationen Gottfried Böhme Von kompetenten Ignoranten und kreativen Tagträumern Warum es traditionellem europäischen Denken widerspricht, den Kompetenzbegriff zum zentralen Bildungsbegriff zu machen – gerade im digitalen Zeitalter Jochen Krautz Worum es geht – und worum nicht Digitalisierung als Gegenstand und Medium von Unterricht statt »digitale Transformation von Schule« Ralf Lankau Werkzeug im Unterricht statt Allheilmittel Alternative IT-Konzepte für Schulen Burkard Chwalek Lehr-Lernplattformen und Erziehung zur Mündigkeit Sigrid Hartong, Heidrun Allert, Karin Amos, Paula Bleckmann, Izabela Czarnojan, Annina Förschler, Sieglinde Jornitz, Manuel Reinhard und Ina Sander Unblack the Box Anregungen für eine (selbst)bewusste Auseinandersetzung mit digitaler Bildung Autorinnen und Autoren |
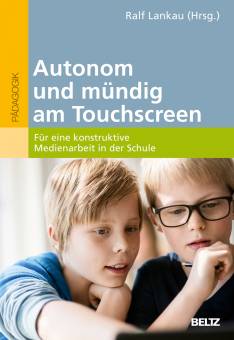
 Bei Amazon kaufen
Bei Amazon kaufen