|
|
|
Umschlagtext
Mediengewalt ist immer wieder ein Thema öffentlicher Debatten. Insbesondere nach spektakulären Amokläufen taucht regelmäßig die Frage auf, ob Medien ihre Nutzer zu Gewalttätern programmiert und so die Tat verursacht haben. Dabei ist der kausale Zusammenhang alles andere als geklärt: Obwohl die empirische Mediengewaltforschung mit großem Aufwand betrieben wird, hat sie bis heute keine konsensfähige Antwort gefunden. Diese Studie sucht keine weitere Lösung, sondern fragt, wie sich die Kausalformel "Mediengewalt" historisch herausgebildet hat und welcher Gewinn darin liegt, die Mediengewalt-Debatte beständig mit ungeklärtem Wissen zu versorgen.
Rezension
Ob Medien Gewalt erzeugen, ob also z.B. der Konsum von Gewalt-Videos entsprechende Nachahmungen evoziert, - diese Frage wird zwar immer wieder diskutiert, insbesondere, wenn Gewalt öffentlich und medial wirksam stattgefunden hat, wie z.B. bei Amokläufen (z.B. Erfurter Gymnasium), aber geklärt ist die Frage keineswegs trotz einer immensen Forschungsarbeit, die in den vergangenen Jahren betrieben wurde. - Spannender fast als die Beantwortung dieser Kontroverse erscheint mittlerweile die Frage, warum diese Debatte so gern betrieben wird, warum die Medien gern für Gewalttaten verantwortlich gemacht werden, - genau hier setzt diese Kölner Dissertation an und rückt die gesamte Debatte damit in ein anderes, nkicht minder spannendes Licht ...
Dieter Bach, lehrerbibliothek.de Verlagsinfo
Isabell Otto ist wissenschaftliche Mitarbeiterin am kulturwissenschaftlichen Forschungskolleg "Medien und kulturelle Kommunikation" und am Institut für Theater-, Film- und Fernsehwissenschaft der Universität zu Köln. Ihre Forschungsschwerpunkte sind Medien in der Wissenschaftsgeschichte, Mediendiskurse und Medientheorie. WWW: www.fk-427.de Adressaten Kulturwissenschaft, Medienwissenschaft Schlagworte Mediengewalt, Wissenschaftsgeschichte, Diskursgeschichte Interview ... mit Isabell Otto "Bücher die die Welt nicht braucht". Warum trifft das auf Ihr Buch nicht zu? In meiner Studie verfolge ich eine neue Annäherung an die vieldiskutierte Frage, ob Medien ihre Nutzer zu Gewalttaten anreizen. Dies geschieht, indem die historischen Voraussetzungen für diese Fragestellung beleuchtet werden. Ich untersuche, wie sich die Möglichkeiten des wissenschaftlichen Sprechens über Mediengewalt formieren. Das Buch liefert keine weitere der zahlreichen Antworten auf die Mediengewalt-Frage. Es veranschaulicht vielmehr, warum diese Frage immer wieder gestellt wird. Welche neuen Perspektiven eröffnet Ihr Buch? Die Geschichte der Mediengewaltdebatte ist häufig als eine immer wiederkehrende Entrüstung von Eltern, Pädagogen und Politikern erzählt worden, die nicht aus wissenschaftlich-rationalen Überlegungen resultiert. Die neue Betrachtungsweise meines Buchs richtet sich dagegen auf die empirische Mediengewaltforschung: Inwiefern tragen die Verfahren des Messens und der Verdatung von Mediengewalt dazu bei, diese als Problem in der Öffentlichkeit präsent zu halten? Welche Bedeutung kommt dem Thema in den aktuellen Forschungsdebatten zu? Nach wie vor ist die Mediengewaltforschung auf der Suche nach den besseren Methoden zur Messung von Mediengewalt. Sie kann jedoch die grundlegende Frage nicht klären: Ist Gewalt in den Medien nun gefährlich oder nicht? Zu jeder Untersuchung gibt es sofort ein Experiment, das die gegenteilige Beweisführung antritt. Die Frage der Mediengewalt ist also nach wie vor virulent und keineswegs ad acta gelegt. Es lohnt sich daher ein Blick auf die #anf1d#Forschungskulturen' von Mediengewalt. Mit wem würden Sie Ihr Buch am liebsten diskutieren? »Aggressive Medien« wirft einen kulturwissenschaftlichen Blick auf einen sozialwissenschaftlichen Forschungsbereich und stellt dabei u. a. folgende Fragen: Welche epistemologischen Gesichtspunkte prägen die Forschung in ihrer Frühzeit und noch heute? Welche Theorien und Konzepte finden Eingang in die Lehrbücher der Mediengewaltforschung und welche nicht? Eine Diskussion des Buchs mit Sozialwissenschaftlern und Wissenschaftshistorikern wäre deshalb besonders interessant. Ihr Buch in einem Satz: »Aggressive Medien« untersucht, wie die Kausalformel Mediengewalt in Forschungspraktiken entsteht und Eingang in Debatten über Gewalt und Medien findet. Inhaltsverzeichnis
Die Formel ›Mediengewalt‹ 11
Die Kontroverse der Experten 13 Die diskursive Regulation von Mediengewalt 26 TEIL 1: WIRKUNGSKONTROLLE 39 1 Wirkung: Epistemologie des Messens 45 Sozialstatistische Positivitäten und die Objektivierung der Gesellschaft 45 Experimentelle Beobachtung und kontrollierte Kausalität 58 2 Propaganda: Politik der Beeinflussung 77 Techniken politischer Gewaltkommunikation 80 Die Mission der Persuasionsforschung 91 3 Werbung: Ökonomie der Suggestion 101 Anzeigen und ihre mediale Umgebung 110 Die Rationalisierung negativer Werbewirkung 114 Wirkungsforschung im Werbemedium 122 4 Erziehung: Pädagogik der Gefährdung 131 Die Rückseite des Erziehungsmediums 134 Die Delinquenz des unschuldigen Mediennutzers 137 Die Medien der Lerntheorie 146 5 Heilung: Therapie der Mediengewalt 159 Zur Genealogie medizinischer Reinigungskonzepte 162 Mediengewalt als kathartische Arznei 169 Die Widerlegung der Katharsisthese 175 Sozialhygienische Regulation 182 Das Wissen über Mediengewalt: Zwischenbilanz 189 Wirkungsstabilisierende Zähmung 189 Das Moralische der Regulation 193 Die moralische Regulation von Mediengewalt 199 TEIL 2: REGIERUNG DER MEDIENNUTZUNG 203 1 Kontexte der Wissensproduktion 207 Rhetoriken der Beweisführung 211 Regulation statt Kontrolle 217 Die sozialhygienische Institution als Ort der Wissensproduktion 222 Justierung des Experimentalsystems 232 2 Formatierung der Wissensordnung 235 Von der Gewalttat zum alltäglichen Normverstoß 239 Dispersion des gefährlichen Mediums 252 a) Fernsehen als Messproblem 254 b) Korrelation in Zeitsprüngen 255 c) Muster der Rezeption 261 Die Überwachung gewalttätiger Mediennutzer 263 3 Diffusion des Wissens 271 Die Irrwege publizierter Daten 274 Staatspolitische Handlungsohnmacht 280 Schließung des Forschungskreislaufs 290 Rezeptionspolitiken 295 Die Offenheit der Mediengewalt-Frage 301 Killerspiele verbieten: Die Sackgasse der Restriktionen 303 Schau hin! Der Appell an autonome Subjekte 309 Literaturverzeichnis 313 |
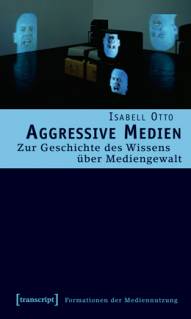
 Bei Amazon kaufen
Bei Amazon kaufen