|
|
|
Umschlagtext
Michael von Brück, der anerkannte Vermittler des Buddhismus, sammelt und erschließt wichtige Stutra-Textc, kurz und prägnant werden - nicht zuletzt auch über die Einführting des Dalai Lama - die Grundlagen buddhistischer Spiritualität für heute boten. Das Buch leistet eine kompetente Hilfe zum Verständnis und zur Rezepition der Sutra-Texte. Dank der Erklärungen und Kommentierungen zu ihrem geistigen Hintergrund und ihrer Bedeutung für heutiges Lehrer und Meditieren leitet das Buch zu einer Vertiefung spiritueller Praxis an.
Michael von Brück, geb. 1949, Dr. theol., Professor für Religionswissenschaft an der Universität München, seit 20 Jahren Dialogpartner des Dalai Lama, zahlreiche Schriften zum Buddhismus und Hinduismus, Herausgeber der Zeitschrift »Dialog der Religionen«. Er leitet Zen- und Joga-Kurse Verlagsinfo
Quellen des Buddhismus In der Nachfolge von berühmten Mystikern wie Meister Eckhard und Zen-Meistern der Vergangenheit und Gegenwart zeigt Willigis Jäger die fundamentale Bedeutung der Körpererfahrung auf dem Weg zur Erleuchtung, zur Wesens- und Gotteserfahrung. Beatrice Grimm gibt handfeste Anleitungen zu den wichtigsten Formen des Körpergebetes: Gebärden der Urgebete der Menschheit, Ritual-Tänze wie das Lob der Grünheit von Hildegard von Bingen oder der Friedenstanz des Franziskus, Labyrinthgang und vieles andere mehr. Ein Übungsbuch auf fundierter Grundlage mit zahlreichen, auf Fotos klar illustrierten Übungen. Inhaltsverzeichnis
Vorwort Das Wesen des Mahayana-Buddhismus von Tenzin Gyatso, dem XIV. Dalai Lama 9 Einleitung 28 Teil I Gläubige Verehrung Aus dem Lotos-Sutra 51 Einführung 52 1 Gleichnis vom verlorenen Sohn (aus dem 4. Kapitel) 61 Text 61 Kommentar 69 2 Geschicklichkeit (aus dem 2. Kapitel) 72 Text (mit erläuternden Zwischenbemerkungen) 72 Kommentar 76 3 Gleichnis von den Kräutern (aus dem 5. Kapitel) 78 Text 78 Kommentar 88 4 Bodhisattva Sadaparibhuta (aus dem 20. Kapitel) 90 Text 90 Kommentar 97 Teil II Meditativer Weg Aus dem Avatamsaka-Sutra 99 Einführung 100 1 Verherrlichung des Buddha 110 Text 110 Kommentar 140 2 Selbstaufgabe 142 Text 142 Kommentar 157 3 Herrlichkeit und Leere 160 Text 160 Kommentar 170 4 Der Buddha als universaler König der Barmherzigkeit 171 Text 171 Kommentar 195 Teil III Erwachen zur Weisheit Aus dem Prajñaparamita-Sutra und das Herz-Sutra 197 Einführung 198 1 Der Erleuchtungsgedanke (aus dem 2. Kapitel) 207 Text 207 Kommentar 226 2 Herz-Sutra: Die Weisheit der Leere 228 Einführung 228 Text 230 Kommentar 232 Teil IV Bewährung in der Welt Aus dem Vimalakirtinirdesha-Sutra 237 Einführung 238 1 Vimalakirti und die Mönche (Kapitel 3) 242 Text 242 Kommentar 249 2 Die Göttin (Kapitel 6) 252 Text 252 Kommentar 264 3 Das Dharma-Tor der Nicht-Dualität (Kapitel 8) 265 Text 265 Kommentar 273 Anmerkungen 275 Literaturverzeichnis 286 Glossar 289 Leseprobe
Weisheit der Leere Teil I Gläubige Verehrung Aus dem Lotos-Sutra Einführung Das Lotos-Sutra oder, mit seinem vollständigen Titel, Saddharma-pundar´ka-Sutra (»Sutra vom weißen Lotos des wahren Dharma«), ist einer der wichtigsten Texte des Mahayana-Buddhismus, nicht nur, weil es als »die Bibel Ostasiens« in China und Japan eine Wirkung entfaltet hat, die bis heute unvermindert anhält, sondern vor allem weil es einer der frühesten Texte ist, die Zeugnis von dem neuen Geist ablegen, der den Buddhismus wohl bereits schon ein Jahrhundert nach dem Tod des Buddha zu erfassen begann: dem Geist des Mahayana. Kaum ein anderer Text erfreut sich in der gesamten buddhistischen Welt bei Laien wie bei Mönchen derartig großer Beliebtheit. Das Lotos-Sutra wurde bereits im Jahre 286 n. Chr. von Dharmaraksha ins Chinesische übersetzt, und das bedeutet, dass der Text schon lange vor diesem Zeitpunkt zusammengestellt worden sein muss, ja dass die mündliche Überlieferung wohl einige Jahrhunderte zurückreichen könnte. Wahrscheinlich gehen die eindrucksvollen Gleichnisreden auf früheste buddhistische Überlieferung zurück, und es ist möglich, dass sie den Predigten des Buddha selbst entnommen sind und, in einer von den etablierten Mönchsorden unabhängigen Laien-Überlieferung, aufbewahrt wurden. Die meisten Indologen nehmen an, dass der Text im 1. Jh. n. Chr. schriftlich fixiert war, wenn auch in einer Form, die immer wieder verändert wurde, wie wir an den verschiedenen chinesischen Übersetzungen aus dem Sanskrit ablesen können. Nehmen wir das 1. Jh. n. Chr. als Entstehungszeit an, so bedeutet dies, dass das Sutra fast gleichzeitig mit dem Pali-Kanon entstanden ist, wobei die Pali-Schriften allerdings ebenfalls eine lange mündliche Überlieferungsgeschichte hinter sich hatten, bevor sie schriftlich niedergelegt wurden. Jedenfalls kann man aus dieser Chronologie ersehen, dass gemessen am Alter der Text des Lotos-Sutra nicht weniger authentisch ist als der Pali-Kanon der Theravadins, und es begegnen uns in beiden Schriftenreihen ganz verschiedene Interpretationen der Lehre des Buddha, die man unterschiedliche Paradigmen nennen kann, weil sie die Gesamtheit der Ansichten über den Kosmos, den Menschen, das Leben, den Heilspfad und die Rolle des Buddha betreffen. Kumaraj´vas Text Die hier übersetzten Texte beruhen auf der chinesischen Übersetzung Kumaraj´vas von 406 n. Chr. aus dem Sanskrit. Kumaraj´va war der Sohn eines indischen Brahmanen und einer zentralasiatischen Prinzessin von Kucha, und er hat nicht nur dieses Sutra übersetzt, sondern im Auftrage des chinesischen Hofes von Ch’ang-an Hunderte von buddhistischen Texten übertragen, nicht allein, sondern mit einem Stab von wohl bis zu eintausend Mitarbeitern. Kumaraj´va kannte nicht nur den Buchstaben, sondern vor allem den Geist der Religion, die er durch seine einzigartige Leistung in China verbreiten half. Nicht nur deshalb, sondern auch weil seine Sanskrit-Vorlage älter ist als die der ersten Übersetzung durch Dharmaraksha, genießt sein Text bis heute besonderes Ansehen.28 Der Text des Sutra besteht aus Versen (gathas) und Prosa, wobei die Verse älter sind. Die Prosa wiederholt oder erläutert und interpretiert zum Teil auch die Verse in neuer Weise. Dennoch sind beide Formen fast identisch, und man könnte jeweils einen Verstext und einen Prosatext erstellen, wobei beide den gesamten geistigen Gehalt des Lotos-Sutra wiedergeben würden. Einen Verfasser kennen wir nicht, und da es sich um die Sammlung alter mündlicher Tradition handelt, die von vermutlich mehreren Redaktoren zusammengestellt wurde, wäre ein Verfasser auch gar nicht zu benennen. Die endgültige Redaktion des Sanskrit-Textes des Sutra, wie er Kumaraj´va vorlag, könnte im 2. Jh. n. Chr. in Gandhara (Nordwestindien) erstellt worden sein. Zum Charakter des Sutra Das Lotos-Sutra ist ein Meisterwerk mytho-poetischer Vision. Es ergeht sich kaum in lehrmäßigen Diskursen, sondern konzentriert sich ganz auf die Person des Buddha. Wer ist dieser Erwachte? Ein gewöhnlicher Mensch, dem es gelungen ist, das »Sein aus den Angeln zu heben« (R.Guardini) und zu einer alles Menschliche sprengenden Erfahrung des Erwachens durchzubrechen, oder ein Gott in Menschengestalt? Diese Fragen waren nicht neu, aber sie werden im Lotos-Sutra in besonderer Weise beantwortet. Das liegt an der Tradition, aus der es hervorgegangen ist. Wir haben allen Grund anzunehmen, dass das Sutra nicht in Mönchskreisen entstand, sondern von und für Laien überliefert wurde. Wie wir aus anderen Quellen wissen, entstand schon kurz nach dem Tode des Buddha eine Laienfrömmigkeit, die ihr Zentrum in der Reliquienverehrung des Buddha hatte und als Buddhayana von Kaiser Ashoka (ca. 268–239 v. Chr.) gefördert wurde. Für die Laienanhänger des Buddha konnte weder die komplizierte Mönchsregel noch das intensive Studium der Meditation einen Weg weisen. Was war natürlicher, als dass man sich – auch gegen die ausdrückliche Empfehlung Gautama Shakyamunis selbst – an das Greifbare hielt und seine sterblichen Überreste in den stupa brachte, der als Reliquienschrein die dauernde Gegenwart des Erwachten symbolisieren konnte? Bedingungsloses Vertrauen gegenüber dem Buddha, ja Verehrung und Liebe, das waren die Charakteristika dieses »Fahrzeugs«. In einer nicht sichtbaren Form musste er noch gegenwärtig sein, und vielleicht waren dies Vorstellungen, die der allgemein-indischen Lehre von einem subtilen Körper, der nur während des irdischen Lebens mit dem physischen Körper verbunden ist, nahe kamen. Ein Zwischenbereich also zwischen dem materiellen Körper (rupa-kaya) und dem absoluten, ungreifbaren und unvorstellbaren Transzendenzkörper (dharma-kaya), der zwar nicht dem bloßen sinnlichen Auge, wohl aber dem durch Glaube und Liebe gereinigten inneren Auge, das am Stupa immerhin einen festen Anhaltspunkt hatte, erscheinen konnte. Später nannte man diesen Aspekt den Seligkeitskörper des Buddha (sambhoga-kaya), und genau dies ist der Bereich, in dem die theophanieartigen Manifestationen und spirituell-symbolischen Imaginationen, von denen das Lotos-Sutra erzählt, anzusiedeln sind. Das Lotos-Sutra ist ein spirituelles Drama: Der Buddha predigt, wie so oft, auf dem Geierberg bei Rajagriha, einem Ort in Nordindien, der noch heute besucht werden kann. Aber dieser Ort verwandelt sich gleich zu Beginn des Sutra und dann vor allem im 11. und 16. Kapitel in den Knotenpunkt der geistige Welt. Er ist die axis mundi, die alle irdischen und himmlischen Wesen umkreisen, ja das Reine Land, ein Bereich der Seligen, in dem irdisches Leid und alle Versuchungen des Daseins so gering sind, dass die Übung des Dharma ohne Schwierigkeiten vollzogen und im Vertrauen auf den Buddha das Erwachen sofort erlangt werden kann. Vielleicht reflektiert dieser Hinweis im Lotos-Sutra eine Frühform des Buddhismus des Reinen Landes, der später in China und Japan dominierend wurde. Der Buddha ist hier umgeben von vielen anderen Buddhas aus anderen Weltzeitaltern und anderen Welten. Für den Buddhisten gibt es ja nicht nur ein Universum, sondern unzählige, und jedes hat seine eigenen Buddhas und Buddha-Genealogien (gotra), damit kein Bereich der unermeßlichen Welten ohne den rettenden Erleuchtungsstrahl bleibt. Wie in den frühbuddhistischen Jataka-Erzählungen werden all diese vorigen und kommenden Wesen als andere Manifestationen ein- und desselben Buddha angesehen, der hier und jetzt auf dem Geierberg spricht. Das Lotos-Sutra erhebt sich in seiner überweltlichen Schau über alle raum-zeitlichen Schranken, die dem menschlichen Bewusstsein im Normalzustand gesetzt sind – alle diese Welten und Zeiten sind für den im meditativen Zustand verweilenden Buddha zu einer Einheit zusammengeschmolzen, zu einer mythischen Identität aller Wesen und Zeiten, die kosmische Harmonie offenbart. In der schon erwähnten Vision des 16. Kapitels wird erzählt, dass der Buddha im Stupa wahrhaftig lebendig ist und mitten unter den Gläubigen weilt. Er teilt seinen Sitz mit dem Buddha des vorigen Zeitalters und identifiziert sich also mit der Vergangenheit. Gegenwart und Vergangenheit fallen zusammen, doch die Zukunft steht noch aus. Die jetzige Zeit gleicht einem apokalyptischen Schauspiel, und es gilt, den Dharma im Vertrauen auf seine Wahrhaftigkeit gegen alle Anfeindungen von innen und außen zu verteidigen. So schwelgt das Sutra nicht nur im rein Überweltlichen, sondern hat ein konkretes religionspolitisches Ziel: Das Lotos-Sutra lehrt das eine Fahrzeug (ekayana), das alle anderen in sich aufnimmt, damit die Spaltungen in der buddhistischen Bewegung aufhören und die kosmische Ordnung auch in der Geschichte des Menschen Gestalt gewinnt. Es ist kein Zufall, dass das Lotos-Sutra immer wieder und bis heute politische Reformbewegungen im Buddhismus inspiriert hat, allen voran Nichiren (1222–1282) in Japan, der wie kein anderer den chiliastischen Geist dieses Sutra hervorgehoben hat. Das große Thema des Lotos-Sutra ist also das eine Fahrzeug, in dem alle zusammengefasst werden können. Lehrunterschiede oder Differenzen in der Praxis (Mönchsregel und Meditation) sind unwesentlich, wenn der Buddha in gläubigem Vertrauen angerufen wird und die Menschen sich als seine Söhne erkennen, die er mit Geschicklichkeit verschieden, entsprechend ihren jeweils unterschiedlichen Begabungen und Neigungen, beschenkt hat. Alle Lebewesen besitzen die Eigenschaften, die notwendig zur Erlangung der Buddhaschaft sind. Das Wesen des Buddha Hier findet nun eine interessante Entwicklung statt: Nach der Auffassung der frühbuddhistischen Schulen, besonders der Theravadins, war der historische Buddha am Ende seines Lebens um Mitternacht in einen Zustand tiefer meditativer Absorption versunken, bei Tagesanbruch trat er dann ins parinirvana ein und erlosch. Als der Stupakult aufkam, wurde diese Zeitspanne auf Äonen ausgedehnt – man glaubte, dass der Erwachte im Stupa weiterlebe und mit Güte sowie wachsamen Auges die Gläubigen und die gesamte Welt beschütze.29 Im Lotos-Sutra erklärt der Buddha, dass er nach seinem Tod in einem anderen Bereich des Kosmos oder einer anderen Welt Buddha werden wird: Sein Bewusstseinskontinuum wirkt demnach also in anderer inkarnierter Form fort. Im frühen Mahayana spricht man von Buddha-Genealogien oder Buddha-Familien (gotra), zu denen die Lebewesen gehören; wird sich ein Mensch dieser Verwandtschaft bewusst, d.h. erkennt er »seinen« Buddha als »Vater« an und tritt in Beziehung zu ihm, so ist der Weg zum Erwachen frei. Es handelt sich um eine Frömmigkeit inniger Beziehung, die im Glauben verwirklicht wird. In anderen Texten wird buddha-gotra hingegen zur allen Wesen innewohnenden Buddha-Natur (garbha), die sie wie einen Keim in sich tragen und der durch Erkenntnis wie Meditation zum Leben erweckt wird. Das Aufkeimen dieses Samens ist das Erwachen. Vermutlich spiegeln sich in dieser Unterscheidung Grundformen der menschlichen Erfahrung wider, die aber auch soziologisch wirksam waren und sind. Im ersten Falle, wie im Lotos-Sutra, handelt es sich um die Entwicklung von Liebe, Vertrauen und Glauben zum Buddha. Er steht hier im Mittelpunkt als Prediger des Dharma und Wegweiser, im Bilde gesprochen als Freund und Vater. Im anderen Falle, wie in der Prajñaparamita-Literatur, handelt es sich um die Entwicklung von Weisheit, meditativer Stille und Selbstbesinnung, um die eigene Verwirklichung des vom Buddha Gelehrten also. Hier steht der Dharma als der vom Buddha gepredigte Weg im Mittelpunkt. Es ist offenkundig, dass der eine Weg mehr für die Laien, der andere mehr für Mönche und Asketen geeignet war, denn die im Laienstand Lebenden hatten kaum die Muße, sich komplizierten und zeitaufwendigen Übungen zu unterziehen. Beide Wege sind aber gewiss nicht unüberbrückbare Gegensätze, sondern Antwort auf zwei miteinander zusammenhängende Aspekte des menschlichen Geistes, die durchaus gemeinsam und in fruchtbarer Harmonie entwickelt werden können. Sie sind aber eben auch verschiedene geschickte Mittel (upaya), die der Buddha lehrt, um der Lebenssituation jedes Einzelnen entsprechend genau den geeigneten Weg zu zeigen. Der historische Buddha Shakyamuni wird im Lotos-Sutra zu dem einen überzeitlichen Buddha, wobei man aber dem Sutra noch entnehmen kann, dass dies nicht von vornherein selbstverständlich war – der Buddha war Mensch gewesen und als solcher zur Klarheit des Geistes erwacht. Durch seine Geisteskraft hatte er zwar die zeitlichen Schranken ausdehnen, aber das Gesetz der Vergänglichkeit doch nicht überwinden können, ja, sein Erwachen bestand gerade in der Erkenntnis und Anerkennung dieses Gesetzes. Allmählich erkannte man – und hierin liegt der spirituelle Grundstein für den Mahayana-Buddhismus –, dass das erwachte Bewusstsein universal sein muss, weil das Erwachen selbst alle raum-zeitlichen Grenzen sprengt. Der Buddha war also von Ewigkeit her erwacht, und darum hat er schon unzähligen Wesen gepredigt, wie das Lotos-Sutra verkündet. Der Buddha wird aber auch hier nicht zum Gott, zumindest nicht zu einem Schöpfergott, der das Geschick der Menschen leitet, sondern er ist das erwachte Bewusstsein, der Inbegriff des letzten Grundes der Wirklichkeit, die jedes andere Wesen in Wahrheit auch ist. Das irdische Leben des Buddha – Geburt, Erwachen und Tod – war ein upaya, ein geschicktes Mittel, um die Menschen auf den Weg zur Erkenntnis und Befreiung zu führen. Er gab nur vor, in seinen frühen Lebensjahren nicht erwacht gewesen zu sein, damit alle, die ihm folgen würden, ebenfalls das Vertrauen entwickeln würden, dass sie auch zur vollständigen Befreiung gelangen können. Er gab nur vor, in den Tod zu gehen und den Menschen fern zu sein, um ihre eigene Willenskraft und den Mut zu stärken, an ihrer Befreiung selbst zu arbeiten, wie das berühmte Gleichnis im 16. Kapitel erzählt: Ein Arzt, der lange verreist war, kehrt heim und findet seine Söhne krank vor. Sie leiden an einer Vergiftung und bitten den Vater, sie zu heilen. Doch diejenigen, deren Bewusstsein von dem Gift schon stark getrübt ist, verweigern sich der Medizin. Um sie zur Vernunft zu bringen, verreist der Vater erneut und lässt ihnen die Kunde von seinem Tod überbringen. Der Schock und die Trauer über den Verlust lässt die Söhne ihre Lage erkennen, die Medizin einnehmen und gesunden. Nun kehrt der Vater zurück und alle sind glücklich über die Heilung. Motiviert von dem Wunsch, alle Kranken zu heilen, wendet der Vater ein geschicktes Mittel (upaya) an, so wie auch der Buddha, motiviert von seiner Liebe zu allen Wesen und dem Wunsch, alle zur Befreiung zu führen, das geschickte Mittel seines scheinbaren Todes anwendet, und keiner macht sich deshalb der Unwahrhaftigkeit schuldig. Der Buddha erklärt, dass es selten sei, einem Buddha als Lehrer zu begegnen, damit der Eifer derer, die ihn hören, erweckt würde. In Wirklichkeit, so das Lotos-Sutra, predigt der Buddha ewig und in unzähligen Formen an allen Orten. Christen werden fragen, ob hier nicht eine doketische Buddhologie gelehrt wird, die den Buddha der menschlichen Sphäre enthebt, vergöttlicht und somit unerreichbar macht. Eine doketische Christologie war nämlich auch in der frühen Kirchengeschichte aufgekommen, und sie besagte, dass Jesus Christus wahrer Gott, aber nur scheinbar Mensch gewesen sei, wohingegen die Kirche im nizänischen Glaubenbekenntnis an der Formulierung »wahrer Gott und wahrer Mensch« festhielt. Warum? Weil ein nur scheinbar Mensch gewordener Gott den Graben zwischen Gott und Mensch nicht aufhebt, weil dann das Heil also wieder ungewiss geworden wäre. Ist dies im Mahayana-Buddhismus ebenso? Nein, und es scheint eher, dass die Sache genau umgekehrt ist. Nicht der Buddha ist nur scheinbar Mensch, sondern die Menschen sind nur scheinbar gewöhnliche Menschen, in Wirklichkeit ist ihr Wesen vielmehr die Buddhaschaft. Der raum-zeitlichen Wirklichkeit kommt keine Bedeutung im letzten Sinne zu, und die absolute Wahrheit liegt hinter der sichtbaren Erscheinung, wenn auch nicht abgelöst von der sichtbaren geschichtlichen Welt, wie wir an der oben erörterten Lehre von den drei Körpern (trikaya) und vor allem durch die im dritten Teil noch darzustellende »Weisheit der Leere« (shunyata) erkennen können. Das eine Fahrzeug Das Lotos-Sutra predigt mit Nachdruck das ekayana, das eine Fahrzeug, und kritisiert damit nicht nur die Anhänger des Kleinen Fahrzeugs (der tatsächlich abwertende Begriff h´nayana wird erstmals hier im Lotos-Sutra gebraucht), sondern auch die Buddhisten, die im bodhisattvayana, einer Frühform des Mahayana, eine eigenständige Tradition neben den Fahrzeugen der shravakas (Hörer, d.h. die Anhänger der späteren Theravada-Tradition) und pratyekabuddhas (diejenigen, die den buddhistischen Heilspfad außerhalb der organisierten Lehrtradition allein verwirklichen), gepflegt hatten. Und tatsächlich hat die Lotos-Tradition eine Integration der Bodhisattvas und anderer früher Mahayana-Entwicklungen ermöglicht. Waren nun aber die bisherigen Lehren und Wege falsch? Keineswegs, argumentiert das Lotos-Sutra. Sie waren vorläufige und für bestimmte Menschen sehr wohl geeignete Wege. Das Gleichnis vom brennenden Haus (Kapitel 3) bringt dies beredt zum Ausdruck: Ein Feuer bricht aus, als die Kinder im Haus spielen. Der Vater bemerkt von außen das Unglück. Die Kinder sind so in ihr Spiel vertieft, dass sie den Rufen des Vaters nicht folgen, denn sie erkennen ihre Lage nicht. Da wendet der Vater ein »geschicktes Mittel« an – er verspricht ihnen, jedem jeweils sein liebstes Spielzeug zu schenken. So verspricht er dem ersten Sohn einen von Ziegen gezogenen Wagen, dem anderen ein Gespann mit Hirschen, wieder einem anderen einen Ochsenkarren. Daraufhin laufen alle zum Vater und sind aus den Flammen gerettet. Nun aber erkennen sie die Wahrheit, und der Vater gibt ihnen allen nur die besten und wertvollsten Wagen, nämlich Ochsenkarren. Das brennende Haus gleicht der menschlichen Existenz im Leiden. Der Vater ist der Buddha, die Kinder sind die Menschen mit verschiedenen Neigungen und Temperamenten. Die versprochenen Wagen entsprechen den drei Fahrzeugen der Arhats, Pratyekabuddhas und Bodhisattvas. Der kostbarste Ochsenkarren, den sie dann alle empfangen, ist das eine Fahrzeug oder buddhayana, das im Lotos-Sutra gelehrt wird, das Mahayana also. Die anderen Fahrzeuge sind nicht falsch, sondern geschickte Mittel, die der Buddha angewandt hat, um die Menschen wachzurütteln. Allerdings ist nun, da das Mahayana gepredigt wird, eine große Chance gegeben, die auch die Arhats im H´nayana, Pratyekabuddhas und Bodhisattvas wahrnehmen sollten, denn auch im Lotos-Sutra wird angedeutet, dass die Kapazität derer, die dem H´nayana folgen, vervollkommnet werden muss, denn sie sind zu sehr mit sich selbst beschäftigt, verfolgen nur ihr eigenes Heil und sind damit noch nicht frei von egozentrischem Verlangen30. Wer die große Chance zur Neubesinnung im Sinne des bodhisattva- und ekayana-Ideals wahrnimmt und somit die wahre Intention des Buddha, der das Lotos-Sutra predigt, erkennt, hat Grund zur Freude, denn seine Befreiung ist umfassend und großartig. Genau diese Botschaft ist der Sinn des berühmten Gleichnisses vom »Verlorenen Sohn«, das äußerlich dem Gleichnis Jesu bei Lukas (Lk 15, 11–32) so ähnlich scheint und damit immer wieder verglichen worden ist, aber doch einen ganz anderen Sinn hat.31 1 Gleichnis vom verlorenen Sohn (aus dem 4. Kapitel) Text (übersetzt von Margareta von Borsig) Zu dieser Zeit, als der weisheitsbestimmte Subhuti, Maha-Katyayana, Maha-Kashyapa und Maha-Maudgalyayana von Buddha das Gesetz hörten, was noch nie dagewesen, und der von aller Welt Verehrte dem Shariputra die Prophezeiung der höchsten vollkommenen Erleuchtung gab, hatten jene die Empfindung von etwas Ungewöhnlichem und waren vor Freude außer sich. Sie erhoben sich von ihren Sitzen, ordneten ihre Kleider, entblößten demütig ihre rechte Schulter, mit ihrem rechten Knie berührten sie den Boden, aus ganzem Herzen drückten sie ihre Handflächen zusammen, sich neigend erwiesen sie dem Buddha Ehrerbietung; dann blickten sie auf zum ehrwürdigen Antlitz, sprachen Buddha an und sagten: »Wir, die Häupter der Mönche, sind durch die Jahre belastet und verbraucht. Wir dachten, dass wir bereits das Nirvana erlangt haben und mehr nicht erreichen können. So bemühten wir uns auch nicht mehr um die höchste vollkommene Erleuchtung. Der von aller Welt Verehrte hat eine lange Zeit hindurch bereits das Gesetz gepredigt. Während wir auf unseren Sitzen saßen, wurden wir mit unseren Körpern milde und unbeteiligt, wir meditierten nur über die Leere, die Gestaltlosigkeit und das Nicht-Handeln, aber unser Herz hatte keine Freude daran, wie die Bodhisattvas in der überirdisch durchdringenden Kraft des Gesetzes zu wandeln, die Buddha-Länder zu reinigen und die Lebewesen zu vervollkommnen. Warum ist es aber so? Von aller Welt Verehrter, du hast bewirkt, dass wir die dreifache Welt verlassen und die Bezeugung des Nirvana erlangt haben. Nunmehr bereits durch die Jahre belastet und verbraucht, stieg wegen der höchsten vollkommenen Erleuchtung, die der Buddha die Bodhisattvas lehrt und zu der er sie, (indem er sie) verwandelt, (hinführt), in unseren Herzen auch nicht auf Grund eines einzigen Gedankens Freude auf. Als wir jedoch jetzt in Gegenwart Buddhas hörten, dass er auch den Shravakas die Prophezeiung der höchsten vollkommenen Erleuchtung gibt, erlangten wir, im Herzen höchst erfreut, etwas, was noch nicht dagewesen. Ohne daran zu denken, konnten wir jetzt plötzlich das kostbare Gesetz hören. Wir sind zutiefst beglückt, dass wir mit einer so großen, segensvollen Zuwendung bedacht wurden. Wir bekamen, ohne dass wir danach strebten, ein unermesslich kostbares Juwel. Von aller Welt Verehrter! Wir möchten nun gerne eine Parabel erzählen und so diese Bedeutung klarmachen: |
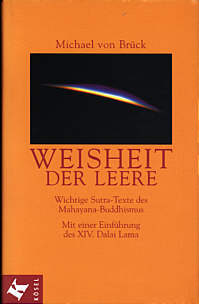
 Bei Amazon kaufen
Bei Amazon kaufen