|
|
|
Umschlagtext
Was wird aus Religion? Dazu gibt es weit ausgreifende Theorien, die meist auf »ung« enden: Säkularisierung, Pluralisierung, Individualisierung ...
Es sind Blicke aus der Vogelperspektive. Doch wie fühlt sich, was sich da wandelt, eigentlich aus der Nähe an, aus der Sicht derer, denen ihre Religion wirklich etwas bedeutet? Wie erleben sie den religiösen Wandel, die Transformationen in der Architektur des Religiösen? Wie irritierend ist das? Wie enttäuschend? Wie befreiend vielleicht auch? In welche Richtung zeigt die Entwicklung? Werden verbindliche Glaubensüberzeugungen noch eine Rolle spielen? Wird Religion nur noch von ästhetischem oder gar folkloristischem Interesse sein? Wird man Religion vielleicht eher als Ausdruck starker Erfahrungen und Gefühle verstehen? Oder vor allem als Impuls zu einer Praxis der Nächstenliebe und der Solidarität? Ausgehend von Beobachtungen und Fallgeschichten diskutiert das Buch verschiedene Möglichkeiten der Entwicklung. Was also wird aus Religion? Und wie können die, denen an ihr gelegen ist, dazu beitragen, dass Religion nicht trivial wird? Rudolf Englert Geboren 1953 in Würzburg. Studium in Würzburg und Bochum. Diplom in kath. Theologie und Pädagogik. Wiss. Mitarbeiter in Bochum und Bonn. Promotion 1985, Habilitation 1992. Seit 1992 Professor für Religionspädagogik an der Universität Duisburg-Essen. Verheiratet, Vater von drei Kindern. Rezension
Der Autor, katholischer Religionspädagoge, weiß nur zu gut, dass sich die Frage nach dem Wesen von Religion kaum beantworten läßt. Und so fragt er denn auch nicht nach dem Wesen von Religion sondern nach der Gegenwart und Zukunft von Religion; es geht weniger um die Frage, was Religion an sich und als solche ist, als darum, wie sie aktuell in Erscheinung trittund in welche Richtung sie sich entwickelt. Sicherlich, dazu gibt es viele Hypothesen und Theorien: Säkularisierung, Pluralisierung, Individualisierung ... Aber auch darum geht es dem Autor nicht primär; ihn interessieren eher Fallbeispiele, in denen deutlich wird, wie sich der Wandeln des Religiösen vollzieht und wie sich das anfühlt, welche Veränderungsprozesse damit verbunden sind und in welche Richtung das alles zu verlaufen scheint. Was also wird aus Religion? Und wie können die, denen an ihr gelegen ist, dazu beitragen, dass Religion nicht trivial wird?
Thomas Bernhard, lehrerbibliothek.de Verlagsinfo
Wahrnehmung aktueller Krisen-Phänomene des christlichen Glaubens ohne Scheuklappen gelebte Lösungsstrategien in Beobachtungen und Fallbeispielen Konsequenzen für eine zukunftsfähige Religions-Pädagogik Inhaltsverzeichnis
Vorwort 11
I. Die Architektur des Religiösen 13 1. Ein paar Warnungen vorweg 13 Das hat mit Religion nichts zu tun 13 - Der sanfte Mesut 14 - Auf den Trümmern einer Festung 15 - Herumgehen in einem weiten Feld 17 - Vom Wert einzelner Fälle 18 2. Religion - kaum zu fassen 21 Religion ist verwirrend Vieles 21 - Was hat der Feldhase mit einem schwarzen Quadrat gemeinsam? 23 - Die Religion der Anderen 26 3. Zur inneren Komplexität von Religion 28 Religion als eine Konfiguration sich verschlingender Schwaden 28 - Das Religiöse und seine Architektur 31 4. Religionspädagogische Perspektiven 34 Die Architektur des Religiösen und die Tradierung des Christlichen 35 - Eine religionspädagogische Propädeutik 38 II. Die Erosion des Dogmatischen 43 1. Beklemmende Ratlosigkeiten 43 Drei Formen der Tradierung christlichen Glaubens 43 - Kann man einem Ferkel erklären, was Religion ist? 45 - Kann man wissen, was im Grab geschieht? 47 - Was sagt Radio Vatikan zur Frage nach der Existenz Gottes? 49 - Der Zerfall der Voraussetzungen religiösen Wissens 52 2. Zweifelhafte Konzepte 54 Was kann uns die Bibel sagen? Das Konzept einer normativen Tradition 55 - Inwiefern kann Glaube wahr sein? Das Konzept theologischer Erkenntnis 58 - Was dürfen wir hoffen? Das Konzept eines geschichtsmächtigen Gottes 63 - Was hält den Glauben zusammen? Das Konzept einer kollektiven Heilsdramaturgie 66 —Zeigt sich Gott in der Welt? Das Konzept sakramentaler Transformation 70 3. Problematische Wahrheitsansprüche 74 Probleme mit einem Glauben, dessen Wahrheit dogmatisch fixiert ist 75 - Probleme mit einem Glauben, der Wahrheit beansprucht 78 - Probleme mit jedweder Art religiösen Glaubens 80 4. Religionspädagogische Perspektiven 83 Kann man den Glauben, auf »einem Bein stehend«, erklären? 83 — Lässt sich der Zerfall theologischer Konzepte religionspädagogisch auffangen? 85 - Können andere Komponenten des Religiösen den Einbruch des Glaubens kompensieren? 87 III. Die Zukunft des Christlichen 89 1. Innere Zerrissenheiten 90 Der Zwiespalt zwischen der Logik des Tages und den Ängsten der Nacht 90 - Der Zwiespalt zwischen Kinderglaube und Kirchenkritik 93 - Der Zwiespalt zwischen Frömmigkeit und Atheismus 95 - Verschiedene Weisen des Umgangs mit religiöser Ambivalenz 98 2. Deutliche Verschiebungen 100 a. Verschiebungen in Richtung des Ästhetischen 103 Das Spiel als Wesen des Kultischen? 103 - Croyance oder foi? 105 — Religion um ihres kulturellen Mehrwerts willen? 107 - Wenn das Ästhetische wichtiger würde: Religionspädagogischer Ausblick 110 b. Verschiebungen in Richtung des Emotionalen 111 Hat das Konzept einer rationalen Religion keine Zukunft mehr? 111 — Ist das Gefühl im Bereich des Religiösen wichtiger als die Vernunft? 113 - Das Gefühl der Resonanz und die Idee einer antwortenden Welt 113 - Wenn das Emotionale wichtiger würde: Religionspädagogischer Ausblick 121 c. Verschiebungen in Richtung des Ökonomischen 122 Wie geht man mit unentscheidbaren Fragen um? 122 - Sind religiöse Entscheidungen eine Frage ökonomischen Kalküls? 127 - Welche Rolle spielen Überzeugungen in der religiösen Kosten-NutzenBilanz? 130 - Wenn das Ökonomische wichtiger würde: Religionspädagogischer Ausblick 133 d. Verschiebungen in Richtung des Praktischen 135 Worin besteht die empirische Bedeutung religiösen Glaubens? 136 — Durch religiöse Überzeugungen eröffnete Handlungsmöglichkeiten 139 - Eine jesuanisch inspirierte Lebenspraxis als das eigentlich Christliche? 143 - Wenn das Praktische wichtiger würde: Religionspädagogischer Ausblick 145 3. Parallele Religionskulturen? 146 Wechselseitige Abstoßungen 147 - Kommt es zur Entwicklung paralleler Christentümer? 150 - Der schwindende Sinn für die Ganzheitlichkeit des Religiösen 152 4. Religionspädagogische Perspektiven 156 Religion als Raum produktiver Fiktionen? Akzentuierung des Ästhetischen 157 - Religion als Herzenssache? Akzentuierung des Emotionalen 158 - Den Nutzen der Religion herausstreichen? Akzentuierung des Ökonomischen 161 - Die humane Qualität christlicher Lebenspraxis betonen? Akzentuierung des Praktischen 164 IV. Die Gegenwart des Überkommenen 167 1. Irritierende Ungleichzeitigkeiten 168 Eine alttestamentliche Lesung beim Bochumer Musiksommer 168 — Petras Entsetzen 170 - Ein seltsamer Zug läuft in den Hauptbahnhof ein 174 - Produktive Ungleichzeitigkeiten und irritierende Decalages 176 2. Religiöse Epochenschwellen 179 a. Von einer »apokryphen« zu einer »geistigen« Ebene 180 Ein schlichtes Herz: Die Schlüsselszene 181 — Nur Folklore: Die dominante Deutung 183 — Wo Religion zur Heimat wird: Verlorengegangenes 186 b. Von einer kultisch zu einer ethisch orientierten Religion 188 Prüfung im Neuen Testament: Die Schlüsselszene 188 — Die Entbehrlichkeit des Kultischen in der Moderne: Die dominante Deutung 189 — Kommunikation mit etwas Verehrungswürdigem: Verlorengegangenes 191 c. Von einer sakramentalen zu einer rationalistischen Weltsicht 194 — Empfindsame Herzen unter leeren Himmeln: Die Schlüsselszene 194 — Religiöse Aufklärung führt zur Entkräftung der Religion: Die dominante Deutung 197 — Die Welt wird unlesbar: Verlorengegangenes 199 d. Von wesentlichen zu marginalen Distinktionen 202 Geordnet wie die Stockwerke von Dantes Purgatorium: Die Schlüsselszene 202 — Religiöse Distinktionsschemata verlieren ihren Wert: Die dominante Deutung 204 — Die ökonomische Logik fordert ihren Tribut: Verlorengegangenes 207 e. Wie reagieren auf die verschiedenen Ausprägungen religiöser Ungleichzeitigkeit? 210 3. Unterschiedliche Erklärungsansätze 212 Dispositionen von epochaler Prägekraft 212 — Friktionen zwischen diesseits- und jenseitsorientierter Religiosität 213 — Friktionen zwischen institutionalisierter und individualisierter Religiosität 219 — Friktionen zwischen der mythischen und der rituellen Dimension des Religiösen 224 — Fazit: Perspektiven zur religionsgeschichtlichen Entwicklung 228 4. Religionspädagogische Perspektiven 231 Zellen einer sich als Lerngemeinschaft verstehenden Christenheit initiieren 232 — Ein Beispiel: Die Arbeit am Ritus 235 —Überlegungen zur Entwicklung ritueller Kompetenz 238 V. Der Sinn des Gefährdeten 241 1. Religion ohne Konfession 243 I did it my way: Paula erzählt 243 — Gott hilft, auch wenn wir ihn selbst geschaffen haben: Martina theologisiert 246 — Konkomitanzen und Perichoresen 249 2. Komponenten im Zusammenspiel 253 a. Braucht Erfahrung Tradition? 253 Der Thingplatz 253 — Religionssensibler Atheismus 255 — Tradition konstituiert Bedeutungsräume 258 — Was religiöse Tradition für Transzendenzerfahrungen leistet 261 b. Haben Gefühle Vernunft? 265 Ein Experiment geht schief 265 — Ist die Religion eine Art Sprache? 270 — Aber »lebt« Gott dann nicht nur im Text? 275 — Der Erkenntniswert der Gefühle 278 — Gefühle können sehr Verschiedenes sein 281 c. Ist glauben ein Tätigkeitswort? 284 Vielleicht ist das Beeindruckendste am Schmetterling, dass er eine Raupe war 284 — Existenzielle Wahrheit erschließt sich in personaler Zeugenschaft 286 — Inwieweit kann die Praxis von Christen/-innen die Wahrheit ihres Glaubens verbürgen? 289 — Der Christ als Jedermann 291 3. Religionspädagogische Perspektiven 293 Das Bemühen um religiöse Resonanzfähigkeit 294 — Stärkung des Sinns für den Realitätsbezug religiöser Gefühle 297 — Ausweitung des Blicks auf partizipative Lernformen 302 — Religionsunterricht reicht nicht 304 VI. Dank an die Mitwirkenden 309 Literatur 313 Register der Personen 323 |
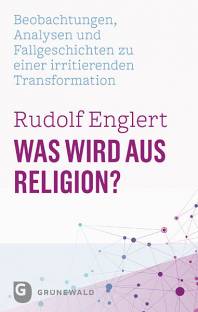
 Bei Amazon kaufen
Bei Amazon kaufen