|
|
|
Umschlagtext
"Die Differenz zwischen den physischen, sozialen und ökonomischen Räumen der Stadt wird an den Grenzverläufen sichtbar und spürbar."
"Was wir in der Moderne unter Geschmack verstehen, ist Resultat einer zivilisationshistorischen Einstellung der Sinnlichkeit nach subkulturellen Standards." "Das Erleben räumlicher Umgebungen vollzieht sich im Medium emotionaler Teilhabe." Jürgen Hasse Rezension
Wie stellen Atmosphären und Stimmungen soziale Beziehungen her? Wodurch unterscheidet sich der mathematische Raum vom erlebten Raum? Was sind Denkräume? Bedarf unsere Esskultur einer ästhetischen Kritik? Benötigen wir eine Ethik des Essens? Spielen Synästhesien in der Architektur eine Rolle? Ist die Stadt ein „Gefühlsraum“(Hermann Schmitz)? Wie übt man das Wohnen? Worin besteht die Eigenart von Industrie-Brachen? Welche Atmosphären besitzen heilige Räume und Bestattungsorte? Ist Weihnachtsbeleuchtung ein kulturindustrielles Produkt? Wie werden Landschaften als Erlebnisräume konstituiert bzw. konstruiert?
Diesen Fragen der Raumphilosophie geht Jürgen Hasse (*1949) in seinem Buch „Was Räume mit uns machen – und wir mit ihnen“(2. Auflage 2015) nach. Das im Verlag Karl Alber publizierte Werk enthält überwiegend seine in Sammelbänden und Zeitschriften zwischen 2006 und 2013 veröffentlichten Aufsätze, die sich einem breiten Spektrum von Disziplinen zuordnen lassen: Humangeographie, Naturphilosophie, Ontologie, Ästhetik und Architekturtheorie. Der mittlerweile emeritierte Professor für Humangeographie an der Johann Wolfgang Goethe-Universität (Frankfurt/Main) leistet mit seinem Buch einen wichtigen Beitrag zum Verständnis des Raumerleben. Bei seiner tiefschürfenden Ausleuchtung von Mensch-Raum-Beziehungen rezipiert Hasse produktiv insbesondere das „System der Philosophie“ von Hermann Schmitz, dem Begründer der Neuen Phänomenologie. Außerdem rekurriert der Geograph, der auch Vorstandsmitglied der Gesellschaft für Neuere Phänomenologie e.V. (GNP) ist, bei seinen raumphilosophischen Reflexionen u.a. auf Martin Heideggers Wissenschaftskritik, Helmuth Plessners „Anthropologie der Sinne“, Erwin Straus` phänomenologischer Psychologie und Otto Friedrich Bollnows hermeneutischer Philosophie. Aufgrund der Verknüpfung von Phänomenologie mit „kulturkritischen Theorien zur Vergesellschaftung des Menschen“(S. 16) spricht Hasse in seinen Schriften von kritischer Phänomenologie. Seine im Buch dargelegten Erkenntnisse unterstreichen die Fruchtbarkeit eines phänomenologischen Philosophierens. Lehrkräfte der Fächer Philosophie, Ethik und Geographie erhalten durch Hasses Beiträge sehr gute Anregungen, um in ihrem Fachunterricht oder in einem fächerübergreifenden Projekt, ausgewählte Räume der Lebenswelt und grundlegende raumphilosophische Fragen zu thematisieren. Fazit: Jürgen Hasse ist mit seinem Band „Was Räume mit uns machen – und wir mit ihnen“ ein Standardwerk einer phänomenologisch orientierten Raumphilosophie gelungen, das neue Denkräume eröffnet. Dr. Marcel Remme, für lehrerbibliothek.de Verlagsinfo
Räume gibt es nicht nur im topographischen, kulturellen, ökonomischen und politischen, sondern auch im leiblichen Sinne. Atmosphärisch entfalten sie spürbare Macht über die Gefühle der Menschen; in sakralen Milieus anders als auf den kulturindustriellen Bühnen subversiver Manipulation. In den Mittelpunkt des Bandes rückt nicht der Raum der Geographen und Landvermesser, in dem die Dinge relational geordnet sind, sondern der mit Vitalqualitäten besetzte leibliche Raum. In einem Gefühlsspektrum, das sich situativ zwischen Weite und Enge differenziert, werden Umgebungen als einladend und entspannend oder als abweisend und beengend erlebt. Über die Brücken »leiblicher Kommunikation« werden solche Milieus als »umwölkende« Herumwirklichkeiten spürbar. Thema des Buches sind nicht umweltliche Konstellationen, sondern mitweltliche Situationen, die in einem »Akkord« der sinnlichen Wahrnehmung ganzheitlich erfasst werden. An Beispielen wird sich zeigen, dass die phänomenologische Sicht auf den leiblichen Raum kritische Erklärungsansätze für die Sozialwissenschaften anzubieten hat. Auf einer interdisziplinären Schnittstelle kommen nicht nur die Adressaten und Betroffenen atmosphärisch gestimmter Räume in den Blick, sondern - wo diese nach gesellschaftlichen Interessen hergestellt worden sind - auch die planenden Akteure suggestiver Inszenierungen. Der Band setzt sich in 20 Beiträgen mit dem Verhältnis von Raum und Gefühl auseinander. Im Fokus stehen Situationen der Vergesellschaftung des Menschen. Sie schlagen Brücken von der (Neuen) Phänomenologie zu Sozialwissenschaften, Stadtforschung, Architekturtheorie und anderen Disziplinen. Jürgen Hasse, Dr. rer. nat. habil., geb. 1949, war von 1993 bis 2015 Professor am Institut für Humangeographie der Johann Wolfgang Goethe-Universität Frankfurt am Main; Forschungsschwerpunkte: Räumliche Vergesellschaftung des Menschen, Raum- und Umweltwahrnehmung, phänomenologische Stadtforschung, Mensch-Natur-Verhältnisse, Ästhetik; Autor zahlreicher kulturwissenschaftlicher Bücher. Inhaltsverzeichnis
Einleitung 11
1. Räume menschlichen Lebens. Zur Ontologie von Raum und Räumlichkeit zwischen Natur und Kultur 21 1.1. Der mathematische Raum 22 1.2. Der symbolische Raum 24 1.3. Der soziale Raum 28 1.4. Der leibliche Raum 31 1.5. Der Situationsraum 35 1.6. Denkräume 39 2. Die Stadt als Raum der »Patheure« 43 2.1. Die konstruktivistische Reduktion des Raums 43 2.2. Stadt der Patheure 45 2.3. Mythische Räume 46 2.4. Wissenschaft und Mythos 47 3. Leibliche Kommunikation und Architektur Zur Bedeutung synästhetischer Wahrnehmung 49 3.1. Leibliche Kommunikation 49 3.1.1 »Klingende Profile« und »gläserne Schiffe« 52 3.1.2 Zur Geringschätzung synästhetischen Wahrnehmens 54 3.2. Synästhesien in der Phänomenologie 57 3.2.1 Synästhetische Charaktere in der Neuen Phänomenologie 59 3.3. Synästhetische Charaktere in der Architektur 63 3.3.1 Justizpalast von Boullee (um 1780) 66 3.3.2 »Fallingwater« von Frank Lloyd_Wright (1935-1939) 68 3.4. Die Bauformen 69 3.5. Die Baustoffe und ihre Materialität 72 4. Ernährung - eine Dimension sinnlicher Erfahrung. Eine ästhetische Kritik der Kultur des Essens und Trinkens 78 4.1. »Ernährung« versus essen und trinken 79 4.2. Die Atmosphären des Essens 82 4.3. Der eine und der andere Geschmack 84 4.4. Die symbolische Codierung der sinnlichen Dimension von Lebensmitteln 87 4.5. Die sinnliche Transformation des Essens 92 5. Nähe- und Ferneverhältnisse im Essen Das Beispiel der Garnele 96 5.1. Essen - ein Thema der Wirtschaftsgeographie? 96 5.2. Ethische Implikationen des Essens 97 5.3. Rudimente zur Biologie der Garnele 100 5.4. Fischerei, Zucht und Verarbeitung 102 5.5. Die Garnele als Nahrungsmittel 108 5.6. Der ästhetizistische Rahmen des Ethischen 109 5.7. Das ethisch und ästhetisch gespaltene Verhältnis zum gegessenen Tier 112 5.8. Umriss einer holistischen Ethik des Essens und der Natur 115 6. Stadt als diffuser Begriff. Zur Erhellung und Verschattung des Wirklichen durch kontingente Begriffe 120 6.1. Der Begriff der Stadt als unscharfe Bezeichnung 123 6.2. Die Rolle von Welt- und Menschenbildern 124 6.3. Begriff und Metapher 127 6.4. Zur Ontologie der Stadt 128 6.5. Die Stadt als Gegenstand der Phänomenologie 129 6.6. Grenzen der Rationalität 130 6.7. Zum Verhältnis von Rationalität und Irrationalität in der Wissenschaft 132 6.8. Die Stadt ist ein situativer Raum 135 6.9. Zum Beispiel: Der Slum als Situation der Megapolis 138 7. Stadtraum im Gleichgewicht. Das eine und das andere (Be-) Denken der: Stadt 142 7.1. Gleichgewichte und Ungleichgewichte in stadträumlichen Entwicklungen 143 7.2. Stadtforschung im (Un-) Gleichgewicht 145 7.3. Wissen - Kommunikation - Denken 146 7.4. In der Provinz wissenschaftlicher Diskurse 149 8. Zum Situationscharakter des Wohnens. Kann man »Wohnen« üben? 151 8.1. Wohnen - eine Orientierung 152 8.2. Die Wohnung als Hort von Situationen 153 8.3. Die Lagerung persönlicher in gemeinsamen Situationen 155 8.3.1 Wohnen im Kloster 155 8.3.2 Wohnen in der Seemannsmission 157 8.4. Zur Bedeutung der Dinge 160 8.5. Das Wohnen üben 161 9. »Ein apfelgrüner 2CV.« Über die Schwierigkeiten, einen Ort zu beschreiben 166 9.1. Einstimmende Zusammenfassung 166 9.2 Der Raum eines Platzes 168 9.3 Versuch einen Platz zu erfassen - ein Selbstversuch? 170 10. Stadt und Gefühl. Zur postmodernen Ästhetisierung der Städte 174 10.1. Der postmoderne Glanz der Städte 175 10.2. Zum Verstehen ästhetischen Raumerlebens 179 10.2.1 Der »gelebte Raum« 181 10.2.2 Der atmosphärische Raum 185 10.2.3 Rationalität und Irrationalität im Stadtleben 189 10.3. Städtische Illumination - sentimentales Licht 192 10.4. Gärten: Emotionale Grünräume 193 10.5. Architektur und Mythos 194 10.6. Wissenschaftspsychologische Konsequenzen 197 11. Atmosphären der Stadt. Die Stadt als Gefühlsraum 202 · 11.1. Atmosphären im Allgemeinen 203 11.2. Das übergehen (und die Wiederaneignung) der Gefühle 211 11.3. Atmosphären als Gegenstände der Konstruktion 213 11.4. Zum Verhältnis von Atmosphären und Stimmungen 214 11.5. Zur sinnlichen Erlebbarkeit von Atmosphären 216 11.6. Zusammenfassung 224 12. Atmosphären und Stimmungen. Gefühle als Medien der Kommunikation 227 12.1. Zur Ontologie von Atmosphären und Stimmungen 228 12.2. Atmosphären als Stimmungsmedien 233 12.3. Gärten als konstruierte Gefühlsräume und atmosphärische Stimmungsmedien 238 12.4. Die postmoderne Stadt im schönen Schein 244 13. Zur kommunikativen Macht von Atmosphären. Zur Bedeutung von Atmosphären im Regieren der Stadt 249 13.1. Was sind Atmosphären? 250 13.2. Atmosphären und Stimmungen 254 13.3. Atmosphären sind Medien der Kommunikation 257 13.4. Atmosphären entfalten Macht 259 13.5. Atmosphären verstehen - im Regieren der Stadt wie des eigenen Selbst 260 14. Die Brache. Eigenart und Atmosphäre 266 14.1. Eigenart von (Industrie-) Brachen 266 14.2. Atmosphäre der Verlassenheit 271 14.3. Die Brache in der Stadt 273 15. Atmosphären des Lichts - immersive Medien des Urbanen. Künstliches Licht zwischen kulturindustrieller Sedierung und einer Kritik der Stadt 276 15.1. Atmosphären des Lichts und Urbanität 277 15.2. Diskurse über Licht und seine atmosphärische Wirkung 281 15.3. Zur Ontologie von Atmosphären des Lichts 283 15.4. Die Illumination des Profanen: das Parkhaus als exzentrischer Ort 287 15.5. Weihnachtsbeleuchtung 290 15.6. Licht-Kunst im öffentlichen Raum 292 16. Atmosphären im heiligen Raum. Zur Autorität von Gefühlen im heterotopen Raum 297 16.1. Kirchen als heterotope Bauten 297 16.2. Der sakrale Raum als sinnlich-ästhetischer Raum 299 16.3. Zum Zusammenhang von Atmosphäre und Bewegung 300 16.4. Macht durch Einfluss 302 16.5. Die Macht numinoser Atmosphären 304 16.6. Atmosphärologische Medien 305 16.7. Raum der Besinnung 308 17. Die Küste als gelebter Raum und die Sprache der Wissenschaft. Formen ästhetischer Anschauung an den Rändern der Wissenscha 309 17.1. Die eine und die andere Küste 309 17.2. Küste und Meer - in der Sprache der Naturwissenschaften 314 17.3. Küste und Meer -Atmosphären ästhetischen Erlebens 315 17.3.1 Der Malstrom (Edgar Allan Poe) 316 17.3.2 Das Meer (Jules Michelet) 320 17.4. über die mögliche Bedeutung von Gefühlen im wissenschaftlichen Denken 328 18. Landschaft. Zur Konstruktion und Konstitution von Erlebnisräumen 335 18.1. Die naturwissenschaftliche Landschaft 336 18.2. Landschaft - zwischen Realität und Wirklichkeit 337 18.3. Landschaft - phänomenologische Annotierungen 339 18.4. Erlebnislandschaften - imaginiert und inszeniert 341 18.4.1 Die poetisch beschriebene (Stadt-) Landschaft 342 18.4.2 Die qua Architektur eingeräumte Landschaft 344 18.4.2.1 Casa Mar Azul (Argentinien) 345 18.4.2.2 Villa M 2 (Malmö) 348 18.4.2.3 Restaurant Tusen (Ramundberget) 18.4.2.4 Gipfelplattform »Top of Tyrol« 350 (Stubaier Gletscher) 352 18.4.2.5 Elbphilharmonie (Hamburg) 353 19. Bestattungsorte. Zur Atmosphäre sepulkralkultureller Räume der Gegenwart 356 19.1 Sepulkralkulturelle Räume im Allgemeinen 358 19.1.l Zum Begriff der (sepulkralkulturellen) Atmosphäre 358 19.1.2 Atmosphären als mythische Vermittler 359 19.2 Sepulkralkulturelle Orte und ihre Atmosphären 362 19.2.1 Heterotope Räume und ihre Atmosphären 362 19.2.1.1 Der Friedhof 363 19.2.1.2 Das Einzelgrab - Ort des Begräbnisses 365 19.2.1.3 Feuerbestattung- Kolumbarien und Urnengräber 368 19.2.1.4 Mausoleen 372 19.2.1.5 Gemeinschaftsfelder 375 19.2.1.6 Gedenkorte 377 19.2.2 Extra-heterotope Räume und ihre Atmosphären 378 19.2.2.1 Friedwälder 378 19.2.2.2 Seebestattung 382 19.2.2.3 Luftbestattung 384 19.2.2.4 Andere Urnen- und Ascheverortungen 385 19.3 Verortungen des Todes 387 20. Zur Atmosphäre einer imaginären Landschaft. Die »Toteninsel« von Arnold Böcklin 389 20.1 Atmosphäre und Aura 389 20.2 Die Toteninsel 393 20.3 Die Eindrucksmacht des Numinosen 397 20.4 Landschaft als Konstruktion? 399 20.5 Das konstitutive Moment im Erleben von Landschaften 400 20.6 Die Toteninsel - eine denkwürdige Landschaft 401 Literaturverzeichnis 405 Nachweise 426 Abbildungsnachweise 428 Sachregister 429 |
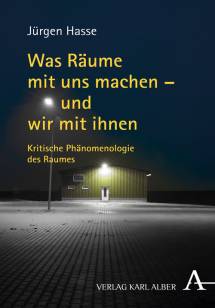
 Bei Amazon kaufen
Bei Amazon kaufen