|
|
|
Umschlagtext
Peter Blickle bietet eine souveräne Darstellung der Gechichte der Freiheit in Deutschland vom Mittelalter bis zur Moderne. Anhand zahlreicher eindrucksvoller Beispiele aus über 600 Jahren und aus allen Regionen des Reiches von der Ostsee bis an die Schweizer Alpen beschreibt er, welche Formen der Leibeigenschaft es gab und wie es Untertanen gelang, ihre Freiheit und mit ihr Eigentum und politische Rechte durchzusetzen, die Grundlagen der modernen Menschen- und Bürgerrechte.
Rezension
Die Frage nach der Universalität und der Durchsetzung der Menschenrechte hat gegenwärtig angesichts zahlreicher Menschenrechtsverstöße nichts von ihrer Aktualität verloren. Im schulischen Unterricht wird die Auseinandersetzung mit der Geschichte der Menschenrechte oftmals auf zwei welthistorische Dokumente auf die „Virginia bill of rights“ bzw. die Amerikanische Unabhängigkeitserklärung (1776) und auf die französische „Erklärung der Menschen- und Bürgerrechte“ (1789) didaktisch reduziert. Ohne die historische Bedeutung dieser positivierten Menschenrechtskataloge relativieren zu wollen, wird durch das Vorgehen im Geschichtsunterricht ein undifferenziertes Bild der Menschenrechtshistorie bei den SchülerInnen verankert. Erstens suggeriert ein derartiges Vorgehen, dass Menschenrechte ausschließlich ein Produkt der Moderne seien und somit der Frühen Neuzeit für den Prozess ihrer Herausbildung keine zentrale Bedeutung zukomme. Zweitens wird durch die schulische Herangehensweise der Eindruck erweckt, dass sich Menschenrechte nur in Amerika und in Frankreich herausbildeten, dieses aber im Heiligen Römischen Reich Deutscher Nation keine Rolle spielte.
Diese historischen Fehleinschätzungen deckt Peter Blickle, Professor für Neuere Geschichte an der Universität Bern, in seinem Buch „Von der Leibeigenschaft zu den Menschenrechten. Ein Geschichte der Freiheit in Deutschland“ auf. Das 2003 erstmals, 2006 in zweiter Auflage bei „C. H. Beck“ erschienene Werk richtet sich an Fachwissenschaftler, an GeschichtsstudentInnen, GeschichtslehrerInnen und an den historisch interessierten Laien. Der anerkannte Neuzeit-Historiker vertritt in seinem Buch die These, dass sich die Menschenrechte am „Institut der Leibeigenschaft“ entwickelt haben (S. 11). Dieses erfordert auch eine angemessene Berücksichtigung „Deutschlands“ bei der Genese der Menschenrechte: „Deutschland hat zugleich mit Amerika und Frankreich Freiheit und Eigentum einerseits und Bürgerrechte anderseits teils in Gesetzen, teils in Verfassungen niedergelegt.“(S. 15) Blickle geht dabei von zwei Prämissen aus. Zunächst kritisiert er die die historische Herleitung der Menschen- und Bürgerrechte aus dem philosophischen bzw. politiktheoretischen Diskurs. Gegenüber einer theoretischen Ableitung der Menschenrechte wählt der Berner Historiker in seinem Werk einen anderen Weg; er untersucht nämlich die Verankerung der Menschenrechte in historischen Realität. Profunde Quellenstudien demonstrieren nämlich, dass Freiheit im Unterschied zur politischen Partizipation zunächst „leibhaftige Freiheit“ beinhaltet, also die Freiheit, „die Menschen als Rechte einräumt, über ihre Arbeit und ihren Arbeitsertrag zu verfügen, verbunden mit Ehefreiheit und Freizügigkeit.“(S. 17) Die Auseinandersetzung mit dieser Freiheit, genauer mit der Einschränkung bzw. Negierung dieser durch die „Eigenschaft“ bzw. Grundherrschaft, so kann Blickle in seinem Buch belegen, lässt sich seit dem Mittelalter auch im Heiligen Römischen Reich deutscher Nation nachweisen. Als Stationen dieses Konfliktes sind u.a. zu nennen: die spätmittelalterliche Stadt, der Bauernkrieg, die eidgenössische Republik, die Reformation. Diese Fakten demonstrieren die im schulischen Unterricht vernachlässigte Kontinuität des Freiheitsdiskurses seit dem Mittelalter. Peter Blickle gelingt es mit seinem Buch, das in der historischen Zunft mehr Aufmerksamkeit verdient hätte, die realgeschichtliche Genese der Menschenrechte im deutschsprachigen Raum aufzuzeigen und damit einer historischen und in der Öffentlichkeit verbreiteten Blickverengung vorzubeugen. Interessant wäre die Übertragung dieses Ansatzes auf die englische, amerikanische oder französische Geschichte und die Integration von Ideen- und Realgeschichte, was aber ein neues Buch erforderlich machen würde. Dr. Marcel Remme, für lehrerbibliothek.de Verlagsinfo
Eine Geschichte der Freiheit in Deutschland. Ausgezeichnet mit dem Preis Das Historische Buch, Kategorie Geschichte der Frühen Neuzeit 2003 Inhaltsverzeichnis
Vorwort 11
Einleitung 13 Teil I Von der mittelalterlichen Leibeigenschaft zur modernen Freiheit Leib und Gut – Das ungelöste Problem des Mittelalters 25 Wir wollen frei sein – Der Freiheitsdiskurs der Reformationszeit 75 Leibhaftige Politik und Körperökonomie – Adelsmacht und Kriegsfolgen 105 Napoleon ist an allem schuld? 153 Teil II Die Kraft der Leibeigenschaft – Zur Entstehung von öffentlichen Räumen, von Freiheit, Eigentum und bürgerlichen Rechten Die Entstehung des öffentlichen Raumes aus der Leibeigenschaft 177 Die Konstruktion von Freiheit und Eigentum aus der Praxis des Alltags 202 Die Theoretisierung von Leibeigenschaft und Freiheit 244 Schluss 298 Anhang Anmerkungen 317 Verzeichnis der Abkürzungen 383 Verzeichnis der Archive, der gedruckten Quellen und der Literatur 384 Verzeichnis der Abbildungen 407 Register 409 |
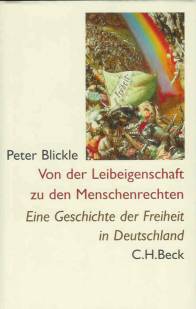
 Bei Amazon kaufen
Bei Amazon kaufen