|
|
|
Umschlagtext
Ulrich Wilckens' Theologie des Neuen Testaments besteht aus drei Bänden. Bd. I erzählt die Geschichte des Urchristentums historisch nach: vom Wirken und Geschick Jesu im Zeichen der Gottesherrschaft bis zur Entstehung des neutestamentlichen Kanons. Bd. II reflektiert diese Geschichte vielfältiger theologischer Themen dogmatisch auf ihre zugrundeliegende Einheit hin: die Wirklichkeit des Heilshandelns Gottes im Sühnetod und in der Auferweckung Jesu. Bd. III bietet eine methodenkritische Neuorientierung. Die Geschichte der historischen Bibelkritik wird ihrerseits einer historischen Kritik unterzogen.
Bd. I ist (anders als die Bde. II und III) in 3 Teilbände unterteilt. Der vorliegende Teilband l enthält zunächst eine ausführliche Einführung in das Gesamtwerk und beschreibt sodann die Geschichte des Wirkens Jesu in Galiläa. Ulrich Wilckens, Dr. theol., geb. 1928; 1958-1960 Dozent für Neues Testament in Marburg, 1960-1968 Professor für Neues Testament in Berlin und 1968-1981 in Hamburg; 1981-1991 Bischof der Nordeibischen Evangelisch-Lutherischen Kirche und »Catholica-Beauftragter« der Vereinigten Evangelisch-Lutherischen Kirche Deutschlands. Rezension
Nach dem berühmten Diktum Rudolf Bultmanns, dem ersten Satz seiner Theologie des Neuen Testaments, gehört "die Verkündigung Jesu ... zu den Voraussetzungen der Theologie des NT und ist nicht ein Teil dieser selbst." - Das stellt sich in dieser auf drei Bände in mehreren Teilbänden angelegten Theologie des Neuen Testaments des früheren Hamburger Neutestamentlers und Bischofs der Nordelbischen Evangelisch-Lutherischen Kirche deutlich anders dar; denn dieser erste Teilband von Band 1 widmet sich auf mehr als 300 S. ausschließlich der "Geschichte des Wirkens Jesu in Galiläa". Und Wilckens setzt nicht sofort mit Wirken und Verkündigung Jesu ein, sondern bietet zunächst auf mehr als 60 S. eine Einführung in die Gesamtkonzeption seiner Theologie des NT und dann auf nochmals mehr als 30 S. Orientierung über die Umwelt des NT, in das schließlich Jesu Botschaft von "Gottes Herrschaft und Reich" vermittelt über Johannes den Täufer eingebettet wird. Und schon diese Begrifflichkeit zeigt, wie schwierig sich diese Einordnung gestaltet; denn bekanntlich ist schon die Frage nach der angemessenen Übersetzung von "Basileia tou Theou" als Gottesherrschaft oder Reich Gottes höchst umstritten. Wilckens erläutert anschaulich und verständlich Jesu Botschaft von der Gottesherrschaft im Kontext seiner Zuwendung zu den Sündern, seiner Nächstenliebe- und Nachfolge-Forderung, seiner Radikalisierung der Tora und seinem missionarischen Anspruch. - Ein interessantes Buch (nicht nur) für alle, die "Jesus von Nazareth" regelmäßig im Religionsunterricht behandeln.
Jens Walter, lehrerbibliothek.de Verlagsinfo
Band I ist (anders als die Bde. II und III) in vier Teilbände unterteilt: Der 1. Teilband enthält eine ausführliche Einführung in das Gesamtwerk und einen ersten Abschnitt des historischen Teils: eine Skizze der religiösen Situation der Menschen in der Umwelt der ersten Christen, eine kurze zusammenfassende Darstellung des Wirkens Jesu im Zeichen der »Königsherrschaft Gottes«, eine Entfaltung der Verkündigung und Lehre Jesu und die Aktion der Aussendung der zwölf Jünger als Boten der Gottesherrschaft an Jesu statt. Inhaltsverzeichnis
Vorwort V
Einführung in das Gesamtwerk 1 1 Die christliche Deutung des Alten Testaments 2 1.1 Die christliche Deutung des Alten Testaments im Neuen Testament 3 1.2 Die eigenständige Botschaft des Alten Testaments 6 1.3 Das Recht neutestamentlicher Gottesverkündigung 12 1.4 Die Bedeutung des Alten Testaments für die Theologie des Neuen Testaments 13 2 Die Problematik einer Theologie des Neuen Testaments auf der durch die Aufklärung gelegten Basis historischer Bibelkritik 14 2.1 Der Ursprung der historischen Bibelkritik in der Aufklärung 15 2.2 Die Theologie der Aufklärung als Folge der Kirchenspaltung 19 2.3 Die Notwendigkeit kritischer Revision der historischen Bibelkritik 21 2.4 Die Wirklichkeit der Auferweckung Jesu 25 2.5 Das Problem des >historischen< Jesus 29 2.5.1 Das Geschichtsbild der Evangelien und der Evangelienkritik 30 2.5.2 Die unmessianische Verkündigung des vorösterlichen Jesus und die nachösterliche Verkündigung des erhöhten Christus 31 2.5.3 Die Kontinuität zwischen dem Passionsgeschehen und der urchristlichen Passionsverkündigung 32 2.5.4 Die Kontinuität zwischen dem Selbstverständnis Jesu und der urchristlichen Christusverkündigung 34 2.6 Das Verhältnis zwischen Jesus und dem Judentum 35 2.6.1 Das Judentum als negatives Gegenbild 36 2.6.2 Die Beheimatung Jesu im Judentum 39 3 Zum Aufbau der Theologie des Neuen Testaments 41 3.1 Zur Geschichte der Disziplin 41 3.1.1 Neutestamentliche Theologie in Geschichte und Gegenwart 41 3.1.2 Rein historische Darstellungen der Gegenwart 48 3.2 Zum Aufbau dieser Theologie des Neuen Testaments 50 3.2.1 Überblick 50 3.2.2 Vorblick auf Bd. I/2-3 51 3.2.3 Vorblick auf Bd. II 53 3.2.4 Bd. III als methodenkritische Rechtfertigung dieser Theologie des Neuen Testaments 59 3.3 Zur Sprache der Theologie des Neuen Testaments 63 3.4 Zur Anlage des Buches 65 I. Orientierung über die Umwelt des Urchristentums 67 1 Die innere Situation der Menschen in der Welt des Hellenismus 69 2 Die Geschichte des Judentums vom Makkabäeraufstand bis zum Jüdischen Krieg 73 2.1 Der Aufstand der Makkabäer 73 2.2 Makkabäer und Pharisäer 74 2.3 Die Essener 75 2.4 Die römische Herrschaft und Herodes der Große 76 2.5 Herodes Antipas 77 2.6 Pontius Pilatus 78 2.7 Der Krieg gegen die Römer und die Katastrophe Jerusalems 79 2.8 Das neue jüdische Zentrum in Jamnia und Tiberias 80 2.9 Die jüdische Diaspora 81 3 Grundzüge jüdischer Frömmigkeit zur Zeit des Urchristentums 83 3.1 Tora und Tempel 83 3.2 Gerechte und Sünder in Israel 84 3.3 Umkehr zur Tora als Ziel pharisäischer Volkserziehung 85 3.4 Der Tempel als zentraler Ort der Sündenvergebung 86 3.5 Radikalisierung der Toragerechtigkeit in der essenischen Gemeinschaft 87 3.6 Das Endgericht Gottes über alle Sünder als Thema apokalyptischer Enderwartung 89 3.7 Die heillose Lage der Sünder nach der Esra-Apokalypse 91 3.8 Zusammenfassung 93 II. Johannes der Täufer und Jesus 96 1 Johannes der Täufer 96 1.1 Das Wirken des Johannes als Prophet der Umkehr 97 1.2 Umkehr in der heillosen Situation Israels 97 1.3 Die >Taufe< der Umkehrwilligen 100 1.4 Umkehr bei Johannes und den Essenern 101 1.5 Der Schülerkreis des Johannes 104 2 Die Taufe Jesu 105 2.1 Jesus bei Johannes 105 2.2 Die Vision Jesu nach seiner Taufe 106 3 Das Urteil des Johannes über Jesus 109 4 Der Sieg des Sohnes Gottes über den Widersacher Gottes 111 4.1 Die Versuchung Jesu durch den Teufel 111 4.2 Der Sturz des Satans aus dem Himmel 114 4.3 Die Offenbarungseinheit von Vater und Sohn (Mt 11,25-27 / Lk 10,21f.) 116 5 Der Anfang des Wirkens Jesu in Galiläa 118 5.1 Umkehr zur herannahenden Gottesherrschaft 118 5.2 Endzeitliches Heil in Jesu Taten 119 5.3 Jesus und Johannes 121 5.4 Jüngerberufung und Nachfolgeexistenz 127 III. Gottes Herrschaft und Reich als zentrales Thema Jesu 131 1 Die alttestamentlich-jüdische Beheimatung der Rede von der Königsherrschaft Gottes 132 1.1 Die Königsherrschaft Gottes im täglichen Gebet und in der Tempelliturgie 132 1.2 Bei Deutcrojesaja und in der nachexilischen Prophetie 134 1.3 Die endzeitliche Zukunft der Gottesherrschaft und ihre Bedeutung für die Gegenwart 135 2 Die Königsherrschaft Gottes im Wirken Jesu in Galiläa 136 2.1 Die Seligpreisungen 137 2.2 Exorzismen und Heilungen 139 2.2.1 Jesu Exorzismen: Siege über die Dämonen 140 2.2.2 Jesu Heilungen: Heilswirkungen der Gottesherr schaft 145 2.2.3 Heilungsberichte zu Zwecken der Lehre (Typ A) 148 2.2.4 Glaube an die göttliche Macht Jesu 152 2.2.5 Heilungsberichte zu Zwecken der Mission (Typ B) 153 2.2.6 Die Ablehnung von Erweiswundern 161 3 Die Königsherrschaft Gottes in der Redeform von Gleichnissen 163 3.1 Gleichnisse als Redeform 164 3.2 Das Gleichnis vom Senfkorn 165 3.3 Die Gewißheit der zukünftigen Heilsvollendung 168 3.4 Widerstände in der Geschichte des Kommens der Gottesherrschaft 171 3.5 Die1 Annahme der Gottesherrschaft 175 3.6 Bewährung als Voraussetzung der Teilhabe an der künftigen Heilsvollendung 177 3.7 Zusammenfassung 183 IV. Sünder und Gerechte im Horizont der Gottesherrschaft 185 1 Jesu Zuwendung zu Sündern 185 2 Drei Gleichnisse vom Vorrang der Rettung Verlorener 188 3 Gerechte und Sünder im Horizont pharisäischer Theologie 198 4 Gottes Güte als das Kriterium für gerecht und ungerecht 201 4.1 Die Umkehrung der endzeitlichen Rangordnung 201 4.2 Gottes Güte will angerufen werden 204 4.3 Das schema-jisrael für Sünder, denen Gott vergeben hat 206 4.4 Drohung gegen die, die Jesu Verkündigung ablehnen 209 5 Die Verurteilung der Gerechten, die die Annahme der Sünder bestreiten 211 5.1 Kritik an Pharisäern, die Jesu Sündermahlzeiten ablehnen 213 5.2 Gegen pharisäische Kritik 215 5.3 Das Gleichnis vom Pharisäer und Zöllner 218 5.4 Direkte Polemik gegen Pharisäer 218 6 Ergebnis im Blick auf die Geschichte des Wirkens Jesu 225 6.1 Zusammenfassung 225 6.2 Stadien zunehmender Verschärfung des Verhältnisses zwischen Jesus und den Pharisäern 226 V. Leben im Kraftfeld der Gottesherrschaft 229 1 Nachfolge als radikaler Abschied 230 1.1 Abschied von allem Eigenen 230 1.2 Unverzüglichkeit und Ganzheit des Abschieds 233 1.3 Abschied von allem, was das eigene Leben ausmacht 236 1.4 Umkehr zur Gottesherrschaft in der Nachfolge Jesu 237 2 Lebenspraxis im Licht der Gottesherrschaft 238 2.1 Das Vaterunser 238 2.2 Vertrauen zu Gottes Güte im alltäglichen Leben 245 2.3 Die Liebe zu Gott und zum Nächsten 250 2.4 Die Praxis der Nächstenliebe 256 2.5 Ethische Konkretionen (I) 261 2.6 Zwischenüberlegung 265 2.7 Ethische Konkretionen (II) 268 2.8 Der endzeitliche Aspekt der Lebenspraxis 273 3 Zusammenfassung 280 VI. Die Tora in der Lehrverkündigung Jesu 282 1 Die grundsätzliche Geltung der Tora 282 2 Radikale Auslegung des Willens Gottes 286 3 Konflikte um die Geltung der Schabbatruhe 288 4 Konflikte um rituelle Reinheit 295 4.1 Die Bedeutung ritueller Reinheit im Judentum 295 4.2 Das Fehlen von Vorwürfen gegen Jesus wegen Verletzung der Reinheitstora 297 4.3 Der Lehrspruch von der Verunreinigung 297 5 Zusammenfassung 302 VII. Die Sendung der Boten und das Ende des Wirkens Jesu in Galiläa 304 1 Die Berufung des Zwölferkreises 304 1.1 Der Kreis der Zwölf 304 1.2 Die Bedeutung der Zwöll in der endzeitlichen Zukunft 306 2 Die Sendung der Zwölf als Boten Jesu 308 2.1 Das Ereignis der Sendung 308 2.2 Die Aussendungsrede 310 2.3 Das Wirken der Boten Jesu in der Kraft der Gottesherrschaft 313 3 Das Gericht über Israel aufgrund der Ablehnung der Verkündigung der Gottesherrschaft 314 3.1 Fluchsprüche gegen Städte, die Jesus ablehnen 314 3.2 Fluchsprüche gegen >diese Generation< 316 4 Nach der Rückkehr der Boten 320 4.1 Bedrohliche Aussicht für die Zukunft 320 4.2 Das Mahlwunder in der Einöde 323 4.3 Die Situation Jesu angesichts seiner Ablehnung durch die Mehrheit Israels 326 Literatur 329 Stellenregister (Auswahl) 339 |
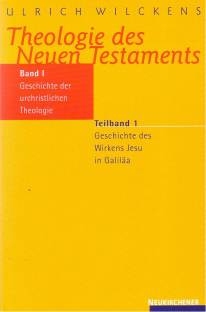
 Bei Amazon kaufen
Bei Amazon kaufen