|
|
|
Umschlagtext
Dieses weit verbreitete Lehrbuch vermittelt die Inhalte der Sozialpsychologie in anschaulicher, unterhaltsamer und einprägsamer Weise. Es behandelt die ganze Bandbreite der Sozialpsychoiogie und macht transparent, wie Theorien die Forschung inspirieren, warum Forschung so angewandt wird wie sie es wird, wie die Forschung wieder neue Interessensfelder erschafft und wie dies alles unser tägliches Leben berührt. Beispiele aus dem realen Leben inklusive der detaillierten Beschreibung klassischer und moderner Experimente erhöhen den angewandten, anwendbaren und nachvollziehbaren Nutzen.
Aus dem Inhalt: - Methoden lehre - Soziale Kognition - Soziale Perzeption - Einstellungen und Einstellungsänderung - Konformität - Gruppenprozesse - Pro-soziales Verhalten - Aggression - Vorurteile - Sozialpsychologie und Gesundheit - Sozialpsychologie und Umwelt - Sozialpsychologie und Recht ELLIOT ARONSON ist weltweit einer der angesehensten Sozialpsychologen. Er ist der einzige in der über 100-jährigen Geschichte der American Psychology Association, der alle drei wichtigsten akademischen Auszeichnungen erhalten hat: Für herausragende Lehre, für herausragende Forschung und für herausragende Veröffentlichungen. TIM D. WILSON ist Professor an der University of Virginia mit zahlreichen Veröffentlichungen und über zwanzigjähriger Lehrerfahrung in der Sozialpsychologie. ROBIN M. AKERT ist Professorin am Wellesley College, wo sie den Pinanski Preis für herausragende Lehre erhielt. Rezension
Es handelt sich bei dem anzuzeigenden Titel um ein hervorragendes, grundlegendes allgemeines Lehrbuch der Sozialpsychologie: Wer dieses Buch durchgearbeitet hat, kann im Bereich Sozialpsychologie nicht mehr durch das Examen fallen – und, wer es durchgearbeitet hat, wird eine Unmenge für das Leben gelernt haben; denn hier werden die grundlegenden Sachverhalte menschlichen Zusammenlebens behandelt: Gruppenprozesse, Aggression, Vorurteile etc. Sicherlich: der Titel ist US-amerikanisch geprägt; es handelt sich um eine deutsche Übersetzung aus dem Amerikanischen. Das merkt man z.T., z.B. an Absätzen wie „12.5: Hätte das Massaker von Columbine verhindert werden können?“ oder 16.2 „Die Jury (der Geschworenen)“. Und auch die Bilder stammen natürlich aus dem US-amerikanischen Kontext. Dennoch: dieses Lehrbuch ist grundlegend, verständlich geschrieben, wissenschaftlich verantwortet und mit anschaulichen Materialien versehen. Kurz: Unbedingt empfehlenswert, - auch für die Schulbibliothek.
Thomas Bernhard für lehrerbibliothek.de Stimmen aus der Presse: "Manchmal sind uns die Amerikaner einfach einen Schritt voraus. Wie im Fall dieses Buches, das eine Ausnahmerscheinung auf dem deutschen Buchmarkt sein dürfte. Dem Verlag Pearson Studium ist ein großer Wurf mit der Neuauflage von Aronson et al. gelungen. Die Faszination, die die Herausgeber „ihrem“ Fachgebiet Sozialpsychologie entgegenbringen, schlägt sich buchstäblich in insgesamt 16 Kapiteln nieder. Es geht nicht nur detallierter, farbiger und verständllicher zur Sache, sondern die Autoren verstehen es ebenso, schwierige Sachverhalte lebendig und lesernah zu erörtern..." (Martin Horn in http://www.sozialwesen-info.de/) Inhaltsverzeichnis
1. Einführung in die Sozialpsychologie2
1.1 Was ist Sozialpsychologie? 6 1.1.1 Alternativen zum Verständnis von sozialem Einfluss 8 1.1.2 Sozialpsychologie im Vergleich mit anderen Sozialwissenschaften10 1.1.3 Die Sozialpsychologie im Vergleich mit der Persönlichkeitspsychologie 11 1.2 Die Macht von sozialem Einfluss 13 1.2.1 Die Macht von sozialem Einfluss wird unterschätzt 14 1.2.2 Die Subjektivität der sozialen Situation 15 1.3 Der Ursprung von Konstrukten: Die zugrunde liegenden menschlichen Motive 18 1.3.1 Der Selbstwertansatz - Der Wunsch, mit uns selbst zufrieden zu sein 19 1.3.2 Der kognitive Ansatz in der Sozialpsychologie - Das Bedürfnis, akkurat zu sein . 21 1.3.3 Andere Motive 23 1.4 Die Sozialpsychologie und soziale Probleme 24 1.5 Sozialer Einfluss im Alltag 25 Zusammenfassung 26 Weiterführende Literatur 27 2 Methodologie: Wie Sozialpsychologen forschen 28 2. l Das Formulieren von Hypothesen und Theorien 31 2.1.1 Inspiration durch frühere Theorien sowie vorangegangene Forschung 33 2.1.2 Hypothesen, die auf persönlichen Beobachtungen beruhen 33 Die Beobachtungsmethode: soziales Verhalten beschreiben 34 2.2.1 Die Dokumentenanalyse (Archival Analysis) 35 2.2.2 Einschränkungen der Beobachtungsmethode 36 2.2.3 Die Korrelationsmethode: Soziales Verhalten vorhersagen 38 2.2.4 Befragungen 39 2.2.5 Einschränkungen der Korrelationsmethode: Korrelation ist nicht gleich Kausalität 41 2.3 Die experimentelle Methode: Die Antwort auf die Frage nach den Ursachen 43 2.3.1 Unabhängige und abhängige Variablen 45 2.3.2 Die interne Validität von Experimenten 46 2.3.3 Die externe Validität in Experimenten 48 2.3.4 Interkulturelle Forschung 51 2.3.5 Das Grunddilemma des Sozialpsychologen 52 2.4 Ethische Fragen in der Sozialpsychologie 54 2.5 Grundlagenforschung versus angewandte Forschung 56 Zusammenfassung 58 Weiterführende Literatur 59 3 Soziale Kognition: Wie denken wir über unser soziales Umfeld? 60 3.1 Auf Autopilot: Denken ohne Mühe 62 3.1.1 Menschen als Alltagstheoretiker: Automatisches Denken in Schemata 62 3.1.2 Mentale Strategien und Abkürzungen 76 3.2 Kontrollierte soziale Kognition: Aufwändiges Denken 84 3.2.1 Unbewusste Denkprozesse versus bewusste Verdrängung 87 3.2.2 Ironische Prozesse und das Unterdrücken von Gedanken 88 3.2.3 Die Vergangenheit ungeschehen machen: Kontrafaktisches Denken 90 3.3 Eine Darstellung sozialen Denkens 91 3.4 Wie man das menschliche Denken verbessern kann92 3.5 Automatische Denkprozesse und Vorurteile 95 3.6 Jüngste Forschung zum Thema selbst erfüllende Prophezeiung 96 Zusammenfassung 97 Weiterführende Literatur 99 4 Soziale Perzeption: Wie können wir andere Menschen verstehen? 100 4.1 Nonverbales Verhalten103 4.1.1 Emotion im mimischen Ausdruck 104 4.1.2 Andere Kanäle nonverbaler Kommunikation 108 4.1.3 Nonverbale Kommunikation über mehrere Kanäle gleichzeitig 109 4.1.4 Geschlechtsunterschiede in der nonverbalen Kommunikation 111 4.2 Implizite Persönlichkeitstheorien: Wie werden die Lücken ausgefüllt? 112 4.2.1 Die Rolle der Kultur in impliziten Persönlichkeitstheorien 113 4.3 Kausale Attribution: Die Frage nach dem „Warum" 115 4.3.1 Wie läuft der Attributionsprozess ab? 115 4.3.2 Das Kovariationsprinzip: Internale versus externale Attributionen 117 4.3.3 Der fundamentale Attributionsfehler: der Mensch als Persönlichkeitspsychologe 119 4.3.4 Die Akteur-Beobachter-Divergenz 126 4.3.5 Attributionen, die der Selbstwertstützung dienen 128 4.4 Die Rolle der Kultur im Attributionsprozess 132 4.4.1 Kultureller Hintergrund und der fundamentale Attributionsfehler 132 4.4.2 Der kulturelle Hintergrund und die Korrespondenzverzerrung 135 4.4.3 Kulturelle Einflüsse und andere Attributionsverzerrungen 137 4.5 Wie zutreffend sind unsere Attributionen und Eindrücke? 139 4.5.1 Warum sind unsere Eindrücke von anderen Menschen manchmal falsch? 139 4.5.2 Warum erscheinen unserer Eindrücke der Realität zu entsprechen?140 4.6 Kultur und die Korrespondenzverzerrung: Wie ereignen sich kulturelle Unterschiede? 142 4.7 Ein wenig mehr Licht auf den Spotlighteffekt 144 Zusammenfassung 145 Weiterführende Literatur 147 5 Selbsterkenntnis: Wie kommen wir zu einem Verständnis von uns selbst? 148 5.1 Das Wesen des Selbst 150 5.1.1 Die Funktionen des Selbst 151 5.1.2 Kulturelle Unterschiede bei der Selbstdefmition 153 5.1.3 Geschlechterunterschiede bei der Selbstdefinition 155 5.2 Sich selbst kennen lernen durch Introspektion 156 5.2.1 Sich auf das eigene Selbst konzentrieren: Das Konzept der Selbstaufmerksamkeit 158 5.2.2 Das Beurteilen unserer Gefühlszustände - mehr berichten, als wir wissen können . 160 5.2.3 Die Folgen der Suche nach Ursachen 163 5.3 Selbsterkenntnis durch Beobachtung unseres eigenen Verhaltens 164 5.3.1 Aus unserem Verhalten folgern, wer wir sind: die Selbstwahrnehmungstheorie 165 5.3.2 Intrinsische versus extrinsische Motivation 165 5.3.3 Unsere Emotionen verstehen: die Zwei-Faktoren-Theorie der Emotion 169 5.3.4 Die Entdeckung der falschen Ursache: Fehlattribution des Erregungszustandes171 5.3.5 Das Interpretieren der sozialen Welt: Kognitive Bewertungstheorien der Emotion 173 5.4 Selbsterkenntnis durch die Beobachtung anderer Menschen174 5.4.1 Selbsterkenntnis durch interpersonelle Vergleiche 174 5.5 Impression-Management: Die ganze Welt ist eine einzige Bühne! 177 5.6 Sollten Sie Ihre Kinder loben? 180 5.7 Kennen unsere Freunde uns besser als wir uns selbst? 181 Zusammenfassung 183 Weiterführende Literatur 185 6 Selbstrechtfertigung und das Bedürfnis nach Aufrechterhaltung des Selbstwertes 186 6.1 Das Bedürfnis, unsere Handlungen zu rechtfertigen 187 6.1.1 Die Theorie der Kognitiven Dissonanz 188 6.1.2 Rationales versus rationalisierendes Verhalten 190 6.1.3 Entscheidungen, Entscheidungen, Entscheidungen 191 6.1.4 Die Nachwirkungen guter und schlechter Taten 205 6.1.5 Der Beweis für motivierende Erregung 209 6.2 Neue Forschungsrichtungen zur Selbstrechtfertigung 210 6.2.1 Selbstdiskrepanz-Theorie 210 6.2.2 Selbstergänzungstheorie (self-completion theory)212 6.2.3 Theorie der Selbstwerterhaltung (self-evaluation maintenance theory) 214 6.2.4 Theorie der Selbstwertbestätigung (self-affirmation theory) 217 6.3 Selbstrechtfertigung versus Selbstwerterhaltung: Die Rolle negativer Selbstüberzeugungen 218 6.3.1 Selbstverifizierung versus Selbsterhöhung219 6.3.2 Dissonanzreduktion und Kultur 221 6.3.3 Das Vermeiden der Rationalisierungsfalle 221 6.3.4 Aus unseren Fehlern lernen 222 6.4 Heavenvs Gate noch einmal betrachtet 223 6.5 Dem Unbehagen der kognitiven Widersprüchlichkeit ausweichen 224 6.6 Wie das Wissen um den Ausgang eines Ereignisses unsere Wahrnehmung seiner Erwünschtheit beeinflusst 225 Zusammenfassung 226 Weiterführende Literatur 227 7 Einstellungen und Einstellungsänderung: Einfluss auf Gedanken und Gefühle nehmen 228 7.1 Das Wesen und der Ursprung von Einstellungen 230 7.1.1 Woher kommen Einstellungen? 231 7.1.2 Stärke und Zugänglichkeit von Einstellungen 234 7.2 Einstellungsänderung 236 7.2.1 Einstellungsänderung durch eine Veränderung des Verhaltens: noch einmal die kognitive Dissonanztheorie 236 7.2.2 Persuasive Kommunikation und Einstellungsänderung 238 7.2.3 Emotion und Einstellungsänderung 243 7.3 Wie können Menschen Einstellungsänderung gegenüber immun gemacht werden? 250 7.3.1 Einstellungsimpfung 250 7.3.2 Dem Gruppendruck widerstehen 250 7.3.3 Wenn Überzeugungsversuche zum Bumerang werden: Die Reaktanz-Theorie 252 7.4 Wann kann Verhalten anhand von Einstellungen vorhergesagt werden? 252 7.4.1 Die Vorhersage von spontanem Verhalten 253 7.4.2 Die Vorhersage von überlegtem Verhalten254 7.5 Die Macht der Werbung 256 7.5.1 Wie Werbung funktioniert 257 7.5.2 Unterschwellige Werbung: Eine neue Form der Kontrolle? 259 7.6 Funktionieren Medienkampagnen zur Reduzierung vom Gebrauch von (Konsum)drogen? 263 Zusammenfassung 265 Weiterführende Literatur 267 8 Konformität: Wie das Verhalten beeinflusst wird 268 8.1 Konformität: Wann und warum 270 8.2 Informativer sozialer Einfluss: Das Bedürfnis zu wissen, was „richtig" ist 272 8.2.1 Die Wichtigkeit, genau zu sein 274 8.2.2 Wenn informative Konformität fehlschlägt 275 8.2.3 Wann gehen Menschen mit informativem sozialen Einfluss konform? 278 8.2.4 Informativem sozialen Einfluss widerstehen 279 8.3 Normativer sozialer Einfluss: das Bedürfnis akzeptiert zu werden 280 8.3.1 Konformität und soziale Zustimmung: die Asch-Studien zur Beurteilung von Linien 282 8.3.2 Noch einmal die Bedeutung, genau zu sein 284 8.3.3 Die Konsequenzen, wenn man normativem sozialem Einfluss widersteht 285 8.3.4 Normativer sozialer Einfluss im täglichen Leben 287 8.3.5 Wann gehen Menschen mit normativem sozialen Einfluss konform? 291 8.3.6 Normativem sozialen Einfluss widerstehen 297 8.3.7 Der Einfluss von Minoritäten: Wenn wenige viele beeinflussen 297 8.4 Der Gebrauch von sozialem Einfluss, um vorteilhaftes Verhalten zu fördern 298 8.4.1 Die Rolle injunktiver und deskriptiver Normen .299 8.5 Compliance: Aufforderung, Ihr Verhalten zu verändern 300 8.5.1 Gedankenlose Konformität: nach automatischer Steuerung funktionieren 301 8.5.2 Die-Tür-ins-Gesicht-Technik 302 8.5.3 Die Fuß-in-der-Tür-Technik 303 8.6 Einer Autorität gehorchen 304 8.6.1 Die Rolle des normativen sozialen Einflusses 308 8.6.2 Die Rolle des informativen sozialen Einflusses 308 8.6.3 Andere Gründe, warum wir gehorchen 309 8.7 Konformität 31l 8.8 Konformität 313 Zusammenfassung 315 Weiterführende Literatur 316 9 Gruppenprozesse: Einfluss in sozialen Gruppen 318 9.1 Definitionen: Was ist eine Gruppe? 320 9.1.1 Warum schließen sich Menschen Gruppen an? 320 9.1.2 Die Zusammensetzung von Gruppen 321 9.2 Wie Gruppen das Verhalten des Einzelnen beeinflussen 324 9.2.1 Soziale Erleichterung: Wenn die Gegenwart anderer Menschen uns Antrieb gibt 324 9.2.2 Soziales Faulenzen: Wenn die Gegenwart anderer Menschen entspannend auf uns wirkt328 9.2.3 Geschlechtsspezifische und kulturelle Unterschiede bei sozialem Faulenzen: Wer lässt am meisten nach? 329 9.2.4 Deindividuation: Wenn man in der Menge untergeht330 9.3 Gruppenentscheidungen: Sind zwei (oder mehr) Köpfe besser als einer allein? 333 9.3.1 Prozessverluste: Wenn die Interaktionen in Gruppen gutes Problemlösungsverhalten hemmen 334 9.3.2 Gruppenpolarisierung: Bis ins Extrem gehen 338 9.3.3 Führung in Gruppen 341 9.4 Konflikt und Kooperation 345 9.4. l Soziale Dilemmata 346 9.4.2 Die Verwendung von Drohungen zur Konfliktlösung . 349 9.4.3 Verhandeln und Feilschen 351 9.5 Gibt es eine unsichtbare Aufstiegshürde? Ein Doublebind für Frauen in der Rolle der Führungsperson 353 Zusammenfassung 355 Weiterführende Literatur 356 10 Interpersonale Attraktion: Vom ersten Eindruck bis zur engen Beziehung 358 10.1 Wichtige Vorläufer von Attraktion 360 10.1.1 Die Person von nebenan: der Effekt der Nähe 361 10.1.2 Ähnlichkeit 363 10.1.3 Reziproke Zuneigung 364 10.1.4 Effekte körperlicher Attraktivität auf Zuneigung 366 10.1.5 Erinnerungen an die anfängliche Attraktion 371 10.1.6 Theorien interpersonaler Attraktion: sozialer Austausch und Ausgewogenheit 373 10.2 Enge Beziehungen 375 10.2.1 Liebe definieren 375 10.2.2 Die Rolle der Kultur bei der Definition von Liebe 379 10.3 Erklärungen von Liebe und Attraktion 382 10.3.1 Sozialer Austausch in Langzeitbeziehungen 382 10.3.2 Ausgewogenheit in Langzeitbeziehungen 384 10.3.3 Evolutionäre Erklärungen von Liebe 385 10.3.4 Bindungsstile und intime Beziehungen 388 10.3.5 Beziehungen als interpersonaler Prozess 391 10.3.6 Intime Beziehungen beenden 392 10.4 Bindungsstile, Stress und der Wunsch nach Unterstützung: Was machen die Männer? 397 10.5 Hat der Bindungsstil einen Einfluss auf die Art und Weise, wie mimischer Ausdruck dekodiert wird? 398 Zusammenfassung 399 Weiterführende Literatur 401 11 Pro-soziales Verhalten: Warum helfen Menschen? 402 11.1 Grundlegende Motive für pro-soziales Verhalten: Warum Menschen helfen 404 11.1.1 Evolutionäre Psychologie: Instinkte und Gene 404 11.1.2 Sozialer Austausch: Kosten und Nutzen von Hilfeleistung 407 11.1.3 Empathie und Altruismus: Das reine Motiv, zu helfen 409 11.2 Persönliche Determinanten pro-sozialen Verhaltens: Warum manche Menschen mehr helfen als andere 413 11.2.1 Individuelle Unterschiede: Die altruistische Persönlichkeit 413 11.2.2 Geschlechtsspezifische Unterschiede bei pro-sozialem Verhalten 415 11.2.3 Kulturelle Unterschiede bei pro-sozialem Verhalten 415 11.2.4 Die Auswirkung der Stimmung auf pro-soziales Verhalten 417 11.3 Situationale Determinanten pro-sozialen Verhaltens: Wann Menschen helfen 420 11.3.1 Das Umfeld: In der Stadt und auf dem Land 420 11.3.2 Die Anzahl der Zuschauer: Der „Bystander"-Effekt422 11.3.3 Die Art der Beziehung: Freund oder Fremder 428 11.4 Wie kann Hilfeleistung gefördert werden?431 11.4. l Wie man die Wahrscheinlichkeit steigern kann, dass ein Zeuge im Notfall eingreift 432 11.4.2 Das Fördern freiwilliger pro-sozialer Aktivitäten 432 11.5 Positive Psychologie und pro-soziales Verhalten 434 Zusammenfassung 435 Weiterführende Literatur 437 12 Aggression: Warum wir andere verletzen 438 12.1 Was ist Aggression? 440 12.1.1 Ist Aggression angeborten oder erlernt? 440 12.1.2 Beruht Aggression auf Instinkten, auf der augenblicklichen Situation oder ist sie optional? 441 12.1.3 Aggressivität jenseits kultureller Grenzen 443 12.2 Neuronale und chemische Einflüsse auf die Aggression 444 12.2.1 Serotonin und Testosteron 444 12.2.2 Alkohol und Aggression 446 12.3 Situationsbedingte Ursachen von Aggression 447 12.3.1 Schmerz und Unwohlsein als Gründe für Aggression 447 12.3.2 Soziale Situationen, die zu Aggression führen 449 12.3.3 Anwesenheit aggressiver Cues 452 12.3.4 Gewalt in den Medien 454 12.3.5 Gewalttätige Pornographie und Gewalt gegen Frauen 459 12.4 Wie kann Aggressionsverhalten reduziert werden? 461 12.4.1 Bewirkt das Bestrafen von Aggression eine Reduktion aggressiven Verhaltens? 461 12.4.2 Katharsis und Aggression 464 12.4.3 Was sollen wir mit unserer Wut machen? 468 12.5 Hätte das Massaker von Columbine verhindert werden können? 474 12.6 Selbstwertgefühl und Aggression 475 12.7 Gewalt und Fernsehen 476 Zusammenfassung 478 Weiterführende Literatur 479 13 Vorurteile: Gründe und Gegenmaßnahmen 480 13.1 Vorurteile: Ein allgegenwärtiges soziales Phänomen 482 13.1.1 Vorurteile und Selbstwertgefühl 483 13.1.2 Ein Bericht über Fortschritt 484 13.2 Vorurteile, Stereotypisierung und Diskriminierung 484 13.2.1 Vorurteile: die affektive Komponente 485 13.2.2 Stereotype: die kognitive Komponente 485 13.2.3 Diskriminierung: die Verhaltenskomponente 489 13.3 Was verursacht die Vorurteile? 490 13.3.1 Wie wir denken: Soziale Kognition 491 13.3.2 Wie wir Bedeutung zuweisen: Attributionale Voreingenommenheiten 502 13.3.3 Wie wir Ressourcen zuteilen: die Theorie des realistischen Gruppenkonflikts 508 13.3.4 Wie wir konform gehen: normative Regeln 513 13.4 Wie können Vorurteile abgebaut werden? 516 13.4.1 Die Kontakthypothese 517 13.4.2 Wenn Kontakt Vorurteile reduziert: Sechs Bedingungen 518 13.4.3 Kooperation und gegenseitige Abhängigkeit: die Jigsaw-Klasse (integrierte Klasse mit Teamarbeit) 520 13.5 Heuchelei als eine Art, impliziten Rassismus zu reduzieren 524 13.6 Diskriminierung von Homosexuellen 525 Zusammenfassung 526 Weiterführende Literatur 527 14 Sozialpsychologie und unsere Gesundheit 528 14.1 Stress und die menschliche Gesundheit 530 14.1.1 Die Auswirkungen negativer Lebensereignisse 531 14.1.2 Wahrgenommener Stress und Gesundheit 533 14.1.3 Sich verantwortlich fühlen: Die Wichtigkeit der wahrgenommenen Kontrolle 535 14.1.4 Das Wissen, dass man es schaffen kann: Die Selbstwirksamkeit 539 14.1.5 Das Erklären negativer Ereignisse: Erlernte Hilflosigkeit 541 14.2 Stressbewältigung 546 14.2.1 Geschlechtsspezifische Unterschiede in der Stressbewältigung 546 14.2.2 Soziale Unterstützung: Sich Hilfe holen 548 14.2.3 Persönlichkeit und Coping-Stile 550 14.2.4 Vertrauen: sich anderen Menschen öffnen 553 14.3 Prävention: Gesundheitsbewusstes Verhalten fördern 554 14.3.1 Framing von Botschaften: Das Hervorheben der Vorteile gegenüber den Nachteilen 554 14.3.2 Gesundheitsbezogene Verhaltensweisen ändern mit Hilfe der Dissonanztheorie 556 14.4 Gesundheit: Bedrohung durch Stereotype und Blutdruck 558 Zusammenfassung 560 Weiterführende Literatur 561 15 Sozialpsychologie und unsere Umwelt 562 15.1 Die Umwelt als ein Stressfaktor563 15.1.1 Lärm als Stressfaktor 564 15.1.2 Crowding (Überfüllung) als Stressfaktor 566 15.2 Sozialpsychologie nutzen, um umweltschädigendes Verhalten zu verändern 569 15.2. l Soziale Dilemmata lösen 570 15.2.2 Mit Wasser sparsam umgehen 573 15.2.3 Energiesparen 574 15.2.4 Abfall reduzieren 576 15.2.5 Menschen dazu bringen zu recyceln 578 15.3 Fluglärm als Stressquelle 580 Zusammenfassung 582 Weiterführende Literatur 583 16 Sozialpsychologie und das Gesetz 584 16.1 Aussagen von Augenzeugen 586 16.1.1 Warum irren sich Augenzeugen so oft? 587 16.1.2 Beurteilung, ob Augenzeugen sich irren 594 16.1.3 Beurteilen, ob Zeugen lügen 597 16.1.4 Können Aussagen von Augenzeugen verbessert werden? 600 16.1.5 Die Debatte über die wiedererlangten Erinnerungen 601 16.2 Die Jury (der Geschworenen): Gruppenprozesse in Aktion 603 16.2.1 Effekte von Öffentlichkeit vor dem Prozess 603 16.2.2 Wie Geschworene während eines Prozesses Informationen verarbeiten 605 16.2.3 Überlegungen im Geschworenenraum 606 16.2.4 Die Größe der Jury: Sind zwölf Köpfe besser als sechs? 607 16.3 Warum gehorcht der Mensch dem Gesetz? 608 16.3.1 Verhindern schwere Strafen Verbrechen? 608 16.3.2 Verfahrensgerechtigkeit: Der Sinn der Menschen für Anständigkeit 611 16.4 Recht: Neue Entwicklungen bei der Lügendetektion 612 16.5 Zusammenfassung 614 16.6 Weiterführende Literatur 615 Glossar 616 Literaturverzeichnis 631 Abbildungsverzeichnis 701 Personenregister 705 Sachregister 717 |
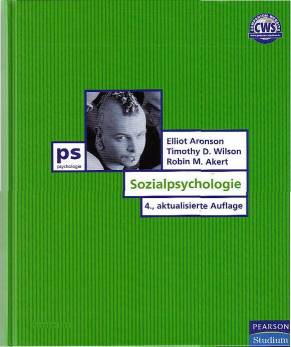
 Bei Amazon kaufen
Bei Amazon kaufen