|
|
|
Umschlagtext
Geschichte ist, was Menschen in der Gegenwart mit der Vergangenheit anfangen. Sie nehmen Relikte vergangener Zeiten auf und binden sie in ihren eigenen Lebenskontext ein, indem sie rekonstruierend nacherzählen und verstehend einordnen. "Quellen auslegen" führt in die Praxis des Umgangs mit historischen Texten und Bildern im Rahmen der christlichen Theologie ein und regt zugleich zum Nachdenken über die heutigen Voraussetzungen historisch-theologischer Arbeit an. Das Buch möchte die Methoden der traditionellen Quellenkritik für die historisch-theologische Forschung im 21. Jahrhundert fruchtbar machen. Deshalb wird die praxisorientierte Einführung in die Methodik historischer Forschung in größere philosophische, kultur- und literaturwissenschaftliche Diskurse der vergangenen Jahrzehnte eingebettet. Historische Theologie wird dabei als hermeneutische Wissenschaft verstanden. Der Fokus liegt auf der Deutung, Interpretation und Reflexion der "Inanspruchnahme des Christlichen" in historischen Text- und Bildquellen.
Konzipiert ist das Buch für alle, die sich das Instrumentarium historisch-theologischer Methodik aneignen und es kritisch-konstruktiv reflektieren möchten, vom Proseminar bis zur Dissertation, im Seminarraum oder im Selbststudium. Als Kriterium für die Qualität historisch-theologischer Forschung wird "intersubjektive Plausibilität" eingeführt. Kapitel über die Bedeutung und die Entwicklung einer sinnvollen Forschungsfrage, zum Auffinden von Quellen und zur Auswahl der für die Forschungsfrage relevanten Methoden leiten zu eigenständiger Forschung an und bieten Anregungen, wie mit dem etablierten Methodenkanon kreativ umgegangen werden kann. Anwendungsbeispiele aus allen historischen Epochen veranschaulichen die vorgestellten Methodenschritte und geben Einblick in den Reichtum der Quellen und die konkrete Arbeit mit ihnen. Die beigegebenen Arbeitsmaterialen bieten kompakte Hilfestellungen für die Praxis historisch-theologischer Forschung. Kathariana Heyden, geb. 1977, Dr. theol., Professorin für Ältere Geschichte des Christentums und der interreligiösen Begegnung am Institut für Historische Theologie der Universität Bern. Martin Sallmann ist seit 2007 Professor für Neuere Geschichte des Christentums und Konfessionskunde in Bern. Seine akademische Lehre wurde von der Theologischen Fakultät mehrfach ausgezeichnet. Rezension
Historische Theologie ist mehr als Kirchengeschichte, sie ist aber jedenfalls Teil der Geschichtswissenschaft und hat Anteil an deren Methodik und Didaktik. Geschichte beschäftigt sich mit der Vergangenheit. Diese ist unwiderruflich vergangen und nur noch in den Quellen, also den Hinterlassenschaften früherer Zeiten, präsent. Quellenarbeit ist die Grundlage des Geschichtsunterrichts in Deutschland. Die wichtigste Großgruppe von Quellen – für den Unterricht wie für die Forschung – sind die Textquellen. Wer Geschichte unterrichtet, muss deshalb Arbeit mit Textquellen kompetent realisieren können. Quellenarbeit ist gerade konstitutiv für historisches Denken. Zu den historischen Quellen gehören alle Dokumente, die absichtlich oder zufällig aus einer vorhergehenden Zeit der Nachwelt hinterlassen wurden und aus denen man Informationen über die jeweils untersuchte Zeit gewinnen kann. Zu den sprachlichen Dokumenten gehören Urkunden, Akten, Briefe, Tagebücher, Reden, Flugblätter, Plakate, Streitschriften, Inschriften, Berichte und literarische Zeugnisse der jeweiligen Epoche. Dieses Buch führt in die Praxis des Umgangs mit historischen Texten und Bildern im Rahmen der christlichen Theologie ein. Der Fokus liegt auf der Deutung, Interpretation und Reflexion der "Inanspruchnahme des Christlichen" in historischen Text- und Bildquellen.
Dieter Bach, lehrerbibliothek.de Inhaltsverzeichnis
Erster Teil: Zugänge zur Historischen Theologie 17
I. Was ist „Historische Theologie"? 17 II. Das Fach innerhalb der Theologie 20 III. Ein dreifaches Spannungsfeld 24 IV. Das Ziel: Intersubjektive Plausibilität 29 V. Zwei Grundkompetenzen: Perspektivenwechsel und Kontextsensibilität 31 Zweiter Teil: Suchen, Finden, Fragen 33 I. Heuristik - die Kunst des Findens 33 II. Was sind historische Quellen und wie finde ich sie? 34 II.1 Relikte und Quellen 34 II.2 Handschriftensammlungen, Archive und Museen 37 III. Was ist eine plausible historische Frage und wie finde ich sie? 43 III.1 Das Erkenntnisinteresse: Ereignisse, Strukturen, Vorstellungen, Ideen 44 III.2 Fragetraditionen, Paradigmenwechsel, Forschungsansätze 46 III.3 Das „Vetorecht der Quellen" 47 III.4 Zwei Ausgangssituationen historischen Forschens 48 III.5 Kriterien für eine plausible historische Fragestellung 50 Anwendungsbeispiel: Die „Zehn Berner Thesen" zur Reformation von 1528 51 IV. Was ist Forschungsliteratur und wie finde ich sie? 53 V. Die gezielte Auswahl von Quellen, Fragestellung und Forschungsliteratur 56 VI. Heuristik im digitalen Zeitalter: Recherchieren im Internet 58 Dritter Teil: Lesen, Untersuchen und Ausdeuten von Textquellen 62 I. Drei Weisen, einen Text zu lesen 62 I.1 „gemäß der Intention" 62 I.2 „zwischen den Zeilen" 63 I.3 „gegen den Strich" 64 Anwendungsbeispiel: Die „Traditio Apostolica" 16 dreifach gelesen 66 II. Das Umfeld der Textquelle 70 II.1 Autorschaft und Authentizität 70 Anwendungsbeispiel: Die (Pseudo-)Isidorischen Dekretalen 78 1I.2 Zeit und Ort der Entstehung 83 Anwendungsbeispiel: Die „Schleitheimer Artikel" 90 III. Die äußere Gestalt des Textes 93 1II.1 Die Textgestalt als Produkt der Überlieferung 94 III.2 Zufall und Steuerung in der Überlieferung 96 I1I.3 Der (ursprüngliche) Text 98 Anwendungsbeispiel: Die „Confessiones" des Augustinus 100 III.4 Überarbeitungen und Redaktionen 105 Anwendungsbeispiel: Die Redaktionen der Kreuzzugschronik des Frutolf von Bamberg 107 III.5 Gattung und Form 110 Anwendungsbeispiel: Opferbescheinigung (libellus) für Aurelia Bellias 111 Anwendungsbeispiel: Martin Luther, „Von guten Werken" 119 IV. Die innere Ausgestaltung des Textes 122 IV.1 Syntaktik: Die Struktur des Textes 126 Anwendungsbeispiel: Die „Pia desideria" von Philipp Jakob Spener 131 IV.2 Stil und Rhetorik: Die Redekunst im Text 133 Anwendungsbeispiel: Huldrych Zwingli an König Franz I. von Frankreich 138 IV.3 Semantik: Die Zeichenwelt des Textes 140 Anwendungsbeispiel: Mechthild von Magdeburg, „Das Fließende Licht der Gottheit" 141 IV.4 Traditionen: Der Text als Netzwerk 144 Anwendungsbeispiel: Bibel und Kirchenväter in der „Confessio Augustana" 149 IV.5 Pragmatik: Der Text als Sprechakt 153 V Wirkungen eines Textes 155 V.1 Beabsichtigte Wirkungen 155 V.2 Tatsächliche Wirkungen 157 Anwendungsbeispiel: Der Streit um das Apostolikum 161 VI. Quellenvergleich 164 Vierter Teil: Betrachten, Untersuchen und Ausdeuten von Bildquellen 165 I. Bilder als Quellen 165 II. Die ikonographisch-ikonologische Methode nach Erwin Panofsky 167 III. Die Cluster-Analyse 172 IV. Synthese: Bildinterpretation in drei Schritten 180 IV.1 Betrachten und Beschreiben 180 IV.2 Untersuchen und Analysieren 181 IV.3 Ausdeuten und Einordnen 183 Anwendungsbeispiel: Die Dreifaltigkeitsikone von Andrej Rubljov 184 Fünfter Teil: Verstehen, Einordnen und Bewerten historischer Quellen 190 I. Historisch-theologische Urteile 190 II. Historisch-theologische Potentiale 192 Beigaben: Arbeitsmaterialien 195 I. Übersicht über die Methoden der Historischen Theologie 195 II. Wegleitung für das Erstellen einer schriftlichen Arbeit 201 III. Expose für eine schriftliche Forschungsarbeit 202 IV. Grundlegende Literatur 203 Personenregister 207 |
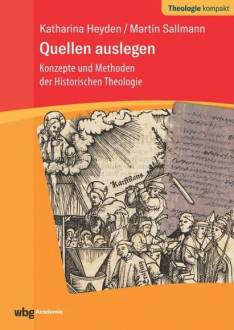
 Bei Amazon kaufen
Bei Amazon kaufen