|
|
|
Umschlagtext
Das neue Standardwerk
Zeitgemäß: Ressourcen spielen eine zentrale Rolle in der Psychotherapie Praxisnah: Wie können Ressourcen aktiviert und für die Therapie genutzt werden? Das Lehrbuch vermittelt ein zeitgemäßes Verständnis psychodynamischer Psychotherapie als ressourcenorientierter Beziehungswissenschaft. Zentrales Anliegen ist es, eine Behandlungskonzeption vorzustellen, die den Reichtum des psychoanalytischen Erfahrungswissens bewahrt und gleichzeitig den Befunden moderner Neuro- und Entwicklungswissenschaften und den Ergebnissen der empirischen Psychotherapieforschung Rechnung trägt. Dabei zeigt sich, dass das weithin anerkannte Wirkprinzip der Ressourcenorientierung hervorragend mit einem psychodynamischen Therapieverständnis vereinbar ist. Eine ressourcenbasierten psychodynamische Beziehungsgestaltung bildet die Grundlage für die Bearbeitung unbewusster Konflikte, struktureller Einschränkungen und traumatischer Erinnerungen. Wolfgang Wöller, Priv.-Doz. Dr. med., Facharzt für Psychosomatische Medizin und Psychotherapie sowie für Neurologie und Psychiatrie, Psychoanalytiker (DGPT, DPG) und Lehranalytiker, EMDR-Supervisor (EMDRIA).Bis Ende 2017 Dozent an der Heinrich-Heine-Universität Düsseldorf. Dozent am Institut für Psychoanalyse und Psychotherapie Düsseldorf.Bis Ende 2017 Ärztlicher Direktor und Leitender Abteilungsarzt der Abteilung mit Schwerpunkt Traumafolgeerkrankungen und Essstörungen der Rhein-Klinik Bad Honnef.Seit 2018 Fortsetzung der Lehr- und Forschungsaktivitäten im Rahmen von TraumaAid Deutschland (Ruanda-Projekt) sowie freie Vortrags- und Publikationstätigkeit. Rezension
Dieses Lehrbuch will eine kritische Übersicht über die psychoanalytische Theorieentwicklung und Hinweise geben, welche traditionellen Theorieelemente mit den Befunden der wichtigsten Nachbarwissenschaften kompatibel sind und welche einer Revision bedürfen. Das Buch will vertrautes psychoanalytisches Wissen in einem neuen Zusammenhang betrachten und neue Reflexionsräume eröffnen; es will ein zeitgemäßes Verständnis psychodynamischer Psychotherapie vermitteln, das den Reichtum des psychoanalytischen Erfahrungswissens bewahrt und gleichzeitig den Befunden moderner Neuro- und Entwicklungswissenschaften und den Ergebnissen der empirischen Psychotherapieforschung Rechnung trägt. Dabei liegt der besondere Akzent auf dem Aspekt der Ressourcenorientierung. Zentral ist und bleibt unser psychodynamisches Beziehungsverständnis und die Überzeugung von der Wirkmächtigkeit unbewusster Prozesse.
Oliver Neumann, lehrerbibliothek.de Verlagsinfo
Pressestimmen: »Dieses Buch ist aus meiner Sicht als Handbuch für die vertiefte Ausbildung in beiden psychodynamischen Methoden ohne Konkurrenz. Neben der wirklich umfassenden Darstellung der therapeutischen Praxis ist mir kaum jemals eine konzentriertere, besser lesbarere und gleichzeitig überzeugendere Darstellung der wesentlichen psychodynamischen Konzepte begegnet. Vor allem deren souveräne kritische Würdigung und die dazu verwendeten wissenschaftlichen Kriterien und normativen Prüfsteine haben mich sehr angesprochen; besonders auch Ihre klare Orientierung an wissenschaftlicher Wahrheit und den grundlegenden Prinzipien der Aufklärung.« Prof. Dr. Michael Geyer Inhaltsverzeichnis
1 Einleitung 19
1 .1 Psychodynamische Psychotherapie heute 19 1 .1 .1 Zum aktuellen Stand der psychodynamischen Therapie 19 1 .1 .2 Wirkfaktoren und die Theorien- und Methodenvielfalt psychodynamischer Therapie 20 1 .1 .3 Varianten psychodynamischer Therapie 22 1 .2 Theorienkrise 27 1 .2 .1 Diagnose einer Theorienkrise und ihre Gründe 27 1 .2 .2 Historische Entstehungsbedingungen der Theorienkrise 30 1 .2 .3 Psychoanalyse als Natur- oder als hermeneutische Kulturwissenschaft? – Überlegungen zum wissenschaftstheoretischen Status der Psychoanalyse 32 1 .2 .4 Eigene Positionierung 34 1 .2 .5 Wie können wir Orientierung gewinnen? 39 1 .3 Ressourcenorientierung in der psychodynamischen Therapie 43 1 .3 .1 Ressourcenorientiertes Denken 43 1 .3 .2 Psychodynamisches Beziehungsverständnis und die Spezifika einer Ressourcenperspektive 45 1 .3 .3 Zur Psychodynamik und Ressourcenfunktion von Theorien 47 2 Eine kurze (kritische) Geschichte der psychoanalytischen Theorieentwicklung 54 2 .1 Sigmund Freud – was bleibt und was bedarf der Revision? 54 2 .1 .1 Die Leistung Freuds aus heutiger Sicht 54 2 .1 .2 Das Paradigma der Triebtheorie ist revisionsbedürftig, aber das Konfliktparadigma bleibt erhalten 57 2 .1 .3 Weitere revisionsbedürftige Annahmen Freuds 58 2 .1 .4 Freuds behandlungspraktisches Beziehungsverständnis 59 2 .2 Pierre Janet und die frühen Grundlagen psychodynamischer Traumatheorien 61 2 .2 .1 Frühe psychodynamische Beiträge zum Verständnis psychischer Traumatisierungen 61 2 .2 .2 Bewusstseinsspaltung und Traumagenese: Pierre Janet 63 2 .2 .3 Hypnoide Zustände: der frühe Sigmund Freud und Josef Breuer 64 2 .2 .4 Sándor Ferenczi 65 2 .2 .5 Bewertung der frühen traumaorientierten Beiträge 66 2 .3 Die Beiträge der Ich-Psychologie 67 2 .3 .1 Grundlinien der Ich-Psychologie 67 2 .3 .2 Die Systematisierung der Abwehrmechanismen 68 2 .3 .3 Von der autonomen Sphäre im Ich zur Systematik der Ich-Funktionen 69 2 .3 .4 Die Beziehungen des Ich zum Überich 71 2 .3 .5 Weiterentwicklungen der Ich-Psychologie 72 2 .3 .6 Zukunftsweisende Differenzierung der Behandlungstechniken und ein therapeutischer Irrweg 73 2 .3 .7 Abschließende Bewertung 74 2 .4 Die Entwicklung der Objektbeziehungstheorien 76 2 .4 .1 Der Blickwinkel der Objektbeziehungstheorie 76 2 .4 .2 Michael Balint und die primäre Liebe 77 2 .4 .3 William R . D . Fairbairn: Gespaltene Objektwelt 78 2 .4 .4 Donald W . Winnicott 80 2 .4 .5 Die Rolle der positiven Beziehungserfahrung 83 2 .4 .6 Otto F . Kernberg 84 2 .4 .7 Kritische Würdigung der Beiträge der Objektbeziehungstheorie 84 2 .5 Die selbstpsychologische Perspektive 88 2 .5 .1 Heinz Kohut und die selbstpsychologische Tradition 88 2 .5 .2 Behandlungstheoretische Implikationen 89 2 .5 .3 Die Bedeutung des Beziehungshintergrundes und das empathische Annehmen des eigenen Empathiedefizits 90 2 .5 .4 Kritik und Bedeutung 91 2 .6 Das postkleinianische Paradigma 94 2 .6 .1 Was bleibt von der Theoriebildung Melanie Kleins? 94 2 .6 .2 Wilfried Bion 95 2 .6 .3 Heinrich Racker 97 2 .6 .4 Weitere postkleinianische Beiträge 98 2 .6 .5 Bedeutung und Kritik der postkleinianischen Psychoanalyse 99 2 .7 Die Errungenschaften der intersubjektiven und relationalen Psychoanalyse 106 2 .7 .1 Intersubjektive und relationale Ansätze 106 2 .7 .2 Therapeutische Implikationen 108 2 .7 .3 Die Person des Therapeuten 110 2 .7 .4 Kritische Bewertung der intersubjektiven und relationalen Modelle 112 2 .8 Von der Bindungstheorie zum Mentalisierungsparadigma 116 2 .8 .1 Die Bindungstheorie 116 2 .8 .2 Die therapeutische Beziehung als Bindungsbeziehung 117 2 .8 .3 Mentalisierungskonzept 118 2 .8 .4 Kritische Würdigung des Mentalisierungskonzepts 120 2 .8 .5 Epistemisches Vertrauen 122 3 Grundlagen ressourcenbasierter psychodynamischer Therapie 124 3 .1 Positive Emotionalität und das Prinzip der Ressourcenorientierung 124 3 .1 .1 Die zentrale Stellung der Emotionen 124 3 .1 .2 Annäherung zwischen modernen Emotionstheorien und psychodynamischen Vorstellungen 125 3 .1 .3 Positive Affekte in der psychodynamischen Theoriebildung 128 3 .1 .4 Zur Bedeutung und Funktion positiver Emotionen 129 3 .1 .5 Das Prinzip der Ressourcenaktivierung 130 3 .1 .6 Neurobiologische Aspekte von positiver Emotionalität und Ressourcenaktivierung 132 3 .1 .7 Psychodynamisches Verständnis einer ressourcenorientierten Haltung 133 3 .2 Die Welt der – auch positiven und fantasierten – Beziehungsrepräsentanzen 136 3 .2 .1 Die Welt der Repräsentanzen umfasst auch die gewünschten Beziehungsrepräsentanzen 136 3 .2 .2 Die Ausbildung einer inneren Normenwelt und das Konzept der verinnerlichten Objektbeziehungen 139 3 .3 Gemeinsam geteilte positive Affektzustände – Zur Regulation von Beziehungen 143 3 .3 .1 Von der Säuglingsforschung zur allgemeinen Regulation von Beziehungen 143 3 .3 .2 Drei Ebenen der Regulation 146 3 .3 .3 Momente der Begegnung 147 3 .3 .4 Implikationen für das moderne Verständnis psychotherapeutischer Prozesse und kritische Würdigung 149 3 .4 Nonverbale Kommunikation, Embodiment und die Bedeutung von Synchronien 153 3 .4 .1 Stiefkind nonverbale Kommunikation – und neues Interesse 153 3 .4 .2 Embodiment 154 3 .4 .3 Nonverbale Kommunikation in der Psychotherapie 156 3 .4 .4 Synchronie 157 3 .5 Übertragung als Chance 162 3 .5 .1 Historische Entwicklung des Übertragungsbegriffs 162 3 .5 .2 Zeitgenössische Auffassungen zur Übertragung 164 3 .5 .3 Übertragung in klinisch-psychotherapeutischer Hinsicht 164 3 .6 Neuronales Wachstum braucht den regulierenden Anderen – Neurobiologische Grundlagen von Psychotherapie 167 3 .6 .1 Zur Wirkung von Psychotherapie auf neuronaler Ebene 167 3 .6 .2 Voraussetzungen für eine wirksame Beeinflussung kortikaler Prozesse 168 3 .6 .3 Die Dimension der Zeit 169 3 .6 .4 Selbstorganisation und Rhythmik – systemtheoretische Perspektiven 170 3 .6 .5 Psychotherapie und Psychopharmaka 171 3 .6 .6 Abschließende Bemerkungen 171 3 .7 Unbewusste motivationale Konflikte blockieren die Mobilisierung von Ressourcen 175 3 .7 .1 Die Bedeutung motivationaler Konflikte 175 3 .7 .2 Der langsame Abschied von der Triebtheorie Freuds 177 3 .7 .3 Moderne psychoanalytische Motivationstheorien 178 3 .7 .4 Systematik psychodynamisch relevanter Konflikte 180 3 .7 .5 Die Unterscheidung zwischen »frühen« und »späten« Konflikttypen und die beziehungstraumatische Genese früher Konflikte 182 3 .7 .6 Symptome und Kompromissbildungen als Elemente der klassischen Konflikttheorie 184 3 .7 .7 Die therapeutische Bewusstmachung der Komponenten des unbewussten Konflikts 187 3 .8 Eingeschränkte Ich-Funktionen – defekt oder ungenügend aktiviert? 191 3 .8 .1 Was sind ich-funktionelle Einschränkungen? 191 3 .8 .2 Zur Kontextabhängigkeit und Genese von Ich-Funktionsstörungen 194 3 .8 .3 Neurobiologische Aspekte der Modifikation unbewusster Prozeduren 196 3 .8 .4 Die Organisation der Abwehr 197 3 .9 Integration des Abgespaltenen und die Bildung von Repräsentanzen 200 3 .9 .1 Die Perspektive der dissoziativen Erinnerungsverarbeitung und der gestörten Repräsentanzenbildung 200 3 .9 .2 Die klinische Bedeutung der Dissoziation und die theoriegeschichtliche Renaissance des Dissoziationsbegriffs 202 3 .9 .3 Zur Unterscheidung von konflikthafter und dissoziativer Verarbeitung 204 3 .9 .4 Unterschiedliche Verarbeitungsmodi nach traumatischen Erfahrungen 205 3 .9 .5 Assoziation abgespaltener Erinnerungsfragmente an die Repräsentanzenwelt des Alltags 206 3 .9 .6 Die Perspektive unzureichend integrierter Persönlichkeitszustände 208 3 .9 .7 Neurobiologische und bindungstheoretische Grundlagen der Perspektive auf dissoziative Phänomene und multiple Selbstzustände 210 3 .10 Was ist ein ausreichend guter Therapeut? 213 3 .10 .1 Der Einfluss der Person des Therapeuten auf das Behandlungsergebnis 213 3 .10 .2 Alter, Geschlecht, Ausbildung und professionelle Erfahrung des Therapeuten 214 3 .10 .3 Persönlichkeitsmerkmale, emotionale Verfassung und Interaktionsdynamik von Therapeuten 215 3 .10 .4 Patientensicht: Was macht einen guten Therapeuten aus? 217 3 .10 .5 Master-Therapeuten 218 3 .10 .6 Konsequenzen 220 4 Diagnostik und Behandlungsplanung 224 4 .1 Diagnostik als Beziehung 224 4 .1 .1 Allgemeines zur Diagnostik in der psychodynamischen Psychotherapie 224 4 .1 .2 Unstrukturierte Untersuchungssituation und das Sicherheitsgefühl des Patienten 227 4 .1 .3 Erkennen von Übertragungsphänomenen 228 4 .1 .4 Diagnostik der Symptomklage und Beschreibung des Problems des Patienten, Beziehungskontext und auslösende Situation 231 4 .1 .5 Diagnostischer Umgang mit körperlichen Aspekten 232 4 .1 .6 Soziale und soziokulturelle Aspekte 232 4 .1 .7 Welche Rolle spielen Deutungen in der diagnostischen Phase? 233 4 .2 Zur Diagnostik von Konflikten, Traumatisierungen und Ressourcen 235 4 .2 .1 Diagnostische Annäherung an aktuelle unbewusste Konflikte 235 4 .2 .2 Diagnostik psychischer Traumatisierungen und traumaassoziierter Belastungen 238 4 .2 .3 Diagnostik von Ressourcen 241 4 .3 Struktur- und Beziehungsdiagnostik 243 4 .3 .1 Möglichkeiten der Diagnostik ich-funktioneller Einschränkungen 243 4 .3 .2 Ich-Funktionen, Bewältigungsmechanismen und Abwehrformen 244 4 .3 .3 Die Beurteilung der Mentalisierungsfunktion 245 4 .3 .4 Beziehungsdiagnostik: Die Qualität der Objektbeziehungen 247 4 .3 .5 Diagnostik der verinnerlichten Objektbeziehungen 249 4 .4 Therapieziele und Fokusformulierung 251 4 .4 .1 Therapieziele 251 4 .4 .2 Fokusformulierungen 253 4 .5 Die Planung der Behandlung 256 4 .5 .1 Fragen der Indikation 256 4 .5 .2 Die Wahl des behandlungstechnischen Zugangs 257 4 .5 .3 Die Wahl des Settings und der Variante psychodynamischer Therapie 260 4 .5 .4 Aufklärung zur Wirkung und zu Risiken einer psychodynamischen Therapie 263 5 Ressourcenbasierte psychodynamische Beziehungsgestaltung 268 5 .1 Haltung 268 5 .1 .1 Merkmale einer ressourcenorientierten psychodynamischen Haltung 268 5 .1 .2 Natürlichkeit in der therapeutischen Beziehung und Respekt für unterschiedliche therapeutische Stile 271 5 .1 .3 Unbewusste Einflüsse auf das eigene therapeutische Handeln 272 5 .2 Rahmen 277 5 .2 .1 Wozu brauchen wir einen Rahmen für die Therapie? 277 5 .2 .2 Transparenz, Vertraulichkeit, Zuverlässigkeit und der Umgang mit Regeln 278 5 .2 .3 Konkrete Ausgestaltung des Rahmens 279 5 .2 .4 Regelverletzungen und Grenzsetzungen 281 5 .2 .5 Absagen von Therapiesitzungen und die Problematik des Ausfallhonorars 283 5 .2 .6 Die Beendigung der Therapiesitzung 286 5 .3 Regulieren 288 5 .3 .1 Worin besteht unsere Regulation und worauf können wir achten? 288 5 .3 .2 Spiegeln der Affekte und die Erzeugung positiver Emotionalität 292 5 .3 .3 Bestätigen und ermutigen 295 5 .3 .4 Die eigene Therapie überzeugend präsentieren und das Vertrauen in die Therapie stärken 296 5 .3 .5 Optimales Spannungsniveau herstellen 296 5 .3 .6 Grobe Abweichungen von der Alltagskommunikation? 299 5 .4 Orientierung an Grundbedürfnissen 302 5 .4 .1 Grundbedürfnisse erkennen 302 5 .4 .2 Bedürfnis nach Sicherheit, Orientierung und Kontrolle 304 5 .4 .3 Grundbedürfnis nach Bindung 306 5 .4 .4 Bedürfnis nach Selbstwertschutz und Selbstwerterhöhung 308 5 .4 .5 Das Bedürfnis nach Lustgewinn und Unlustvermeidung 311 5 .5 Das Prinzip der Kooperation und die therapeutische Allianz 314 5 .5 .1 Das Konzept der therapeutischen Allianz 314 5 .5 .2 Kooperation und die Bedeutung der Grundbedürfnisse 315 5 .5 .3 Indikatoren für einen in Gang gekommenen Therapieprozess 318 5 .5 .4 Therapiemotivation 320 5 .5 .5 Förderung der Zusammenarbeit außerhalb der Therapiesitzungen 321 5 .5 .6 Grenzen des Konzepts der therapeutischen Allianz 323 5 .6 Praxis der Empathie 324 5 .6 .1 Affektive und kognitive Aspekte der Empathie 324 5 .6 .2 Neurowissenschaftliche Aspekte der Empathie 325 5 .6 .3 Empathie als Versuchs-Identifikation und als Spiegelung 326 5 .6 .4 Empathie als Verbundenheit und Getrenntheit 328 5 .6 .5 Ein umfassenderes Verständnis von Empathie unter Einschluss der Ressourcenperspektive 329 5 .6 .6 Grenzen der Empathie 331 5 .6 .7 Ingredienzien praktischer Empathie 332 5 .7 »Sich schwingen von einem Zustand in den anderen« (Freud) 337 5 .7 .1 Perspektivenvielfalt und das »Oszillieren« der therapeutischen Einstellungen 337 5 .7 .2 Perspektivengeleitete Diversifizierung der therapeutischen Strategien 339 5 .7 .3 Orientierung am Therapiekonzept oder an den Bedürfnissen und Vorstellungen der Patienten – und die Offenheit für Neues 340 5 .7 .4 Oszillieren zwischen Lassen und Fokussieren – zwischen Führen und Folgen 342 5 .7 .5 Vom Patienten lernen 344 5 .8 Rupturen der therapeutischen Allianz und die Möglichkeit ihrer Reparatur 346 5 .8 .1 Allianzrupturen und die Chancen ihrer Reparatur 346 5 .8 .2 Empirische Befunde 348 5 .8 .3 Schwierigkeiten bei der Identifikation von Allianzrupturen 349 5 .8 .4 Rückzugsrupturen und Konfrontationsrupturen 350 5 .8 .5 Rückmeldungen von Patienten 352 5 .8 .6 Schlussfolgerungen 354 6 Unbewusstes bewusst machen 357 6 .1 Die Förderung von Einsicht und das Instrument der Deutung 357 6 .1 .1 Einsicht in unbewusste Zusammenhänge 357 6 .1 .2 Was kann Gegenstand von Deutungen sein? 358 6 .1 .3 Die Realisierung einer einsichtsfördernden Haltung 360 6 .1 .4 Welche Bedeutung haben noch rekonstruktive genetische Deutungen? 362 6 .2 Abwehranalyse und die Praxis der Konfliktdeutung 365 6 .2 .1 Wie identifiziere ich Hinweise auf unbewusste Konflikte? 365 6 .2 .2 Die Beobachtung des Patienten: Auffälligkeiten, Widersprüche, Emotionen 366 6 .2 .3 Weitere Informationsquellen für unbewusste Prozesse 367 6 .2 .4 Die Schritte der Abwehranalyse 369 6 .2 .5 Die Indikation zur Aufdeckung unbewusster Zusammenhänge 371 6 .3 Der Beziehungskontext von Deutungen 375 6 .3 .1 Deuten zwischen Bedeutungsklärung und Bedeutungsstiftung 375 6 .3 .2 Emotionale Konnotation und Beziehungsbotschaft von Deutungen 377 6 .3 .3 Gibt es Kriterien für die »Richtigkeit« einer Deutung? 379 6 .3 .4 Das »Wie« einer Deutung 381 6 .3 .5 Deutungen unter der Perspektive multipler Persönlichkeitsanteile 383 6 .3 .6 Kritische Beziehungskonstellationen im Zusammenhang mit Deutungen 384 6 .4 Was leisten freie Aufmerksamkeit und gleichschwebende Aufmerksamkeit? 387 6 .4 .1 Die Methode der freien Assoziation und die gleichschwebende Aufmerksamkeit 387 6 .4 .2 Was leistet die freie Assoziation und wo liegen ihre Begrenzungen? 388 6 .4 .3 Die gleichschwebende Aufmerksamkeit und ihre Grenzen 393 6 .4 .4 Behandlung im Sitzen und das »Couch-Setting« 395 6 .5 Übertragungsdeutung und der Umgang mit Handlungsdialogen 399 6 .5 .1 Historischer Hintergrund 399 6 .5 .2 Die Wirkungsweise und Vorzüge der Deutung der Übertragung im Hier und Jetzt 400 6 .5 .3 Ein Blick auf die empirische Forschungslage zu Übertragungsdeutungen 402 6 .5 .4 Einige praktische Hinweise zur Anwendung von Übertragungsdeutungen 404 6 .5 .5 Verhaltensinszenierungen und Handlungsdialoge 408 6 .5 .6 Sich »verwenden lassen« 410 7 Modifikation von Prozeduren und der Aufbau von Ich-Funktionen 416 7 .1 Was umfasst strukturbezogenes Arbeiten? 416 7 .1 .1 Eingeschränkte Ich-Funktionen und strukturbezogene Interventionen 416 7 .1 .2 Therapeutische Haltung und Beziehungsgestaltung bei Patienten mit ich-strukturellen Störungen 417 7 .1 .3 Therapeutische Aufgaben im Rahmen strukturbezogener Arbeit 419 7 .2 Emotionsregulierung 421 7 .2 .1 Der strukturorientierte Umgang mit Emotionen bei Patienten mit komplexen Traumafolgestörungen 421 7 .2 .2 Wie sprechen wir das emotionale Erleben der Patienten an? 423 7 .2 .3 Distanzierung von intensiven negativen Emotionen und traumatischen Erinnerungsfragmenten 424 7 .2 .4 Techniken zur Generierung positiver emotionaler Selbst-Zustände: Positive Erinnerungen und Imaginationen 425 7 .3 Stärkung der Mentalisierungsfunktion 429 7 .3 .1 Wie können wir die Mentalisierungsfunktion fördern? 429 7 .3 .2 Einbrüche der Mentalisierungsfunktion 433 7 .4 Ressourcenaktivierende Interventionen zur Stärkung von Ich-Funktionen 434 7 .4 .1 Stärkung von Ich-Funktionen durch Ressourcenaktivierung 434 7 .4 .2 Hinweise zur Verwendung ressourcenaktivierender Interventionen 435 7 .4 .3 Schritte in Richtung Zielerreichung strukturieren 439 8 Integration des Abgespaltenen und die Bildung von Repräsentanzen 441 8 .1 Die therapeutische Assoziation dissoziierter Erinnerungsfragmente 441 8 .1 .1 Vorbemerkung 441 8 .1 .2 Abgespaltene Erinnerungsfragmente und das Prinzip ihrer Assoziation an die Repräsentanzenwelt des Alltags 443 8 .1 .3 Therapiepraktische Umsetzung der Assoziation abgespaltener Erinnerungsfragmente an die Repräsentanzenwelt des Alltags 446 8 .1 .4 Allgemeines zur Anwendung traumakonfrontativer Methoden 448 8 .1 .5 Traumakonfrontative Techniken und die Integration von EMDR 449 8 .2 Repräsentanzen schaffen 454 8 .2 .1 Zur Phänomenologie und Pathogenese nicht symbolisierter Zustände 454 8 .2 .2 Möglichkeiten des therapeutischen Umgangs bei nicht oder unzureichend repräsentierten psychischen Zuständen 456 8 .3 Die Arbeit mit unzureichend integrierten Persönlichkeitsanteilen 462 8 .3 .1 Multiple Selbstzustände und unzureichend integrierte Persönlichkeitsanteile 462 8 .3 .2 Therapeutische Arbeit mit Persönlichkeitsanteilen 467 8 .3 .3 Selbstfürsorge auf der inneren Bühne: die Arbeit mit inneren Kindanteilen 468 9 Blockaden des therapeutischen Prozesses und mentale Zustände des Therapeuten 471 9 .1 Blockaden im Therapieprozess und der sogenannte Widerstand 471 9 .1 .1 »Blockaden« statt »Widerstand«? 471 9 .1 .2 Geht die Blockade von den Patienten oder von uns aus? 472 9 .1 .3 Verborgene Blockaden 473 9 .1 .4 Blockade oder Therapiefortschritt? 474 9 .1 .5 Therapeutischer Umgang mit Blockaden des therapeutischen Prozesses 475 9 .2 Überwiegend patientenseitige Blockaden des therapeutischen Prozesses 477 9 .2 .1 Mögliche Gründe für überwiegend patientenseitige Blockaden 477 9 .2 .2 Die Übertragung als Grund für Blockaden 479 9 .2 .3 Therapeutischer Umgang mit überwiegend patientenseitig motivierten Blockaden des Therapieprozesses 480 9 .2 .4 Therapeutenseitige Gründe für Blockaden im therapeutischen Prozess: Ein erster Überblick 483 9 .3 Die Bedeutung der Gegenübertragung 486 9 .3 .1 Psychoanalytische Theoriebildung zur Gegenübertragung: Vom Hindernis zum wertvollen Hilfsmittel 486 9 .3 .2 Dimensionen der Gegenübertragung 489 9 .3 .3 Die Bedeutung der Gegenübertragung für den therapeutischen Prozess 491 9 .3 .4 Schädlicher Umgang mit Phänomenen der Gegenübertragung 494 9 .3 .5 Schutz vor der Gefahr des Ausagierens negativer Aspekte der Gegenübertragung 497 9 .4 Mentalisierungsfunktion, Stress und Regulationsbedürfnisse des Therapeuten 504 9 .4 .1 Die Mentalisierungsfunktion des Therapeuten 504 9 .4 .2 Der Stress der Therapeuten 505 9 .4 .3 Nachdenken über Patienten zwischen den Sitzungen 507 9 .4 .4 Das Konzept der projektiven Identifizierung 508 9 .4 .5 Missverständnisse und Grenzen des Containing-Modells 512 9 .4 .6 Grundbedürfnisse von Therapeuten und ihre Verpflichtung, sich vor einem Übermaß negativer Emotionen zu schützen 514 9 .5 Scheiternde Behandlungen und verwundete Therapeuten 519 9 .5 .1 Scheiternde Behandlungen 519 9 .5 .2 Therapeutische Stillstände und destruktive Entwicklungen in der Therapeut-Patient-Beziehung 522 9 .5 .3 Trauma und Grenzverletzungen bei Psychotherapeuten 524 9 .5 .4 Das Problem der malignen Regression 525 9 .5 .5 Konsequenzen 527 9 .6 Von der Idealisierung der Methode zur erwünschten Fehlerkultur 535 9 .6 .1 Historischer Umgang mit Behandlungsfehlern und die Gefahren der Idealisierung einer Behandlungstechnik 535 9 .6 .2 Theoriegeleitete institutionelle Fehlentwicklungen 539 9 .6 .3 Wie kann eine neue Fehlerkultur aussehen? 542 9 .7 Regulation und Transformation therapeutenseitig negativer Emotionalität 548 9 .7 .1 Therapeutenseitige Emotionsregulierung als Voraussetzung für den Erhalt der Mentalisierungsfunktion 548 9 .7 .2 Selbstwahrnehmung und erste Regulationsschritte 550 9 .7 .3 Vertiefte Selbstwahrnehmung 551 9 .7 .4 Achtsamkeitsbasierte Haltung 552 9 .7 .5 Kognitive Schritte bei der Transformation unserer negativen Emotionalität 556 9 .7 .6 Möglichkeiten der »Entgiftung« der therapeutischen Beziehung 558 9 .7 .7 Selbstfürsorge der Therapeuten 560 10 Schluss – Rückschau und Ausblick 564 10 .1 Rückschau und Zusammenfassung 564 10 .2 Ausblick und Herausforderungen für eine künftige psychodynamische Therapie 570 Literaturverzeichnis 576 |
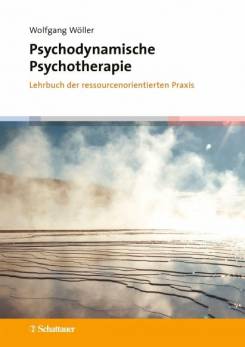
 Bei Amazon kaufen
Bei Amazon kaufen