|
|
|
Umschlagtext
Ausgangspunkt dieses in zweiter Auflage durchgesehenen und ergänzten Bandes ist ein Exkurs im Bellum Iudaicum des hier dem Ambrosius zugeschriebenen sog. Hegesippus über den Wettstreit des Petrus mit Simon Magus in Rom und die sich daran anschließende Christenverfolgung Neros, in der die Apostel Petrus und Paulus das Martyrium erleiden. Die Frage nach den Quellen dieser Episode und deren Historizität führt zu einer Überprüfung der "Schlüsselbeweise" für einen Aufenthalt des Petrus in Rom und der sonstigen literarischen Zeugnisse vom Neuen Testament bis in die Spätantike. Im Vordergrund stehen die apokryphen Apostelakten, der 1. Clemensbrief, Iustinus Martyr, Dionysios von Korinth, Polykarp von Smyrna und die Antihäretiker Hegesippus und Irenäus von Lyon. Die vermeintlich echten Briefe des Ignatius von Antiochien werden in den Rahmen christlicher und heidnischer Pseudepigrapha der Zweiten Sophistik eingeordnet, ihre Entstehungszeit auf das Jahrzehnt 170-180 festgelegt. Ein breites Kapitel ist philologischen Untersuchungen zur Datierung des 1. Clemensbriefes und der Spätschriften des Neuen Testamentes gewidmet. Am Ende steht eine kritische Edition (mit Übersetzung) der Martyrien des Petrus und des Paulus unter Berücksichtigung einer hier erstmalig eingeführten griechischen Handschrift, die ein bisher nicht bekanntes Selbstporträt des Paulus enthält.
Otto Zwierlein, Rheinische Friedrich-Wilhelms-Universität Bonn. Rezension
Diese Studie stellt eine Überprüfung der "Schlüsselbeweise" für einen Aufenthalt des Petrus in Rom dar, der nicht nur kirchengeschichtlich sondern auch konfessionspolitisch von höchster Brisanz ist; leitet sich doch der Primat des römischen Bischofs als Papst von der direkten Nachfolge des Apostels Petrus in Rom ab. Die virulenten Fragen lauten: Was wissen wir von Petrus in Rom? War er je dort? Starb er als Märtyrer? Mit der Beantwortung dieser Fragen ist womöglich u.a. das petrinische Fundament katholischer Tradition in Rom in Frage gestellt; denn der Vatikan beruft sich in besonderer Weise auf Petrus: In der dem Pantheon nachempfundenen gewaltigen Kuppel von San Pietro in Rom (Petersdom) findet sich an deren Basis ein breites Schriftband auf goldenem Grund: „Tu es Petrus et super hanc petram aedificabo ecclesiam meam … - Du bist Petrus und auf diesem Fels werde ich meine Kirche bauen …“ (Mt 16,18f). Auf diesen Petrus gründet sich der Papst(dom). Aber die Quellenlage zu Petrus in Rom ist spärlich; es gilt, nicht nur die neutestamentlichen Quellen zu untersuchen, sondern z.B. auch die außerkanonischen Petrus-Apokryphen, die frühe Kirchengeschichte und die archäologischen Befunde hinsichtlich eines Petrusgrabes in Rom. Diese Studie unterzieht die literarischen Zeugnisse vom Neuen Testament bis in die Spätantike einer kritischen Prüfung mit dem Ergebnis: Noch der Verfasser des 1. Clemensbriefs (ca. 120-125 n.Chr.) weiß nichts von einem Aufenthalt des Petrus in Rom und hat auch keine Kenntnis von Verfolgung und Martyrium des Petrus unter Nero. Die Idee eines Wirkens Petri in Rom entwickelt sich erst später in der anti-gnostischen Auseinandersetzung und verlagert ein Wirken des Petrus gegen den Ur-Gnostiker Simon in Judäa ideell auch nach Rom. Petrus war niemals in Rom. Petrus und Paulus sind nicht in der Neronischen Christenverfolgung gestorben; sie sind nicht Blutzeugen, sondern Dulder; nicht Begründer des römischen Episkopats und einer auf Rom fixierten successio Apostolorum, sondern im Kampf gegen die Gnosis für Rom in Anspruch genommene Repräsentanten der Orthodoxie. 3. Die Briefe 1Petr (um 112-115) und 1Clem (um 120-125) haben keine Kenntnis von einem Aufenthalt des Petrus in Rom und von einem Martyrium der beiden Apostel Petrus und Paulus.
Thomas Bernhard für lehrerbibliothek.de Verlagsinfo
Schlagwort(e): Christenverfolgungen; Erster Clemensbrief; Ignatius von Antiochien; Neues Testament; Simon Magus "Zwierlein presents a strong case and his conclusions have a great historical plausibility [...] To anyone interested in early Christian myth-making this is certainly an indispensable book" Pieter W. van der Horst in: Bryn Mawr Classical Review 2010.03.25 "The care taken over textual and philological analysis is impressive, and Zwierlein may well be right in his tracing of the development of the traditions about Peter in Rome." James G. D. Dunn in: RBL 04/2010 "Wenn auch die in dem Buch abgedrucke kritische Edition der Martyrien des Petrus und Paulus [...] nur für Spezialisten eine wichtige Grundlage sein dürfte, sollten die historischen und philologischen Erörterungen bis zur Seite 335 für jeden Pflichtlektüre sein, der zum Thema der römischen Petrustraditionen spricht oder schreibt." Karl-Heinz Ohlig in: imprimatur 7/2009 Rezensionen "Zwierlein presents a strong case and his conclusions have a great historical plausibility (although orthodox Catholic scholars will certainly try to disprove them)." -- Pieter W. van der Horst in: Bryn Mawr Classical Review 2010.03.25 Inhaltsverzeichnis
Vorwort V
Inhaltsverzeichnis VII Einleitung 1 Der Exkurs über die neronische Christenverfolgung im 'Hegesippus' des Ambrosius, die Petruslegende und ihre Quellen 1 A. Die „Schlüsselbeweise" für einen Aufenthalt des Apostels Petrus in Rom 4 I. Der archäologische Befund: Das sog. Petrusgrab 4 II. Die literarischen Schlüsselstellen 7 1. 1Petr 5,13: Diaspora, Babylon und die napEni8riuot in Jak, 1Petr und 1Clem 7 2. 1Clem 5-6: Der sog. 1. Clemensbrief und die Apostelgeschichte 13 3. Ign. Röm 4,3: Petrus und Paulus im Römerbrief des „Ignatius" (mit einem Vorgriff auf die Erörterung der Chronologie) 31 4. Ascensio Jesaiae 4,2-3 34 B. Das Wirken Petri in Rom: Die apokryphen Apostelakten und der Exkurs über Petrus und Simon Magus im `Hegesipp' des Ambrosius 36 I. Abriß der Quellen: Die Acta Petri et Pauli 36 II. Die historischen Voraussetzungen für die Konzeption eines Romaufenthaltes der beiden Apostel 41 1. Romreise und Romaufenthalt des Paulus nach der Apostelgeschichte 41 2. Erfüllt Petrus die Bedingungen für eine Mission im Westen? 42 III. Petrus im Wettstreit mit dem Zauberer Simon 43 1. Die Ausgangssituation im Exkurs des Ambrosius 2. Die Ankunft des Simon Magus in Rom 46 3. Petrus verfolgt den aus Judäa vertriebenen Zauberer nach Rom 47 4. Die scheinbare und die wirkliche Totenerweckung: Simon als magna virtus dei 52 5. Das Mirakel des Himmelsfluges 59 a) Simons Flug in den actus Petri 59 b) Simons Flug im Exkurs des Ambrosius und im Ps.Marcellus 60 c) Engel/Dämonen als Flughelfer in const. Apost., Arnob. adv. nat., Sulp. Sev., Ps.Marc. — nicht in den actus Petri 62 6. Der Simon Magus des Ambrosius als ein zweiter Ikarus 70 IV. Die Passio Petri (et Pauli) — in quellenkritischer Sicht 75 1. Der Auftakt zur Verfolgung des Petrus (und Paulus) 75 a) Neros Zorn über den Verlust des Freundes 75 b) Die Konkubinen des Präfekten Agrippa 78 c) Nero oder Agrippa? Ambr. c. Aux. 13 79 d) Die `vocatio' 81 2. Die 'Quo vadis'-Szene am Stadttor Roms 82 a) Der Dialog zwischen Petrus und Jesus in Mart. Petr. 6,4 82 b) Die beiden Fassungen des Ambrosius (Heges. III 2; c. Aux. 13) im Vergleich zu Ps.Linus 85 c) Joh 13,36 in Ps.Linus und Ps.Marcellus 89 d) Die Einsicht Petri in den theologischen Sinn der Worte Jesu bei Ambrosius und Ps.Linus 90 3. Petri Kreuzigung 92 a) Petrus stärkt die Brüder — Gefangennahme und Verurteilung zum Kreuz durch Agrippa 92 b) Auflauf des Volkes und Kreuzigung `inversis vestigiis' 94 c) Von Joh 21,18f. zu Ambr. hymn. 12 97 d) Petrus, der Hirt, empfiehlt seine Schafe dem 'guten Hirten' 103 4. Die Grablegung 108 a) Die Zeugen aus Jerusalem 108 b) Die Sarkophagbestattung: „Laßt die Toten ihre Toten begraben!" 109 5. Neros ('hristeliverlidgting 113 a) Nero in den actus Petri und im Ps.Linus 113 b) Nero in den acta Pauli 116 c) Tertullians Kombination der Nero-Vita Suetons mit den Apostelakten und Joh 21,18f 119 d) Tertullian, Laktanz und Ambrosius (Heges. III 2) 124 C. Legende und Historie 128 I. Ursprung und Entwicklung der Legende vom Wirken und Sterben des Apostels Petrus in Rom 128 1. Widersprüche zwischen den apokryphen Apostelakten und der Apostelgeschichte 128 2. Iustinus Martyr und die vermeintliche Statueninschrift Simoni Deo Sancto 129 3. Bischof Dionysios von Korinth über Petrus und Paulus: Die Paulinischen Korintherbriefe und 1Clem 134 a) Das gaprupticsat der beiden Apostel in Korinth und Rom nach Dionysius und Euseb 134 b) Petrus und Paulus in Korinth? 135 c) Der Irrtum des Bischofs Dionys über Petrus und Paulus als Gründungsapostel der Christengemeinden in Rom und Korinth 139 4. Irenäus von Lyon: Die `potentior principalitas' der von Petrus und Paulus gegründeten Kirche Roms 140 5. Petrus und Paulus als Begründer des römischen Episkopats: Die ersten Bischöfe Roms 156 a) Die früheste Bischofsliste Roms bei Irenäus 156 b) Bischof Polykarp von Smyrna bei Irenäus 162 c) Die Bischöfe Polykarp und Clemens in Tertullians `De praescriptione haereticorum' 164 d) Die vermeintliche `Diadoche' des Antihäretikers Hegesippus 166 e) Christlicher Rom-Mythos (Damasus, Ambr. hymn. 12, Prudentius, Leo d. Große) 169 6. Die Jakobuslegende und die Diadoche der Bischöfe Jerusalems: Hegesippus vor der Folie des Flavius Josephus 178 II. Das fiktive Briefcorpus des „Ignatius von Antiochien" 183 1. Die Datierung der sog. epistulac genuinae' in die Zeit nach der valeotininnischen Gnosis 183 a) Die Interpolation des Terminus technicus martyrion in Eph 1,2 185 b) Die Sige aus dem valentinianischen Pleroma in Magn 8,2 187 2. Polykarps Philipper-Brief — eine authentische Beglaubigung des Märtyrers Ignatius (von Antiochien) 188 3. Chronologische Fixpunkte für die sog. mittlere Rezension der pseud-epigraphischen Briefe des „Ignatius von Antiochien" 193 a) Irenäus von Lyon, 'Adversus haereses' 193 b) Lukians Schrift 'De morte Peregrini'? 194 c) Das 'Martyrium Polycarpi' und der Martyriumsbericht der Christen von Lyon 201 4. Zur Martyriumsterminologie bei Ps.Ignatius, Polykarp, im Brief über die Märtyrer von Lyon und im 4. Makkabäerbuch 206 a) martyrien - mathetes, mimetes einai, matheteuestai 206 b) antipsychos: Der Märtyrer als Stellvertreter 212 5. Die Pseud-Ignatianen: ein 'Briefroman' zur Propagierung des Monepiskopats 216 a) Die sieben Briefe des „Ignatius" im Rahmen christlicher und heidnischer Pseudepigrapha der Zweiten Sophistik 216 b) Auf den Spuren des Paulus von Antiochien nach Rom: Die sieben Sendschreiben des Ps.Ignatius als fingierte Repräsentationen der von Polykarp bezeugten Briefe des Märtyrers Ignatius 222 c) Paulinisches Kolorit im Ps.Ignatius 225 d) Der Beglaubigungsapparat im Dienste der Abwehr gnostischer Häresien und der Beförderung des Monepiskopats 226 e) Die Stilisierung des Presbyters Polykarp von Smyrna zum Bischof 231 f) Der Römerbrief des Ps.Ignatius und der erste „Clemensbrief' 234 Ergebnis 237 III. Eine unplausible Frühdatierung des lukanischen Geschichtswerks und die Legende von einem Romaufenthalt des Petrus 238 D. Philologische Untersuchungen zur Datierung des ersten „Clemensbriefes" und der Spätschriften des Neuen Testaments 245 I. Der Forschungsstand: Das chronologische Verhältnis des ersten „Clemensbriefes" zu den Schriften des Neuen Testamentes 245 1. Der erste „Clemensbrief' als vermeintlicher Fixpunkt für die Datierung der Spätschriften des NT 245 2. Vorläufige Indizien für eine Datierung von 1Clem in das frühe 2. Jh. 251 a) Die Situation der Kirchengemeinde in Korinth 251 b) Intertextuelle Verwandtschaftsindizien 252 II. Literarische Filiationen: 1Clem und die Spätschriften des NT 255 1. Der Verfasser von 1Clem schöpft aus der Apostelgeschichte 255 2. Die Verfasser von 1Petr und 1Clem schöpfen aus den Pastoralbriefen 263 3. 1Clem schöpft aus Jak und 1Petr 278 4. Der Jakobusbrief ist Quelle für den ersten Petrusbrief (Jak —+ 1Petr) 287 5. 1Clem schöpft aus Jak 293 6. 1Clem schöpft aus 1Petr 297 7. Imitation des durch imitatio gewonnenen Textes unter erneutem Rückgriff auf das Original 301 III. Christenverfolgungen bei Plinius d. J., Tacitus, Sueton und die Chronologie von 1Petr und 1Clem 308 IV. Der „Clemensbrief' als Zeugnis der frühen Epoche Hadrians 316 1. Die Fürbitte für die staatliche Obrigkeit 316 2. Der Vogel Phönix und die Münzprägung des Kaisers Hadrian 318 3. Die ewige Harmonie des Kosmos in der Protreptik des Dion von Prusa und im „Clemensbrief' 320 Ergebnis 332 Ausblick 334 |
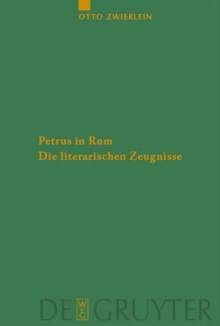
 Bei Amazon kaufen
Bei Amazon kaufen