|
|
|
Umschlagtext
"Natürliche Theologie" ist für die deutschsprachige evangelische Theologie zu einem Reizwort geworden, hinter dem sich verschiedene Problemfelder verbergen. Dafür zeichnet vor allem Karl Barths Ablehnung Natürlicher Theologie verantwortlich [sic!].
Diese Studie untersucht, wie sich der Streit um Natürliche Theologie in der zweiten Hälfte des 20. Jahrhunderts fortgesetzt hat. Dazu wird nicht nur das Gespräch mit namhaften Entwürfen evangelischer Theologie gesucht, sondern auch eine ökumenische Dimension dieses Streits herausgearbeitet, die in der Beurteilung Kontextueller Theologie zutage tritt. Christoph Kock, M.A.R., geb. 1967 in Lengerich/Westfalen, arbeitet zur Zeit am Lehrstuhl für Neues Testament und christlich-jüdische Studien der Humboldt-Universität zu Berlin. Rezension
Der Terminus "Natürliche Theologie" kreist um den Problemkomplex, ob und inwiefern man Gott außerhalb seiner Selbstoffenbarung in Jesus Christus (d.h. zum Beispiel auch in der Natur oder im menschlichen Geist) erkennen und (angemessene) Aussagen über ihn und sein Handeln an uns Menschen treffen kann - allein mithilfe unserer Vernunft. Diese Frage kann ohne Übertreibung wohl zu den am meisten diskutierten Fragen innerhalb der protestantischen Theologie des vergangenen Jahrhunderts gerechnet werden, weswegen der Untertitel der Studie hier völlig zu Recht von einem "evangelischen Streitbegriff" spricht.
Als Schlüsselfigur dieses Streites macht Christoph Kock dabei Karl Barth aus, der in Abgrenzung zur Theologie Schleiermachers entschieden sein "Nein!" bezüglich aller Gottesoffenbarung außerhalb der Offenbarung in Jesus Christus in den theologischen Raum stellt. Der II. und III. Teil des Buches stellen einen kundigen und materialreichen Durchgang durch die akademische deutsche Rezeptions- und Streitgeschichte um die "Natürliche Theologie" dar. Die Teile IV und V wollen schließlich die Position des Verfassers mit zur Darstellung bringen, der den Gedanken von der "Zweifachheit" jeder Theologie (kontingente Besonderheit von Gottes Offenbarung in Jesus Christus und jeweilige Besonderheit des Kontextes und der Situation, innerhalb denen jede Theologie getrieben wird) als Lösungsweg dieses Problems vor- und einschlägt. Durch die Komplexität der in ihr dargestellen Rezeptionsvorgänge stellt diese Dissertation eine anspruchsvolle Lektüre dar, die vor allem für solche Leser geeignet erscheint, die sich über dieses wichtige Problem einen profunden Überblick über Stellungnahmen wichtiger protestantischer Theologen dazu verschaffen wollen. Vor allem die Bilanz am Schluss des Buches regt dabei zu eigenem Nachdenken an. Gerhard Schreiber für Lehrerbibliothek.de Inhaltsverzeichnis
Inhalt
Vorwort V I Einleitung: Der neuzeitliche Verlust der Selbstverständlichkeit Gottes und seine Folgen 1 A Die Diffusion eines doppelten Streitbegriffs. Zum Problem einer evangelischen Definition natürlicher Theologie 1 1. Ein Begriff mit wechselvoller Geschichte im „nervösen Zentrum" evangelischer Theologie 1 2. Der umstrittene Universalitätsanspruch des christlichen Glaubens. Problemfelder natürlicher Theologie 8 3. Wandelbare Wahrheit als Quelle von Häresie? 11 B Zur Methode der vorliegenden Untersuchung 17 1. Die Notwendigkeit eines ,historisch-kritischen’ Verhältnisses zur natürlichen Theologie 17 2. Das Verhältnis zu Schleiermacher (bzw. zu Hegel) als Zugang mm Problem natürlicher Theologie 19 3. Der Aufbau dieser Untersuchung 21 II Das von Karl Barth hinterlassene Problemknäuel 23 A Die Anwendung der Rechtfertigungslehre auf die Gotteserkenntnis. Barths „alter Freund-Feind Schleiermacher" und die erste Barmer These 23 1. Barths Umgang mit natürlicher Theologie im Lichte seines lebenslangen Ringens mit Schleiermacher 23 2. Anthropozentrik als Aktualisierung reformatorischer Theologie 27 3. Anthropozentrik als Preisgabe reforrnatorischer Theologie. Die Entdeckung einer Häresie 34 4. Das christologische Defizit natürlicher Theologie und seine Überwindung 59 B Problembewältigung oder Problemverschärfung? Barths Umgang mit natürlicher Theologie in der Diskussion 77 1. Reformation durch Funktionalisierung? 77 2. Kontroversen als Problemanzeige 86 III Natürliche Theologie im Spiegel der Schleiermacher-Rezeption 103 A Schleiermacher als Katalysator für die Luther-Rezeption. Zum Verhältnis von Reformation und Neuzeit nach Gerhard Ebeling 103 1. Mit Schleiermacher oder Hegel? Eine theologiegeschichtliche Weichenstellung 103 2. Ein Brückenschlag zwischen Reformation und Aufklärung 104 B Die Bedeutung der Geschichte für die Allgemeingültigkeit des Redens von Gott. Hegels Kritik an Schleiermacher und die Aufhebung natürlicher Theologie bei Wolfhart Pannenberg 111 1. Die Ablehnung natürlicher Theologie als Herausforderung zur Rezeption philosophischer Theologie. Schleiermacher im Schatten des ,verkannten Kirchenvaters’ Hegel 111 2. Die Einheit der Theologie und ihre Wissenschaftlichkeit 113 3. Der Gottesgedanke als Rahmen für die religiöse Erfahrung. Theologie zwischen Philosophie und Religionsgeschichte 129 4. Konturen einer neuzeitlichen theologia gloriae? Zur Problematik eines idealistischen Geschichtsverständnisses 151 C Der offenbarungstheologische Denkweg und die Freiheit der Theologie. Das Lob Schleiermachers und die „natürlichere Theologie“ bei Eberhard Jüngel 170 1. Der „große Schleiermacher" als Stichwort in Jüngels Vermittlung zwischen Offenbarungs- und Erfahrungstheologie 170 2. Die Spannung zwischen Denken und Glauben und die Wissenschaftlichkeit der Theologie 171 3. Die ,Un-denkbarkeit' natürlicher Theologie 178 4. Das Dilemma der ‚natürlicheren Theologie’. Beobachtungen zur Unscharfe eines theologischen Komparativs 197 D Die Scheinfreiheit verselbständigter Vernunft. Der .verschleierte' Verlust christlicher Theologie bei Falk Wagner 210 1. Orientierung an Schleiermacher in einer ekklesiologischen Krise 210 2. Barths „neuevangelische Wendetheologie" - ein theologiegeschichtlicher , Störfall' 212 3. Der Protestantismus als „Religion der Freiheit" 219 4. Die Sackgasse einer „vernünftigen Theologie" 240 E Natürliche Theologie als Theologie der Erfahrung. Schleiermacher und die „Praxissituation endlicher Freiheit" bei Eilert Herms 250 1. Eine Rezeption Schleiermachers ohne Polemik gegen Barth und der Funktionswandel natürlicher Theologie 250 2. Die Struktur der Erfahrung nach Schleiermachers „Theorie des unmittelbaren Selbstbewußtseins“ 255 3. Die Struktur des christlichen Glaubens: Das Besondere im Rahmen des Allgemeinen 268 4. Eine Strukturentsprechung von Erfahrung und Glaube? Rückfragen an eine ,explikative' natürliche Theologie 286 IV Natürliche Theologie - Situation - Kontext. Ein Problemlösungsversuch 295 A Das ökumenische Konfliktpotential natürlicher Theologie. Eine Horizonterweiterung als Verschärfung des Problems 295 B Der Situationsbezug des Wortes Gottes. Erwägungen zu Gerhard Ebelings hermeneutischer Theologie 299 1. Das Wort Gottes jenseits von natürlicher Theologie und Offenbarungspositivismus 299 2. Das Wort Gottes in der Grundsituation des Menschen 311 3. Ebeling als Vordenker kontextueller Theologie? Berührungspunkte und Differenzen 324 C Zwischen Text und Kontext. Kontextuelle Theologie als natürliche Theologie im ökumenischen Gewand? 336 1. Streit um einen epistemologischen Bruch. Zur Genese einer ökumenischen Kommunikationskrise 336 Exkurs: Der ,schwarze Christus' als Ausdruck eines „nationalistischen Erwählungsglaubens"? James Cone im Urteil Pannenbergs 343 2. Die theologische Entdeckung des Kontextes 346 3. 'Zweite Quelle' oder Auslegung des ,einen Wortes'? Zum Verhältnis von kontextueller und natürlicher Theologie 367 V Natürliche Theologie auf dem langen Weg zur „begriffenen Geschichte". Eine Bilanz 391 1. Vom Gegensatz zwischen natürlicher Theologie und Offenbarungstheologie zu seiner Überwindung. Die Enthäretisierung natürlicher Theologie 392 2. Von der Ablehnung zur Anerkennung ontologisch- metaphysischer Anleihen. Der Situationsbezug des inkarnierten Wortes (Job 1,14) 395 3. Vom Offenbarungspositivismus zur Entpositivierung. Die Verschleierung von ,Voraus-Setzungen’ 399 4. Von einer idealistischen theologia gloriae zu einer ökumenischen theologia crucis. Die Situationsdistanz des gekreuzigten Wortes (I Kor 1,18) 402 5. Von natürlicher Theologie zum Subjektivismus. Die reflexionsvergessene Fortsetzung einer Häretisierung 403 6. Von natürlicher zu kontextueller Theologie. Eine ‚Rückkehr zum Text’ ? 408 7. Theologie als Epiklese. Gedanken zum Gelingen „christlicher Glaubenskommunikation“ 410 Literatur 413 Abbildungen 433 Personen 434 Abkürzungen 438 |
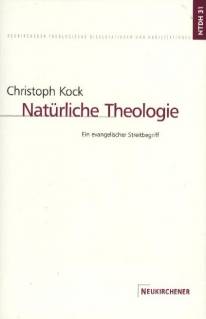
 Bei Amazon kaufen
Bei Amazon kaufen