|
|
|
Umschlagtext
„Die wichtigste Revolution im Innern des Menschen ist der Ausgang des Menschen aus seiner selbstverschuldeten Unmündigkeit.“
(Immanuel Kant) Immanuel Kant, der bedeutendste Philosoph der Neuzeit, wurde vor 300 Jahren geboren. Aber sein revolutionäres Denken ist bis heute aktuell. Kant erklärt die Entstehung unseres Planetensystems, begründet eine neue Form von Metaphysik und formuliert den kategorischen Imperativ. Kant war Wegbereiter des Kosmopolitismus und der Idee der Menschenwürde. Sein Denken hat nicht nur die Philosophie und Wissenschaft, sondern auch das deutsche Grundgesetz und die Vereinten Nationen geprägt. In seinem Buch schildert Marcus Willaschek auf verständliche und anschauliche Weise die vielen Facetten von Kants Revolution des Denkens, die den aktiven Menschen in den Mittelpunkt der Welt stellt. Rezension
„Zwei Dinge erfüllen das Gemüt mit immer neuer und zunehmenden Bewunderung und Ehrfurcht, je öfter und anhaltender sich das Nachdenken damit beschäftigt: Der bestirnte Himmel über mir, und das moralische Gesetz in mir.“, heißt im „Beschluss“ zur Kritik der praktischen Vernunft“ von Immanuel Kant (1724-1804). Dieses Zitat ist auch auf dem Grabstein des Philosophen in Königsberg verewigt und wird im nächsten Jahr, dem 200. Geburtstag des großen Denkers, wieder zitiert werden.
Aufklärung, Autonomie, guter Wille, kategorischer Imperativ, Zweck an sich selbst, Pflichten, Ding an sich, Transzendentalphilosophie und Urteilskraft zählen zweifelsohne zu den zentralen Begriffen der Philosophie Kants. Der Theoretiker der Humanität, Kosmopolit und Begründer des ethischen Universalismus gilt als einer der größten Philosophen der Welt. Bekanntheit erlangte er durch seine drei großen Kritiken: „Kritik der reinen Vernunft“(1781/1787), „Kritik der praktischen Vernunft“(1788) und „Kritik der Urteilskraft“(1790), durch seine „Grundlegung zur Metaphysik der Sitten“(1785/1786) und insbesondere durch seinen Aufsatz „Beantwortung der Frage: Was ist Aufklärung?“(1784), in welcher er eine Revolution der „Denkungsart“ postuliert. Kants Begriffsprägungen, Ideen und Argumentationen haben die deutsche und internationale Philosophie seit Ende des 18. Jahrhunderts entscheidend geprägt und beeinflussen noch heute aktuelle Diskurse. Sein Universalismus der Menschenwürde hat Eingang gefunden in Artikel 1 des Grundgesetzes. Sehr gut wird das Leben, das Œuvre und das Wirken des Philosophen erschlossen in dem Buch „Kant. Die Revolution des Denkens“, erschienen im Verlag C.H. Beck. Verfasst wurde es von dem international anerkannten Kant-Experten Marcus Willaschek (*1962). Bekanntheit erlangte der Philosophie-Professor der Goethe-Universität Frankfurt am Main u.a. durch seine Publikationen „Praktische Vernunft. Handlungstheorie und Moralbegründung bei Kant“(1992), „Kant-Lexikon“(3 Bde., 2015) und „Kant on the Sources of Metaphysics“(2018). In seinem jüngsten Kant-Buch gelingt es Willaschek hervorragend, biographische Details mit philosophischer Werksanalyse zu verbinden. So beginnt der Wissenschaftler sein Kapitel zum Kategorischen Imperativ mit einem Brief von Maria von Herbert aus dem Jahre 1791 an Kant mit der Bitte um Lebenshilfe. Die Adlige hatte ihr Lebensführung streng an der Erfüllung des kategorischen Imperativs orientiert, was sich für sie als problematisch erwiesen hat. Willaschek zeigt auch differenziert Grenzen der Kantischen Moralphilosophie auf. Die Auseinandersetzung mit Kants deontologischer Ethik gehört zu den zentralen Gegenständen des schulischen Ethik- und Philosophieunterrichts der Oberstufe. Zudem werden dort vielfach seine Anthropologie, seine Erkenntnistheorie, seine Ästhetik, seine Religionsphilosophie, seine Friedensschrift, sein Aufklärungsaufsatz oder seine pädagogischen Vorlesungen thematisiert. Ethik- und Philosophie-Lehrkräfte motiviert der gut verständlich geschriebene Band von Willaschek, sich differenziert mit den Begriffen und Argumentationen Kants auseinanderzusetzen. Die Lektüre des Buches kann Lehrkräfte zudem vor didaktischen Verfälschungen im Unterricht bewahren. Fazit: Die Darstellung „Kant. Die Revolution des Denkens“ von Marcus Willaschek kann allen an der Philosophie des großen Aufklärers Interessierten nur zur Lektüre empfohlen werden. Zudem unterstreicht dieser Band eindrücklich die Aktualität eines Philosophierens mit und nach Kant gerade im 21. Jahrhundert. Dr. Marcel Remme, für lehrerbibliothek.de „Zwei Dinge erfüllen das Gemüt mit immer neuer und zunehmenden Bewunderung und Ehrfurcht, je öfter und anhaltender sich das Nachdenken damit beschäftigt: Der bestirnte Himmel über mir, und das moralische Gesetz in mir.“, heißt im „Beschluss“ zur Kritik der praktischen Vernunft“ von Immanuel Kant (1724-1804). Dieses Zitat ist auch auf dem Grabstein des Philosophen in Königsberg verewigt. Aufklärung, Autonomie, guter Wille, kategorischer Imperativ, Zweck an sich selbst, Pflichten, Ding an sich, Transzendentalphilosophie und Urteilskraft zählen zweifelsohne zu den zentralen Begriffen der Philosophie Kants. Der Denker, Theoretiker der Humanität und Kosmopolit, gilt als einer der größten Philosophen der Welt. Bekanntheit erlangte er durch seine drei großen Kritiken: „Kritik der reinen Vernunft“(1781/1787), „Kritik der praktischen Vernunft“(1788) und „Kritik der Urteilskraft“(1790), durch seine „Grundlegung zur Metaphysik der Sitten“(1785/1786) und insbesondere durch seinen Aufsatz „Beantwortung der Frage: Was ist Aufklärung?“(1784). Kants Begriffsprägungen, Ideen und Argumentationen haben die deutsche und internationale Philosophie seit Ende des 18. Jahrhunderts entscheidend geprägt und beeinflussen noch heute aktuelle Diskurse. Sehr gut wird das Leben, das Œuvre und das Wirken des Philosophen erschlossen in dem Buch „Kant. Die Revolution des Denkens“, erschienen im Verlag C.H. Beck. Verfasst wurde es von dem international anerkannten Kant-Experten Marcus Willaschek (*1962). Bekanntheit erlangte der Philosophie-Professor der Goethe-Universität Frankfurt am Main u.a. durch seine Publikationen „Praktische Vernunft. Handlungstheorie und Moralbegründung bei Kant“(1992), „Kant-Lexikon“(3 Bde., 2015) und „Kant on the Sources of Metaphysics“(2018). In seinem jüngsten Kant-Buch gelingt es Willaschek hervorragend biographische Details mit philosophischer Werksanalyse zu verbinden. So beginnt der Wissenschaftler sein Kapitel zum Kategorischen Imperativ mit einem Brief von Maria von Herbert aus dem Jahre 1791 an Kant mit der Bitte um Lebenshilfe. Die Adlige hatte ihr Lebensführung streng an der Erfüllung des kategorischen Imperativ orientiert, was sich für sie als problematisch erwiesen hat. Die Auseinandersetzung mit Kants deontologischer Ethik gehört zu den zentralen Gegenständen des schulischen Ethik- und Philosophieunterrichts der Oberstufe. Zudem werden dort vielfach seine Anthropologie, seine Erkenntnistheorie, seine Ästhetik, seine Religionsphilosophie, seine Friedensschrift, sein Aufklärungsaufsatz oder seine pädagogischen Vorlesungen thematisiert. Ethik- und Philosophie-Lehrkräfte motiviert der gut verständlich geschriebene Band von Willaschek, sich differenziert mit den Begriffen und Argumentationen Kants auseinanderzusetzen. Die Lektüre des Buches kann Lehrkräfte zudem vor didaktischen Verfälschungen im Unterricht bewahren. Fazit: Die Darstellung „Kant. Die Revolution des Denkens“ von Marcus Willaschek ist ein Muss für alle überzeugten Kantianer:innen. Zudem unterstreicht dieser Band eindrücklich die Aktualität eines Philosophierens mit und nach Kant im 21. Jahrhundert. Dr. Marcel Remme, für lehrerbibliothek.de Verlagsinfo
Willaschek, Marcus Kant Die Revolution des Denkens. Immanuel Kant, der bedeutendste Philosoph der Neuzeit, wurde vor 300 Jahren geboren. Aber sein revolutionäres Denken ist bis heute aktuell. Kant erklärt die Entstehung unseres Planetensystems, begründet eine neue Form von Metaphysik und formuliert den kategorischen Imperativ. Kant war Wegbereiter des Kosmopolitismus und der Idee der Menschenwürde. Sein Denken hat nicht nur die Philosophie und Wissenschaft, sondern auch das deutsche Grundgesetz und die Vereinten Nationen geprägt. In seinem Buch schildert Marcus Willaschek auf verständliche und anschauliche Weise die vielen Facetten von Kants Revolution des Denkens, die den aktiven Menschen in den Mittelpunkt der Welt stellt. Willascheks Buch verfolgt Kants Revolution des Denkens durch sein gesamtes Werk hindurch. Es vermittelt so einen umfassenden Einblick in seine Philosophie. In dreißig kurzen, jeweils für sich lesbaren Kapiteln stellt Willaschek die verschiedenen Themen und Aspekte von Kants Denken klar, pointiert und verständlich vor. Seine Darstellungen sind jeweils verflochten mit biografischen und historischen Miniaturen, sodass auch ein Bild von Immanuel Kant als Mensch und Philosoph in seiner Zeit entsteht. Zugleich wird die aktuelle Relevanz – und gelegentlich auch die Problematik – seines revolutionären Denkens deutlich. Inhaltsverzeichnis
Vorwort 13
Zitierweise 17 1. Kants drei Revolutionen 19 Die drei Revolutionen im Leben Kants: die Revolution der Gesinnung, die Revolution der Denkart, die Französische Revolution. Ein erster Überblick über Kants Leben. Drei zentrale Merkmale der kantischen Philosophie: der Vorrang der Praxis, die Objektivität des menschlichen Standpunkts, der vermittelnde Charakter des kantischen Denkens. T E I L I Politik und Geschichte innerhalb der Grenzen der bloßen Vernunft 2. Das höchste politische Gut: Der «ewige» Frieden 35 Kant über Krieg und Frieden. Kants Schrift Zum ewigen Frieden. Die Bedingungen für einen «ewigen Frieden»: repräsentative Demokratie und Völkerbund. Die Natur als Garantiemacht. Kants Verbindung von politischem Realismus und moralischem Idealismus. Wilsons 14-Punkte-Plan und die Vereinten Nationen. 3. Moses Mendelssohn und der Fortschritt der Menschheit 47 Die Kant-Medaille. Freundschaft mit Herz und Mendelssohn. Der Fortschritt der Menschheit. «Idee zu einer allgemeinen Geschichte der Menschheit» und «Über den Gemeinspruch». Antagonismus und ungesellige Geselligkeit. Die Rolle der Natur. Kant über Juden und Judentum. 4. Die Aufklärung und ihre Dialektik 59 Das Entstehen einer Öffentlichkeit. Die Berlinische Monatsschrift. Aufklärung. «Beantwortung der Frage: Was ist Aufklärung?» Kant über Frauen. Pressefreiheit. Die Dialektik der Aufklärung (Horkheimer / Adorno). Aufklärung braucht mehr als Mut und Freiheit. 5. Freiheit und Zwang: Kant über Erziehung 73 Kant als Erzieher. Der Einfluss Rousseaus. Vorlesungen über Pädagogik. Erziehungsziele und -stufen. Schulbildung. Das Philanthropin. Kant als Hochschullehrer. Selbstdenken. T E I L I I Die Moral der Vernunft 6. Kult der Vernunft: Von Menschen, Göttern und Außerirdischen 87 Der «Kult der Vernunft». Der Begriff der Vernunft in der Tradition und bei Kant. Empirismus und Rationalismus, Religion und Aufklärung. Kants Mutter und seine Erziehung. Vernünftige Wesen und die Sinnlichkeit. Kant und die Außerirdischen. 7. Großer Kant, der kategorische Imperativ hilft mir nichts! 99 Maria von Herbert. Der kategorische Imperativ und der «Fall Eichmann». Maximen. Einwände von Hegel und Constant. Lügenverbot. Kategorischer Imperativ keine Erfindung Kants. Abgrenzung von der Goldenen Regel. Fehler Kants in der Anwendung des kategorischen Imperativs. 8. Der Maurer als Zweck an sich 111 Kants 60. Geburtstag. Der Philosoph kauft sich ein Haus. Die Grundlegung zur Metaphysik der Sitten. Verbindlichkeit moralischer Regeln. Handeln aus Pflicht. Naturrechts- vorlesung 1784. Der Mensch als Zweck an sich. 9. «Rousseau hat mich zurechtgebracht»: Menschenwürde und Autonomie 121 Kants Bildungsweg und sozialer Aufstieg. Kant und Rousseau. Autonomie. Freiheit als Selbstgesetzgebung und Selbst- bindung. Würde des Menschen als vernünftiges Wesen. 10. Das «höchste Gut» und die beste aller möglichen Welten 133 Kant über das Glück. Utilitarismus. Die Bedeutung des Glücks für Individuum und Staat. Das höchste Gut. Leibniz’ Theodizee und der «Optimismus». Gott und Unsterblichkeit als moralische Postulate. Noch einmal: Fortschritt. T E I L I I I Vernunftwesen in Gesellschaft 11. «Ich habe das Heil der Welt gesehen!» Kant über Recht und Revolution 147 Kant und die Französische Revolution. Kants Rechtslehre. Recht als Grenze und Schutz äußerer Freiheit. Recht zwischen Freiheit und Zwang. Der Gesellschaftsvertrag. Republik und Demokratie. Strafrecht und Todesstrafe. 12. «Dies ist mein»: Über geistiges und anderes Eigentum 161 Kants Testament. Kants Vermögen, seine Einnahmen aus Buchhonoraren. Kant über geistiges Eigentum und Büchernachdruck. Eigentumstheorien in der Neuzeit. Ungleicher Wohlstand durch «Ungerechtigkeit der Regierung». Entlassung Lampes. 13. Weltbürger in Königsberg 173 Königsberg. Kants Lektüre von Reiseberichten und seine Vorlesungen über physische Geografie. Die Kugelgestalt der Erde. Kant als Theoretiker der Globalisierung. Das Weltbürgerrecht. Flüchtlinge und Asyl in Kants Zeit und heute. Kant als Kritiker des Kolonialismus. 14. Die Freiheiten eines untertänigen Knechts 185 Rechte und Freiheiten im Preußen des 18. Jahrhunderts. Friedrich der Große und Friedrich Wilhelm II . Kant und die Zensur. Strafandrohung des Königs. Innere und äußere Frei- heit, Spontaneität und Determinismus. Selbstgesetzgebung. 15. Das Reich Gottes auf Erden: Kants Vernunftreligion 197 Kant als Protestant. Die Religion innerhalb der Grenzen der bloßen Vernunft. Moralische Gebote als göttliche betrachtet. Das radikale Böse. Göttliche Außenperspektive auf innere Revolution. Hegels Individualismus-Einwand. Religion als soziale Seite der Moral. Kants Kritik an den christlichen Kirchen. Vernunftreligion. T E I L I V Der Mensch als Teil der Natur 16. Was ist (und wer ist) ein Mensch? 209 Kants Begriff der Menschenrasse. Vier verschiedene Menschenrassen, aber eine Gattung. Kant und der Rassismus. Die drei kantischen Fragen und die Frage «Was ist der Mensch?» Die «Bestimmung des Menschen». Ist jeder Mensch ein vernünftiges Wesen? 17. Über den Witz und andere Vermögen: Kant als Psychologe 221 Kants Humor. Seine Theorie des Lachens und des Witzes. Die Anthropologievorlesungen. Empirische Psychologie. Bewusste und unbewusste Vorstellungen. Kants Vermögen- lehre als funktionale Erklärung. Descartes’ Begriff der Seelensubstanz und Kants Kritik. Unsterblichkeit und Angst vor dem Tod. 18. Zeigen die schönen Dinge, dass der Mensch in die Welt passt? 233 Die Beobachtungen über das Gefühl des Schönen und Erhabenen. Die «Bemerkungen zu den Beobachtungen». Kant als «galanter Magister». Freundschaft mit Green. Kant als Rezipient von Literatur, Schauspiel, bildender Kunst und Musik. Kants Theorie ästhetischer Erfahrung und die moderne Kunst. Das Genie und das Erhabene. 19. Der bestirnte Himmel über mir: Kant als Naturwissenschaftler 245 Gesetze der Natur und der Moral. Kants naturwissenschaft- liches Werk. Die Kosmologie. Naturgesetze, Naturgeschichte und Teleologie. Das Opus postumum. Kant im Alter. 20. Sind Tiere Maschinen? Kant über Teleologie 257 Vaucansons Automaten. Relative und innere Zweckmäßigkeit. Descartes und die «seelenlosen» Tiere. Leibniz’ Monaden- lehre. Mechanische und teleologische Erklärungen der Natur. Die Antinomie der teleologischen Urteilskraft. Zweckmäßigkeit als regulatives Prinzip. Tiere sind keine Maschinen. T E I L V Metaphysische Erkenntnis und ihre Grenzen 21. Metaphysik: Letzte Fragen und keine Antworten? 271 Kants erfolglose Bewerbung auf die Metaphysik-Professur. Metaphysik und Vernunft. Von Leibniz und Wolff zu Hume. Antinomien. Von der Kritik der reinen Vernunft zur Metaphysik der Sitten. Kants Berufung auf die Professur. 22. Kritik: Die Vernunft prüft alles, auch sich selbst 285 Deutsch als Wissenschaftssprache. Das Wort ‹Kritik› und die Kritik der reinen Vernunft. Kants Kritik an der Wolff ’schen Philosophie. A priori / a posteriori, analytisch / synthetisch, synthetische Urteile a priori. Grenzen der Vernunft. Herders Einwand: Wer kritisiert die Vernunft? 23. Wir müssen unsere Begriffe sinnlich machen! 297 Der Begriff der Vorstellung. Idealismus und Realismus. Anschauung und Begriff, Sinnlichkeit und Verstand. Herders Kritik. Zurückweisung von Empirismus und Rationalismus. Kants Erkenntnistheorie. Synthesis. Erkenntnis und Wissen. 24. Körper im Spiegel: Kant über den Raum 309 Kants Erscheinungsbild. Chiralität und inkongruente Gegenstücke. Newton und Leibniz über den Raum. Kants Antwort: transzendentaler Idealismus: Raum und Zeit als Anschauungsformen; Dinge in Raum und Zeit als Erscheinungen. 25. Objektivität (fast) ohne Objekt 321 Kants Brief an Marcus Herz vom 21. Februar 1772. Der Gegenstandsbezug von Vorstellungen. Das Problem der Herkunft und Geltung metaphysischer Begriffe. Kants Lösung in der Kritik der reinen Vernunft: Kategorien als Bedingung der Möglichkeit von Erfahrung. Die «transzendentale Deduktion» der Kategorien. Objektivität des menschlichen Standpunkts. Die Entstehung der Kritik der reinen Vernunft. 26. Streit um die Dinge an sich: Kants Kritik und ihre ersten Kritiker 333 Frühe Reaktionen auf die Kritik der reinen Vernunft. Die Göttinger Rezension und Berkeleys Idealismus. Die Prolegomena. Jacobis Einwand und der Weg zum Deutschen Idealismus. Frühe Kantianer: Fichte, Reinhold, Beck und Schulz. Drei Lesarten des transzendentalen Idealismus. 27. Unendliche Reihe oder erster Anfang? Kant über Willensfreiheit 345 Die drei Kritiken. Kants Tischgesellschaft. Das Problem der Willensfreiheit. Die Kritik der praktischen Vernunft. Das Verhältnis von Freiheit und Determinismus. Die Antinomien. Unverursachte Verursachung. Die Möglichkeit von Willensfreiheit. Empirischer und intelligibler Charakter, sinnliche und intelligible Welt. 28. War Kant ein Atheist? 359 Atheismus, Deismus und Religionskritik im 18. Jahrhundert. Kant als Atheist? Kants Widerlegung der drei klassischen Gottesbeweise. Die Frage der Existenz Gottes übersteigt die menschliche Erkenntnis. Gott als moralische Denknotwendigkeit. Der Pantheismusstreit. T E I L V I Das Ende 29. Wie alles zusammenhängt: Philosophie 373 Der greise Kant. Kant als Philosoph. Schul- und Weltbegriff der Philosophie. Die praktische Zielsetzung der kantischen Philosophie. Der ewige Friede in der Philosophie und Kants Polemik gegen seine Kritiker. Kants Tod. 30. «Das reine Gold seiner Philosophie»: Kants Wirkung 385 Schellings Nachruf auf Kant. Der Neukantianismus und seine Nachwirkungen. Kant-Forschung heute. Warum noch Kant lesen? Anhang Dank 395 Zeittafel 397 Glossar 399 Anmerkungen 403 Bildnachweis 425 Personenregister 427 |
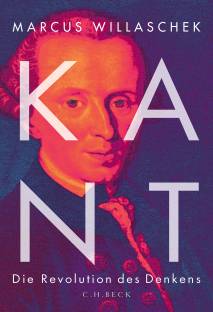
 Bei Amazon kaufen
Bei Amazon kaufen