|
|
|
Umschlagtext
Nur wenige deutsche Dichter haben eine ähnlich starke Aufmerksamkeit bis in die jüngste Gegenwart erhalten wie Friedrich Hölderlin, Er hat in Literatur, Philosophie, Musik und bildender Kunst auch international unabsehbare Wirkung. - Das Handbuch bietet ein fundiertes und verlässliches Set an Informationen über den aktuellen Forschungs- und Wissensstand zu Hölderlins Leben und Werk sowie zu Nachwirkungen und Rezeption.
Rezension
Friedrich Hölderlin (1770-1843) ist biographisch eine tragische Figur und literarisch wurde er erst 100 Jahre später entdeckt. Dann aber hat er eine breite Wirkung erzielt und so nimmt die Rezeptionsgeschichte in diesem Handbuch zu Recht fast 100 S. ein. Die Zeitgeschichte ist bedeutsam; es ist die zeit der französischen Revolution, als der Halb-Waise Hölderlin auf Wunsch der Mutter ins Tübinger Stift, der theologischen Zwangsanstalt des württembergischen Herzogs, geht zur Vorbereitung auf das Pfarramt. Der lange Kampf der Befreiung gegen die Mutter beginnt, - analog zu den politischen Entwicklungen. Aber Hölderlin wird ihn letztlich biographisch verlieren … - Dieses Handbuch stellt die äußeren Umstände im ersten Teil dar, die Rezeptionsgeschichte im letzten Teil und dazwischen wird das Werk Hölderlins auf ca. 300 S. umfassend in allen Facetten gewürdigt.
Thomas Bernhard für lehrerbibliothek.de Pressestimmen Das Handbuch ist für jeden, der Hölderlin kennt und schätzt, unentbehrlich. Forum Classicum Verlagsinfo
Autoreninformation Johann Kreuzer, Promotion 1984 mit einer Arbeit über Hölderlin; 1992 Habilitation in Philosophie; Herausgeber eines Bandes mit Hölderlins "Theoretischen Schriften" (Hamburg 1998), Professor für Geschichte der Philosophie an der Carl-von-Ossietzky-Universität Oldenburg. Inhaltsverzeichnis
Inhaltsübersicht
Vorwort XIII Siglen XV Editionen 1 Drucke zu Lebzeiten 1 19. Jahrhundert 2 Die Ausgaben von Hellingrath und Zinkernagel 3 Die Große Stuttgarter Ausgabe (StA) 4 Die Frankfurter Hölderlin-Ausgabe (FHA) 7 Neuere Teileditionen, Lese- und Studienausgaben 10 Zeit und Person 13 Epoche 14 Kloster – Stift – Beruf 20 Liaisons – Imago und Realität 31 Freundschaften 37 Frankreich (Dezember 1801-Juni 1802) 45 Die Jahre 1806–1843 51 Zur Geschichte des Hölderlinschen Nachlasses 56 Voraussetzungen, Quellen, Kontext 61 Schule und Universität 62 Rousseau, Schiller, Herder, Heinse 72 Kant, Fichte, Schelling 90 Hölderlin und die Frühromantik 107 Poetologie 117 Wechsel der Töne 118 Geschichtserfahrung und poetische Geschichtsschreibung 128 Tragische Erfahrung und poetische Darstellung des Tragischen 138 Zeit, Sprache, Erinnerung (Dichtung als Zeitlogik) 147 Späte Hymnen, Gesänge, Vaterländische Gesänge? 162 Werk 175 Hyperion 176 Empedokles 198 Theoretische Schriften 224 Sophokles-Anmerkungen 247 Pindarfragmente 254 Übersetzungen 270 Frühe Hymnen 290 Oden 309 Elegien 320 Nachtgesänge 336 Gesänge 347 Homburger Folioheft 379 Entwürfe 395 Späteste Gedichte 403 Briefe 410 Rezeption 421 Norbert von Hellingrath 422 Jüdische Rezeption 426 Heidegger 432 Benjamin – Adorno – Szondi 439 Nationalsozialismus und Exilrezeption 444 Deutsche Germanistik der BRD und der DDR 449 Rezeption im Westen 454 Japan 461 Nachwirkungen 467 Nachwirkungen in der Literatur 468 Nachwirkungen in der bildenden Kunst 489 Nachwirkungen in der Musik 500 Zeittafel 513 Bibliographie 525 Register 541 Werkregister 542 Personenregister 549 Verzeichnis der Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter 558 Inhaltsverzeichnis Vorwort XIII Siglen XV Editionen 1 Drucke zu Lebzeiten 1 19. Jahrhundert 2 Die Ausgaben von Hellingrath und Zinkernagel 3 Die Große Stuttgarter Ausgabe (StA) 4 Die Frankfurter Hölderlin-Ausgabe (FHA) 7 Neuere Teileditionen, Lese- und Studienausgaben 10 Zeit und Person 13 Epoche 14 Französische Revolution 14 Bonaparte – Napoleon 14 Der Rastatter Kongreß 16 Württemberg 17 Die Landstände 18 Kloster – Stift – Beruf 20 Lauffen am Neckar und Nürtingen 20 Die niedere Klosterschule Denkendorf 21 Schwäbischer Pietismus 21 – Klosterleben und Ausbildung 22 – Die Württembergische Landeskirche 23 Die höhere Klosterschule Maulbronn 24 Die Studienjahre im Tübinger Stift 25 Dichterbund – Freundschaftsbund 27 Christian Ludwig Neuffer 27 – Rudolf Friedrich Heinrich Magenau 28 – Der Aldermannsbund 28 H.s erste Hofmeisterstelle 29 Liaisons – Imago und Realität 31 Wilhelmine Kirms 31 Diotima – Susette Gontard 31 Eine »frappante« Unterbrechung 32 – Die Idealisierung der Frau in der Literatur des 18. Jahrhunderts 34 – Und die Realgeschichte? 35 Freundschaften 37 Friedrich Immanuel Niethammer 37 Georg Wilhelm Friedrich Hegel 38 Friedrich Wilhelm Joseph Schelling 38 Isaac von Sinclair 39 Casimir Ulrich Böhlendorff 40 Die Gesellschaft der freien Männer (Litterärische Gesellschaft) 41 – Schweiz – glückliche Republik? 41 –Republikanische Poeten 42 Frankreich (Dezember 1801-Juni 1802) 45 Die Hinreise: Straßburg-Lyon-Bordeaux 45 Der Aufenthalt in Bordeaux: 28. Januar – Mai 1802 46 Rückkehr nach Deutschland 47 Rückschau: Andenken 49 Die Jahre 1806–1843 51 Überlieferung 51 Vorgeschichte, faktische Entmündigung und Klinikaufenthalt 52 Verhalten und tägliches Leben bei der Kostfamilie Zimmer 53 Anmerkungen zur pathographischen Debatte 54 Zur Geschichte des H.schen Nachlasses 56 Das Schriftgut 56 Die Realien 58 Voraussetzungen, Quellen, Kontext 61 Schule und Universität 62 Schulbildung 62 Universitätsausbildung 63 Philosophiestudium 63 – Theologiestudium 70 Rousseau, Schiller, Herder, Heinse 72 Jean Jacques Rousseau 72 Friedrich Schiller 78 Johann Gottfried Herder 82 Wilhelm Heinse 86 Kant, Fichte, Schelling 90 Kant 90 Kants »Kritik der reinen Vernunft« 90 – Kants »Grundlegung zur Metaphysik der Sitten« und »Kritik der praktischen Vernunft « 91 – Kants Ästhetik in der »Kritik der Urteilskraft« 92 – Kants Antinomie der teleologischen Urteilskraft und die Antinomie der Freiheit 93 – H.s Ideal der Volkserziehung im Licht von Kants Antinomie der Freiheit 94 Fichte 94 »Fichte bestätiget mir« 95 – »Ur-theilung« – »ursprünglich Theilen« 97 – Fichtes Antinomie von Ich und Nicht-Ich und das »Schweben der Einbildungskraft« 99 – Wechselbestimmung von Endlichem und Unendlichem 100 – Die Poetologie der Wechselbestimmung von Geist und Stoff 101 Schelling 103 Ursprünglicher Widerstreit des Geistes 103 Hölderlin und die Frühromantik 107 Bezugnahmen 107 Theoretische Positionen 108 Anknüpfung an Platon 109 – Anknüpfung an Kant 109 – Anknüpfung an Fichte 110 – Endlichkeit – Unendlichkeit 111 – Philosophie und Poesie 112 – Religion und Neue Mythologie 113 – Bildung des Individuums und Geschichtsutopie 115 Poetologie 117 Wechsel der Töne 118 Ausgangspunkte 119 Umfang und Wurzel der Tonlehre 119 Der poetische Geist in seinem Werk 121 Tonstruktur und Gattungspoetik 122 Versuche der Anwendung 125 Geschichtserfahrung und poetische Geschichtsschreibung 128 Die Zeitlichkeit des Absoluten und die Genese des Problemfeldes »Geschichte« 128 Die poetische »Mythe« als lebendiger Zusammenhang 131 Poetische Geschichtsschreibung und Geschichtlichkeit der Poesie 134 Tragische Erfahrung und poetische Darstellung des Tragischen 138 Genese und Problematik eines modernen Trauerspiels 138 Die zeitgenössische Insistenz der tragischen Erfahrung 140 Die Transformation der tragischen Erfahrung in der modernen Poesie 143 Zeit, Sprache Erinnerung (Dichtung als Zeitlogik) 147 Bezugspunkte 147 Gedächtnis und Erinnerung (Religion) 149 Erinnerung und Zeit (Geschichte) 150 »Eine Erinnerung haben« 154 Die schöpferische Reflexion der Sprache 155 Poetische Logik 157 Sprache und Erinnerung: Logik der Zeit 160 Späte Hymnen, Gesänge, Vaterländische Gesänge? 162 Hymnen und hymnisches Sprechen 163 Gesänge als Vorspiel 166 Werk 175 Hyperion oder Der Eremit in Griechenland 176 Entstehung 176 Analyse und Deutung 176 Die frühen Fassungen 177 – Erster Band, Erstes Buch 179 – Erster Band, Zweites Buch 182 – Zweiter Band, Erstes Buch 187 – Zweiter Band, Zweites Buch 189 Schlußbetrachtung 195 Empedokles 198 Chronologie und Textkonstitution 198 Der Wechsel des Protagonisten 199 Empedokles im 18. Jahrhundert 201 H.s Einspruch 202 Frankfurter Plan 203 H.s Portrait von Empedokles 204 Erster Entwurf 206 Zweiter Entwurf 211 Grund zum Empedokles 213 Dritter Entwurf 217 Das Experiment einer anderen Sophokles-Lektüre 221 Rezeption 222 Theoretische Schriften 224 Frühe Aufsätze 224 Entstehung 224 Analyse und Deutung 225 Seyn, Urtheil, Modalität 228 Entstehung 228 Analyse und Deutung 228 Fragment philosophischer Briefe 232 Entstehung 232 Analyse und Deutung 233 Aufsätze zur Poetologie 237 Frankfurter Aphorismen 237 Journal-Aufsätze 238 Poetologische Entwürfe 241 Sophokles-Anmerkungen 247 Gliederung und Aufbau 247 Analyse und Deutung 247 Pindarfragmente 254 Entstehung 254 Analyse und Deutung 257 Das Höchste 257 – Vom Delphin – Das Alter 259 – Von der Ruhe 260 – Das Unendliche 261 – Von der Wahrheit 261 – Die Asyle 262 – Untreue der Weisheit 263 – Das Belebende 267 Übersetzungen 270 Arbeiten vor 1800 270 Homers Iliade 270 – Lucans Pharsalia 271 – Reliquie aus Alzäus 271 – Ovid: Phaëthon 271 – Dejanira an Herkules (aus Ovids Heroiden) 272 – Nisus und Euryalus (aus Vergils Aeneis) 272 – Sophokles: Chor aus dem Oedipus auf Kolonos 273 – Aus der Hekuba des Euripides 273 – Horaz: Oden II,6 und IV,3 273 – Leander an Hero (aus Ovids Heroiden) 274 – Die Bacchantinnen des Euripides 274 Um 1800: Pindar 275 Bis 1805: Sophokles 278 Bruchstücke aus Sophokles nach 1800: Oedipus auf Kolonos und Ajax 278 – Die Trauerspiele des Sophokles: Oedipus der Tyrann. Antigonä 279 Frühe Hymnen 290 Entstehung 291 Hymnische Ansätze in der Klosterschulzeit 291 – Klopstock als Lehrer Hölderlins 293 – Die Grundlegung der Tübinger Hymnik in der Harmoniehymne 295 – Neue Studienimpulse 296 – Die Bundeslieder und Schillers Liebesphilosophie 296 Analyse und Deutung 299 Die metrische Gestaltung der Tübinger Hymnen 299 – Die Hymneneingänge 300 – Die gedankliche Entwicklung der Hymnen in den Aretalogien 301 – Die Appellstruktur der Hymnen 305 – Die Hymnenschlüsse 306 – Der Grundriß der Tübinger Hymnen 307 Zeitgenössische Aufnahme und Wirkung 307 Oden 309 Einleitung 309 Phasen der Odendichtung 309 1: 1786–1789 (Maulbronn, Tübingen) 309 – 2: Januar 1796-Sommer 1798 (Frankfurt) 309 – 3: Herbst 1798-Sommer 1800 (Homburg) 309 – 4: Sommer 1800 – Frühjahr 1801 (Stuttgart, Hauptwil) 310 – 5: Juni bis September 1801 (Nürtingen) 310 – 6: Nach 1806 (Tübingen) 310 Analyse und Deutung 311 Für Phase 1: Keppler 311 – Für Phase 2: Dem Sonnengott – Sonnenuntergang 312 – Für Phase 3: Der Main 314 – Für Phase 4: Dem Ahnenbild – Unter den Alpen gesungen 315 – Für Phase 5: Stimme des Volks 317 – Für Phase 6: Nicht alle Tage – Wenn aus der Ferne 318 Elegien 320 Elegien und Epigramme 320 Der Wanderer 321 Menons Klagen um Diotima 322 IX Inhaltsverzeichnis Der Gang aufs Land 324 Heimkunft 325 Brod und Wein 327 Rezeption und Überlieferung 327 – Komposition 328 – Zum Gehalt 330 Stutgard 331 Die Revision der drei letzten Elegien 332 Nachtgesänge 336 Die Problematik des Titels 337 Der Adressat 338 Das lyrische Ich 340 Die Gäste 342 Die Tendenz der Auswahl und Überarbeitung 343 Gesänge 347 Einführung 347 Zur Frage der Gattungsbezeichnung 349 Gesamtüberblick 351 Wie wenn am Feiertage 356 Germanien 358 Der Rhein – DieWanderung 360 Die Christushymnen 363 Der Einzige 364 – Friedensfeier 367 – Patmos 371 Andenken 374 Mnemosyne 375 Homburger Folioheft 379 Entstehung 379 Zweck 382 Analyse und Deutung 382 Edition 384 Norbert von Hellingrath 384 – Franz Zinkernagel 385 – Friedrich Beißner (StA) 386 – D.E. Sattler (FHA) 387 – Dietrich Uffhausen 391 – Michael Knaupp 392 – Dieter Burdorf 393 Entwürfe 395 Der Stoff 396 Abweichung vom vaterländischen Gesang 397 Die verschiedenen Schicksale der Heroen (Synchronie) 397 Die verschiedenen Charaktere der Natur (Syntopie) 398 Dichter und Götter 399 Dissonante Natur 399 Perspektivik 400 Späteste Gedichte 403 Entstehung und Überlieferung 403 Analyse und Deutung 404 Rezeption 409 Briefe 410 Entstehung und Druck 410 Analyse und Deutung 410 Lageberichte 411 – Zur ökonomischen und beruflichen Lage – die Rechtfertigungsbrief 412 – Zur seelischen und sozialen Lage – die Freundschaftsbriefe 413 – Berichte zur politischen Lage und zur Lage der Menschheit im allgemeinen 414 – Poetologische Lageberichte – die Werkstattbriefe 416 Rezeption 421 Norbert von Hellingrath 422 Jüdische Rezeption 426 Das deutsche Judentum 426 Die Bedeutung Hölderlins 426 Krieg und Deutschtum 426 – Zionismus und Sprache 427 Beiträge zur H.-Forschung 428 Ludwig Strauß 429 – Ästhetik und Poetik 430 Heidegger 432 Hölderlin als Geschick 432 Hölderlins Dichtung als Stiftung des Seyns 433 Die Zwiesprache Heideggers mit Hölderlin im Kontext der Forschung 436 Benjamin – Adorno – Szondi 439 Benjamin 439 Adorno 440 Szondi 441 Nationalsozialismus und Exilrezeption 444 Philologie oder Deutung? 444 Popularisierungen und Hölderlin-Paraphrasen 445 Hölderlin im Exil/Vertonungen 446 Deutsche Germanistik der BRD und der DDR 449 Germanistik West: ›heilig nüchtern‹ 449 Germanistik Ost: Der Revolutionär in der Sackgasse 450 Edition, Revolution, Subversion 451 Patient Hölderlin? 451 Rephilologisierung erneut? 452 Rezeption im Westen 454 Frankreich 454 England 458 USA 458 Italien – Spanien – Portugal – Lateinamerika 459 Niederlande – Skandinavien 459 Griechenland 459 Japan 461 Ansätze 461 Erste Phase bis 1945 461 Zweite Phase 1945–1970 463 Dritte Phase ab 1970 464 Nachwirkungen 467 Nachwirkungen in der Literatur 468 Vorbemerkung 468 Philosophen und Hölderlin 468 Schwäbische Schule 473 Romantiker 476 Jungdeutsche und Realisten 478 Ende 19. Jahrhundert und Jahrhundertwende 480 Literatur der Nachkriegszeit 483 Nachwirkungen in der bildenden Kunst 489 Vorbemerkung 489 Die Künstler und ihre Werke 489 Nachwirkungen in der Musik 500 Hölderlin und die Musik 500 Die Musiker und Hölderlin 500 Das 19. Jahrhundert und das »Fin de siècle« 501 Die Zwölftonmusik zu Beginn des 20. Jahrhunderts 502 Die 1930er bis 1950er Jahre 503 Die 1950er bis 1970er Jahre: Serialismus und Tradition 504 Die 1970er Jahre bis in die Gegenwart: Von der Tonmusik zur Klangmusik 505 Zeittafel 13 Bibliographie 525 Register 541 Werkregister 542 Personenregister 549 Verzeichnis der Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter 558 |
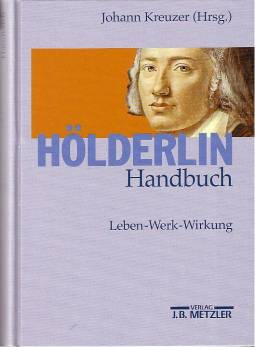
 Bei Amazon kaufen
Bei Amazon kaufen