|
|
|
Umschlagtext
Wer Nietzsches Philosophie verstehen will, muss seinen Antichrist (1888) verstehen. Jedenfalls dann, wenn man Nietzsches späten Beteuerungen Glauben schenkt, dieses scharfzüngige und schrille Werk sei seine ganze «Umwerthung aller Werthe». Umso erstaunlicher, dass es bis anhin kein einziges Buch gab, das sich ausschliesslich einer gründlichen Untersuchung des Antichrist widmete. Eine solche will der vorliegende Kommentar leisten, der sich weniger in einer philologischen Aufbereitung von Vorstufen und Vorarbeiten ergeht, als vielmehr eine umfassende philosophische Einordnung dieses hervorstechenden Nietzsche-Werkes unternimmt. Ein solches Unternehmen kommt nicht ohne sorgfältige Diskussion der von Nietzsche benutzten Quellen und ihrer Adaption aus. Gleichwohl stehen systematische Fragen im Brennpunkt: Denn Nietzsche verabschiedet im Antichrist scheinbar sang- und klanglos jene Gedanken, die man als seine «Hauptlehren» anzusprechen gewohnt ist: Von «Ewiger Wiederkunft des Gleichen» ist keine Rede mehr; der «Übermensch» rückt an die Peripherie des Geschehens, während uns der Text in Jesus einen «Typus» vorführt, dem «Wille zur Macht» vollständig zu fehlen scheint. Dafür redet Der Antichrist einer Züchtung das Wort, die eugenische Anklänge ebensowenig verleugnet wie einen radikalen Antiegalitarismus und Antidemokratismus. Als politische Tendenzschrift gelesen, ist Nietzsches Antichrist ein bedenkliches und gefährliches Buch. Umso dringlicher ist eine genaue Analyse seiner Argumentationsund Verführungsstrategien.
Der hier vorgelegte, erste umfassende monographische Versuch, Nietzsches Antichrist zu verstehen, trägt nicht nur zum Verständnis von Nietzsches spätem Philosophieren bei. Er macht auch deutlich, dass den Antichrist verstehen muss, wer das moderne Christentum verstehen will. Denn dieses ist vom Nietzsche-Trauma zutiefst gezeichnet. Der Autor Andreas Urs Sommer, geboren 1972 in Zofingen (Schweiz), studierte Philosophie, Kirchen- und Dogmengeschichte sowie Deutsche Literaturwissenschaft in Basel, Göttingen und Freiburg i.Br. Nach seiner Promotion 1998 war er als Visiting Fellow an der Princeton University (USA) und am Forschungszentrum für Europäische Kulturgeschichte der Herzog August Bibliothek in Wolfen-büttel tätig und lehrt heute Philosophie an der Ernst-Moritz-Arndt-Universität in Greifswald. Seine Forschungen gelten hauptsächlich der Philosophie- und Geistesgeschichte des 17. bis 20. Jahrhunderts. Neben zahlreichen Aufsätzen hat er folgende Bücher veröffentlicht: Der Geist der Historie und das Ende des Christentums. Zur Waffengenossenschaft von Friedrich Nietzsche und Franz Overbeck (1997); Im Spannungsfeld von Gott und Welt. Das Frey-Grynaeische Institut in Basel 1747-1997 (1997); Albert Schweizer - Fritz Buri. Existenzphilosophie und Christentum (2000); Die Hortung. Eine Philosophie des Sammeins (2000). Rezension
Nietzsche wird in der gegenwärtigen Postmoderne wie wohl kein Zweiter zum Gewährsmann genommen. Nicht immer aber wird sein Werk auch subtil und genau wahrgenommen, allzu oft beschränkt sich die Rezeption vordergründig auf einige populäre Äußerungen. Ganz anders dieser detaillierte, hintergründige und minutiöse Kommentar zu Nietzsches bedeutsamen Spätwerk "Der Antichrist" (1888). Der Baseler Schwabe-Verlag macht sich nicht nur mit dieser bedeutsamen Reihe "Beiträge zu Friedrich Nietzsche" verlegerisch um Werk und Interpretation Nietzsches verdient. Dem Autor gelingt eine umfassende, präzise, hintergründige und dennoch literarisch anspruchsvolle, z.T. amüsante Kommentierung, die Nietzsches Quellen berücksichtigt, das Werk historisch-philosophisch auch in die eigene Entwicklung der Gedanken Nietzsches einordnet und die Differenzen zum Frühwerk deutlich markiert. Der Autor ist besonders um das Herausarbeiten der Argumentationsstrategien Nietzsches bemüht, - auch um die antidemokratischen Tendenzen des "Antichrist" zu begreifen. Zugleich wirft Nietzsches "Antichrist" auch ein Licht auf das moderne Christentum, denn kaum ein anderes Buch des 19. Jahrhunderts dürfte das etablierte Kirchenchristentum derart aufgeschreckt haben wie dieses Spätwerk Nietzsches. Trotz aller vorlaufenden atheistischen Kritik am Christentum im 19. Jhdt. durch andere Autoren war Nietzsches «Fluch auf das Christentum» von bis dahin ungewohnter Militanz. Diese vernichtende Kritik aber ist nicht nur der Rhetorik geschuldet, sondern auch den inhaltlichen Argumenten. Sommers Konzept, bei seinem Kommentar Paragraph für Paragraph am Originaltext zu bleiben, arbeitet nicht nur das jeweilige Hauptargument Nietzsches heraus, sondern beleuchtet auch den subtilen Argumentationsweg Nietzsches. Ein brilliantes Werk!
Jens Walter, lehrerbibliothek.de Verlagsinfo
Pressestimmen Sommer schreibt klar, trotz der Fülle kompakt. Über einigen Passagen liegt literarischer Glanz. Das Buch vereinigt Genauigkeit, Gelehrtheit und Witz. Das ist selten, das gibt es fast überhaupt nicht, kurz: Das Buch ist aussergewöhnlich gut. Kurt Flasch, FAZ Der Nietzsche-Forschung, die sich auch um das Verständnis und um die Hintergründe von Nietzsches schneidender Christentumskritik bemüht, ist der hier vorgelegte Kommentar von grossem Nutzen. An ihm wird sie nicht vorbeikommen. Reformierte Presse Friedrich Nietzsches «Der Antichrist» Ein philosophisch-historischer Kommentar Wer Nietzsches Philosophie verstehen will, muss seinen Antichrist (1888) verstehen. Der umfassende Kommentar von Andreas Urs Sommer unternimmt unter Berücksichtigung der von Nietzsche benutzten Quellen eine minutiöse philosophisch-historische Analyse dieses hervorstechenden Werkes. Nietzsche verabschiedet im Antichrist scheinbar sang- und klanglos jene Gedanken, die man als seine «Hauptlehren» anzusprechen gewohnt ist: Von «Ewiger Wiederkunft des Gleichen» ist keine Rede mehr; der «Übermensch» rückt an die Peripherie des Geschehens, während uns der Text in Jesus einen «Typus» vorführt, dem der «Wille zur Macht» vollständig zu fehlen scheint. Dafür redet Der Antichrist einer Züchtung das Wort, die eugenische Anklänge ebensowenig verleugnet wie einen radikalen Antiegalitarismus und Antidemokratismus. Als politische Tendenzschrift gelesen, ist Nietzsches Antichrist ein bedenkliches und gefährliches Buch. Um so dringlicher ist eine genaue Analyse seiner Argumentations- und Verführungsstrategien. Sommers Antichrist-Kommentar trägt nicht nur zum Verständnis von Nietzsches spätem Philosophieren bei, sondern sucht durch Nietzsches Antichrist auch das moderne Christentum zu verstehen. Denn dieses ist vom Nietzsche-Trauma zutiefst gezeichnet. Autor Andreas Urs Sommer, Dr. phil., geb. 1972 in Zofingen (Schweiz), studierte Philosophie, Kirchen- und Dogmengeschichte und Deutsche Literaturwissenschaft in Basel, Göttingen und Freiburg i.Br. Nach seiner Promotion war er als Visiting Fellow an der Princeton University (USA) und an der Herzog-August-Bibliothek in Wolfenbüttel tätig und lehrt heute an der Ernst-Moritz-Arndt-Universität in Greifswald. Er hat zahlreiche Aufsätze und verschiedene Bücher veröffentlicht u.a. zum 18. Jahrhundert, zu Nietzsche, Franz Overbeck, Albert Schweitzer sowie zur Philosophie des Sammelns. Inhaltsverzeichnis
Siglen 12
a) Nietzsche 12 b) Nachschlagewerke und weitere Quellen(editionen) 13 Einleitung 15 Zur Kommentierungsweise 38 Zur Entstehung des Antichrist und zu seiner Stellung in Nietzsches Gesamtwerk 40 Der Antichrist - ein «satyrisches» Maskenspiel? 49 1. HAUPTTEIL Die Wertungsgrundsätze der Kritik. Analyse des Vorworts und der Paragraphen 1-13 Vorwort: Die Vorbestimmung zum idealen Leser 66 § 1. Die Hyperboreer offenbaren sich 77 § 2. Die neuen Werte 87 § 3. Die Züchtung des «höherwerthigeren» Menschen 99 § 4. Höherentwicklung des Individuums versus Höherentwicklung der Gattung 105 § 5. Das Christentum als Hindernis individueller Höherentwicklung 109 § 6. «Verdorbenheit» und nihilistische «decadence» als Grundbedingungen der Moderne 113 § 7. Das christliche und dekadente «Mitleiden» 119 § 8. Die Infektion der Philosophie durch Theologengeist und asketische Ideale 130 § 9. Glaube, Wahrheit und Nihilismus 135 § 10. Die deutsche Philosophie im Banne der «Theologen»-Denkungsart 138 § 11. Kants Pflichtbewusstsein und die Pflicht des Antichrist 144 § 12. Intellektuelle Rechtschaffenheit versus priesterliche «Falschmünzerei» 151 § 13. Die «Methoden» der «freien Geister» brauchen Jahrtausende, um sich durchzusetzen 159 2. HAUPTTEIL Das Christentum im Vergleich. Gottesbegriff und Buddhismus. Analyse der Paragraphen 14-23 § 14. Die neue, antichristliche Anthropologie 170 § 15. Die imaginäre Logik des Christentums 173 § 16. Der Verfall Gottes zu einem impotenten, guten Wesen 179 § 17. Der Dualismus in der Gotteslehre und der Niedergang des jüdischen Gottes 185 § 18. Der christliche Gott als Verneinung des Lebens 195 § 19. Die Dekadenz der «starken Rassen» dank des christlichen Gottes 198 § 20. Der Buddhismus als nihilistische Religion und als Praxis 203 § 21. Buddhistische Gelassenheit versus christlichen Obskurantismus 212 § 22. Das Christentum will Barbaren, der Buddhismus Leiden zähmen 218 § 23. Die orientalischen «Feinheiten» des Christentums, die Interpretation des Leidens und die christlichen Kardinaltugenden 224 3. HAUPTTEIL Die «Entnatürlichung der Natur-Werthe» in Israel und der «Typus des Erlösers. Analyse der Paragraphen 24-35 § 24. Die Geburt des Christentums aus dem Geiste des Judentums 233 § 25. Der Verlust der natürlichen Weltbeziehung im Verlauf der israelitisch-jüdischen Geschichte 245 § 26. Die «priesterlichen» Interessen an der jüdischen Geschichtsfälschung 256 § 27. Das Christentum als anarchistische Fortsetzung des Judentums 265 § 28. Das Projekt einer «Psychologie des Erlösers» 276 § 29. Erste Annäherung an den «psychologischen Typus des Erlösers» 282 § 30. Die physiologischen Voraussetzungen der «Erlösungs-Lehre» 304 § 31. Der Jesus der Evangelien als Erzeugnis nachträglicher Projektion . 310 § 32. Jesus als kindlicher «freier Geist» 317 § 33. Die «neue Praktik» als «frohe Botschaft» und «Seligkeit» 325 § 34. Jesus als «Symbolist» versus kirchliche Christologie 328 § 35. Jesu Passion als Anweisung zur evangelischen Lebenspraxis 334 4. HAUPTTEIL Das «Verhängniss» der Christentumsgeschichte. Analyse der Paragraphen 36-49 § 36. Die «freigewordenen Geister» als Richter des Christentums 337 § 37. Die Christentumsgeschichte als Summierung des Missverständnisses 343 § 38. Der Antichrist richtet die Gegenwart, nicht die Vergangenheit 347 § 39. Zwei Begriffe des Christentums und die psychologischen Voraussetzungen für das Fälschungswerk 356 § 40. Der Tod Jesu schreit nach Rache und Vergeltung 366 § 41. Die Opfertheorie als Rationalisierung des Todes Jesu 377 § 42. Paulus, das priesterliche «Genie im Hass» 385 § 43. Die «Personal-Unsterblichkeit» wertet die Schwachen auf 402 § 44. Die Evangelien als Meisterwerke der moralischen Fälschung 416 § 45. Eine antichristliche Blütenlese aus dem Neuen Testament 425 § 46. Die «Moral» der Kritik am Neuen Testament 435 § 47. Der paulinische Gott als Gott gegen Vernunft und Wissenschaft 448 § 48. Allegorese der Sündenfallgeschichte: Zur Psychologie Gottes 457 § 49. Die «Sünde» als priesterliches Kampfmittel gegen die Wissenschaft 470 5. HAUPTTEIL Die «Psychologie des Glaubens» und das Politischwerden des Christentums. Analyse der Paragraphen 50-62 und des Gesetzes wider das Christenthum § 50. Der Glaubensbeweis durch Kraft und die Nichtidentität von Lust und Wahrheit 475 § 51. Die Krankheit als Möglichkeitsbedingung des Christentums 488 § 52. Geistfeindschaft, «Unvermögen zur Philologie» und Vorsehungsglaube 501 § 53. Das Martyrium beweist keine Wahrheiten 514 § 54. «Skeptiker» versus « § 55. «Überzeugung» und (heilige) «Lüge» 541 § 56. «Heilige» und «schlechte» Zwecke: Das Gesetzbuch des Manu und die Bibel 553 § 57. Natur- und Kastenordnung nach Manu 565 § 58. Die Christen als anarchistische Zerstörer des Römischen Reiches 586 § 59. Die vernichtete «Ernte» der «antiken Welt» 599 § 60. Der Islam, die Kreuzzüge und der deutsche Adel 619 § 61. Die antichristliche Renaissance und die Schuld der Deutschen 626 § 62. Urteilsverkündung und Urteilsbegründung 646 Das Gesetz wider das Christenthum 657 Anstelle eines Nachwortes: 62 Mutmassungen 686 QUELLEN- UND LITERATURVERZEICHNIS I. Quellen 693 a) Manuskripte 693 b) Ausgaben des Antichrist 694 c) Übersetzungen des Antichrist 695 d) Quellen des Antichrist 695 e) Andere publizierte Quellentexte 700 II. Sekundärliteratur 703 a) Zu Nietzsches Antichrist 703 b) Zu Nietzsches Religions- und Christentumskritik 704 c) Zu Nietzsches Quellen und Umfeld 711 d) Zu Nietzsches Philosophie, Leben und Rezeption 714 e) Zu Religion, Judentum und Christentum 720 f) Weitere benutzte Literatur 724 Bibelstellenregister 729 Sach- und Begriffsregister 731 Personenregister 768 Weitere Titel aus der Reihe Beiträge zu Friedrich Nietzsche |
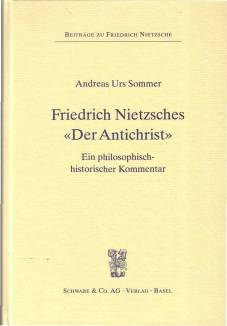
 Bei Amazon kaufen
Bei Amazon kaufen